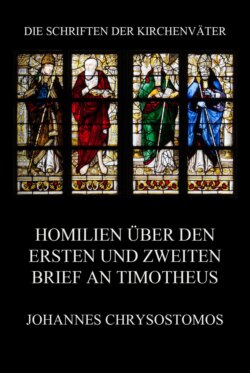Читать книгу Homilien über den ersten und zweiten Brief an Timotheus - Johannes Chrysostomos - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erste Homilie.
ОглавлениеI.
Kap. I.
1. Paulus, der Apostel Jesu Christi, im Auftrage Gottes, unseres Heilandes und Herrn Jesu Christi, der unsere Hoffnung ist, 2. dem Timotheus, dem ächten Sohne im Glauben, Gnade, Erbarmen und Friede von Gott, unserm Vater, und Jesus Christus, unserm Herrn.
I. Groß war die Würde des Apostels, groß und wunderbar. Und überall sehen wir, wie Paulus die Berechtigungstitel seiner Würde vorausschickt; er usurpirt seine bevorzugte Stellung nicht selber, sie ist ihm überantwortet und aufgenöthigt. Denn wenn er sich einen „Berufenen“ nennt, wenn er vom „Willen Gottes“ spricht, durch den er bestimmt wird, und wieder anderswo: „Ein Zwang ist mir auferlegt,“ wenn er ferner sagt: „Ich bin dazu auserlesen,“12 so sind das lauter Verwahrungen gegen den Vorwurf des Ehrgeizes und der Anmaßung. Gleichwie nämlich Derjenige, der eine von Gott nicht angebotene Bevorzugung usurpirt, den schärfsten Tadel verdient, so setzt sich Derjenige, der eine solche zurückweist und ablehnt, einem anderen Vorwurfe aus, dem des Ungehorsams und der Widerspenstigkeit.
Dieß spricht nun Paulus auch jetzt im Eingange Briefes an Timotheus aus, indem er sagt: „Paulus, Apostel Jesu Christi, im Auftrage Gottes.“ Er sagt hier nicht: „Paulus, der Berufene,“ sondern: „im Auftrage Gottes.“ Damit nämlich dem Timotheus nicht ein Irrthum begegne und er nicht auf den Glauben komme, der Apostel rede mit ihm so wie mit den Schülern, daher dieser Eingang.13
Wo hat ihm Gott einen Auftrag gegeben? Es findet sich in der Apostelgeschichte eine Stelle, wo der hl. Geist sagt: „Sondert mir den Paulus und Barnabas ab!“14 Und allenthalben in seinen Briefen fügt er den Namen „Apostel“ bei, um den Zuhörer aufmerksam zu machen, daß seine Worte nicht Menschenwerk seien. Denn der Abgesandte (ἀπόστολος) spricht nicht in seinem eigenen Namen, und wenn er das Wort „Abgesandter“ ausspricht, so lenkt er sofort die Gedanken des Zuhörers auf den Absender. Deßhalb schickt er allen seinen Briefen Das voran; er macht seine Rede glaubwürdig und sagt: „Paulus, der Apostel Jesu Christi, im Auftrage Gottes, unseres Heilandes.“ Und nirgends erscheint der Vater als der Auftraggeber, sondern es ist Christus, der mit ihm spricht. Was sagt er denn? „Gehe hin, weil ich dich weit fort zu den Heiden senden werde;“15 und wiederum: „Stelle dich dem Kaiser!“16 Aber was der Sohn aufträgt, Das bezeichnet er zugleich auch als Aufträge des Vaters, sowie die des hl. Geistes auch vom Sohne ausgehen. Denn man sehe! Der Apostel wurde ausgeschickt vom hl. Geiste, er wurde abgesondert vom hl. Geiste, und er sagt, es sei da ein Auftrag Gottes (des Vaters). Wie nun? Beeinträchtigt es die Kompetenz des Sohnes, daß sein Apostel im Auftrage des Vaters geschickt worden ist? Keineswegs. Man sehe nur, wie der Apostel den Auftrag zu einem gemeinsamen macht! Denn nach den Worten: „Im Auftrage Gottes, unseres Heilandes,“ fährt er fort: „Und unseres Herrn Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist.“ Man beachte, mit welcher Prägnanz er die Bezeichnung gewählt hat! Der Psalmist sagt Das vom Vater mit den Worten: „Die Hoffnung aller Grenzen der Erde (ist er).“17 Und wiederum der hl. Paulus sagt an einer andern Stelle seiner Briefe: „Deßhalb leiden wir Mühsal und Schimpf, weil wir hoffen auf den lebendigen und wahren Gott.“ Ein Lehrer muß auf Gefahren gefaßt sein und zwar auf viel mehr als die Schüler. „Ich werde den Hirten schlagen,“ heißt es, „und die Schafe werden zerstreut werden.“18 Da also dem so ist, so hat es der Teufel besonders auf die Hirten abgesehen, weil mit ihrer Beseitigung auch die Heerde sich zerstreut. Tödtet er nämlich Schafe, so hat er die Heerde bloß verringert; beseitigt er aber den Hirten, so ist die ganze Heerde ruinirt. Weil er also mit geringerer Mühe Größeres ausrichtet und durch einen einzigen Menschen das Ganze verderben kann, geht er mehr den Hirten zu Leibe.
Gleich im Eingange also richtet der Apostel die Seele des Timotheus auf, indem er sagt, daß wir Gott zum Heiland und Christus zur Hoffnung haben. Vieles dulden wir, aber wir haben große Hoffnungen. Wir sind von Gefahren und Nachstellungen umgeben; aber wir haben einen Retter, nicht einen Menschen, sondern Gott. Der Retter verliert also seine Kraft nicht. Denn Gott ist’s, und wie schwer die Gefahren auch sein mögen, sie werden nicht über uns Herr werden. Auch unsere Hoffnung wird nicht zu Schanden, denn Christus ist’s. Mit Hilfe dieser beiden überstehen wir die Gefahren; sei es, daß wir rasch von denselben befreit werden, oder uns mit guten Hoffnungen nähren.
Warum sagt aber der Apostel nirgends, daß er der Abgesandte des Vaters sei, sondern der Christi? Es gilt ihm Alles als gemeinsam, und vom Evangelium selber sagt er, es sei das Gottes des Vaters.
„Dem Timotheus, dem ächten Sohn im Glauben.“ Auch das ist ein Wort des Trostes. Wenn er nämlich einen solchen Glauben bewies, daß er der Sohn des Paulus wurde, und zwar nicht bloß schlechthin ein Sohn, sondern ein „ächter“, dann wird ihm auch für die Zukunft nicht bange sein. Es ist aber eine Eigenthümlichkeit des Glaubens, auch wenn die Wirklichkeit in Widerspruch steht mit den Verheissungen, nicht zu fallen und nicht in Unruhe zu gerathen.
Seltsam indeß! Ein „Sohn“ heißt er, und ein „ächter Sohn“, und er ist es doch keinesfalls in physischem Sinne. Wie nun? Ist Das sinnlos? Er war nicht aus Paulus entsprossen, meinst du. Es kann also dieser Ausdruck keine physische Abstammung bezeichnen. Wie also? War er anderweitiger Herkunft? Auch Das nicht. Nämlich nach dem Worte „Sohn“, fügt der Apostel bei: „im Glauben“, deßhalb, um zu zeigen, daß er ein ächter Sohn war und von ihm abstammte. Er war nicht aus der Art geschlagen, im Glauben hatte er das Merkmal der Ähnlichkeit, wie es auch in menschlichen Verhältnissen mit der physischen Ähnlichkeit der Fall ist. Der Sohn ist dem Vater ähnlich, doch nicht in dem Grade wie in göttlichen Dingen hier ist die Ähnlichkeit frappanter. Dort nämlich sind Vater und Sohn, wenn auch physisch verwandt, doch in vielen anderen Dingen von einander verschieden. Im Teint, in der Haltung, in der geistigen Begabung, im Alter, in den Neigungen, in psychischen und körperlichen Eigenschaften, im ganzen Aussehen und in mehreren andern Beziehungen sind sie entweder von einander verschieden oder sie gleichen sich einander. Auf göttlichem Gebiete aber gibt es keine solchen Scheidewände. (Der Ausdruck „im Auftrage“ ist stärker als „berufen“, wie man auch anderwärts sehen kann.19 ) ähnlich wie „dem Timotheus, dem ächten Sohne,“ lautet auch die Anrede des Apostels an die Korinther: „In Christus Jesus habe ich euch gezeugt,“ d. h. im Glauben. Der Beisatz „ächt“ aber hat den Zweck, die genaue und bei Timotheus stärker als bei Andern vorhandene Ähnlichkeit mit dem Apostel zu zeigen. Aber nicht bloß Das, sondern die Liebe des Apostels zu ihm und den hohen Grad seiner Zuneigung. Man beachte hinwiederum das Wörtchen „in“ (ἐν) bei „Glauben“! Dem „ächten Sohn im Glauben“ heißt es. Und welches Lob ist es, wenn er ihn nicht bloß einen „Sohn“, sondern auch einen „ächten Sohn“ nennt!
II.
„Gnade, Erbarmen und Friede von Gott, unserem Vater, und Jesus Christus, unserem Herrn.“ Warum setzt der Apostel sonst nirgends an die Spitze seiner Briefe den Ausdruck „Erbarmen“, wohl aber hier? Auch Das ist ein Ausfluß seiner zärtlichen Liebe. Für seinen Sohn erfleht er mehr, indem er für ihn zagt und zittert. Er war ja so besorgt für ihn, daß er, was er sonst nirgends gethan, ihm sogar für seine leibliche Gesundheit Vorschriften gab, indem er sagt: „Trinke etwas Wein wegen deines Magens und deiner häufigen Schwächen!“ Eine größere Fülle göttlichen Erbarmens bedürfen ja die Lehrer.
„Von Gott, unserm Vater, und Jesus Christus, unserm Herrn.“ Ein neuer Trost. Wenn Gott ein Vater ist, so kümmert er sich um uns wie um Kinder. Höre, was Christus sagt: „Welcher Mensch ist unter euch, der, wenn ihn sein Sohn um Brod bittet, ihm einen Stein geben wird?“20
3. Wie ich dir zuredete, in Ephesus zurückzubleiben, als ich nach Macedonien abreiste.
Man merke auf den milden Ausdruck, wie der Apostel nicht im Tone eines Lehrmeisters spricht, sondern in einem fast familiären! Er sagt nicht: „Ich trug dir auf“ oder: „Ich befahl dir“ oder: „Ich forderte dich auf“, sondern wie? „Ich redete dir zu“ (παρεκάλεσά σε). Nicht gegen alle Schüler dürfen wir einen solchen Ton anschlagen, sondern gegen die braven und tugendhaften. Gegen die andern, die verderbten und nicht ächten, spricht man in anderem Tone, wie auch der Apostel selbst anderwärts in einem Briefe sagt: „Tadle sie mit allem Nachdruck!“ Auch an dieser Stelle höre, was er sagt: „Damit du gewissen Leuten befehlest,“ — nicht damit du „zuredest“, sondern damit du „befehlest,“ — „nicht Anderes zu lehren.“
Wie ist Das zu verstehen? Genügte denn der Brief des Paulus nicht, den er ihnen sandte? Er genügte wohl. Allein gegen das geschriebene Wort verhalten sich die Menschen weniger respektvoll. So kann man Das erklären oder auch damit, daß dieser Auftrag in die Zeit vor dem Briefe fällt. Der Apostel hat ja selbst lange Zeit in dieser Stadt gelebt, und hier war der Tempel der Artemis, hier hat er jene Drangsale erduldet. Als nämlich die dortige Schaubühne abgebrochen war, berief und tröstete er die Schüler, segelte ab und kehrte wieder zu ihnen zurück. Es ist übrigens der Mühe werth, zu untersuchen, ob er jetzt dem Timotheus einen ständigen Sitz dort angewiesen hat. Er sagt: „Damit du gewissen Leuten befehlest, nicht anders zu lehren.“ Er nennt sie nicht mit Namen, damit er sie durch öffentlichen Tadel nicht noch frecher mache. Es waren daselbst falsche Apostel aus jüdischen Kreisen, welche die Gläubigen wieder zum Gesetze hinüberzuziehen wünschten, eine Beschuldigung, die der Apostel allenthalben in seinen Briefen erhebt. Sie thaten aber Dieß nicht von ihrem Gewissen, sondern vom Ehrgeiz angetrieben und von dem Wunsche, Schüler zu haben. Sie waren eifersüchtig auf den heiligen Paulus und traten als seine Rivalen auf. Das heißt „anders lehren“ (ἑτεροδιδασκαλεῖν).
4. Und nicht zu hören auf Fabeln und endlose Geschlechtsregister.
Unter „Fabeln“ versteht der Apostel nicht das Gesetz, — bewahre! — sondern die nachgemachten, durch Falschmünzerei entstandenen und unächten Glaubenslehren. Wahrscheinlich haben diese Juden sich bei ihren Vorträgen bloß mit Lappalien befaßt, mit Aufzählung von Vätern und Großvätern, damit sie sich den Ruhm großen Wissens in der Geschichte verschafften. „Damit du ihnen befehlest, nicht anders zu lehren und nicht zu hören auf Fabeln und endlose Geschlechtsregister.“ Was heißt „endlose“ Register? Das sind entweder solche, die kein Ende nehmen, oder die keinen Nutzen verschaffen, oder die schwer aufzufassen sind. Merkst du, wie der Apostel hier die Forschung anklagt? Wo nämlich der Glaube ist, da braucht es keine Forschung. Wozu eine Forschung, wo keine neugierigen Fragen am Platze sind? Die Forschung ist der Tod des Glaubens. Wer sucht, hat noch nicht gefunden; der Forscher vermag nicht zu glauben. Darum heißt es, wir sollen uns nicht mit Forschungen abmühen; denn wenn wir forschen, so ist das kein Glaube. Der Glaube macht ja dem Grübeln des Verstandes ein Ende. Warum spricht nun aber Christus: „Suchet, so werdet ihr finden! Klopfet an, so wird euch aufgethan werden! Forschet in der Schrift, weil ihr in derselben das ewige Leben zu haben glaubet!“21 Hier hat das Wort „Forschet!“ die Bedeutung des Verlangens und sehnlichen Wunsches. Und mit dem Ausdruck: „Forschet in der Schrift!“ wird die Forschungsarbeit nicht empfohlen, sondern abgelehnt. Denn es heißt: „Forschet in der Schrift!“ d. i. forschen, damit man sie genau kennen lernt und weiß. Nicht fortwährend wissenschaftliche Forschungen anstellen sollen wir, sondern mit ihnen ein Ende machen. Und trefflich heißt es: „Befiehl ihnen, nicht anders zu lehren und nicht zu hören auf Fabeln und endlose Geschlechtsregister, welche eher Streitfragen herbeiführen als die Heilsanstalt Gottes im Glauben.“ Trefflich ist der Ausdruck „Heilsanstalt Gottes“. Großes wollte uns Gott schenken, aber die Vernunft faßt die Größe seiner Heilsanstalten nicht. Also muß Das durch den Glauben geschehen, der das größte Heilmittel der Seelen ist. Die wissenschaftliche Forschung ist somit der Gegensatz zur Heilsanstalt Gottes. Was vermittelt uns denn der Glaube? Daß wir die Wohlthaten Gottes ausnehmen, daß wir besser werden, daß wir über Nichts zweifeln und schwanken, sondern ruhig sein können. Was der Glaube zuwege bringt und aufbaut, Das ruinirt die Forschung, indem sie Untersuchungen anstellt und den Glauben verscheucht. „Nicht zu hören,“ heißt es, „auf Fabeln und endlose Geschlechtsregister.“ Christus hatte gesagt, daß wir durch den Glauben selig werden. Jene forschten und sagten (damit), daß dem nicht also sei. Weil die Verheissung in die Gegenwart fiel, die Erfüllung der Verheissung aber in die Zukunft, deßhalb bedürfte es des Glaubens. Jene aber, voreingenommen für die Vorschriften des Gesetzes, waren dem Glauben hinderlich. Übrigens bin ich der Ansicht, daß auch die Heiden damit gemeint sind, wenn der Apostel von „Fabeln und Geschlechtsregistern“ spricht. Sie wußten ja ihre Götter nach einander herzuzählen.
III.
Hören wir also nicht auf Forschungen! Gläubige heissen wir deßhalb, damit wir dem Gesagten zweifellos glauben und in keiner Weise schwanken. Freilich, wenn das Gesagte Menschenworte wären, dann müßte man sie prüfen; wenn aber Gotteswort, dann hat man sich bloß zu beugen und zu glauben. Glauben wir es nicht, dann glauben wir auch nicht an die Existenz Gottes. Denn wie kannst du Etwas von der Existenz Gottes wissen, wenn du Argumente von ihm verlangst? Dieß ist der erste Beweis von der Erkenntniß Gottes, daß man an seine Worte glaubt ohne Zeugnisse und Beweise. Das wissen sogar die Heiden. Denn sie glaubten ihren Göttern, obschon dieselben für ihre Worte keine Beweise beibrachten. Warum? Weil sie dem Geschlechte der Götter angehörten. Man sieht, daß auch die Heiden Das wissen. Und was rede ich von Göttern? Sie thaten Das bei einem Menschen, einem Zauberer und Magier, bei Pythagoras meine ich: „Er selber hat’s gesagt“ (αὐτὸς ἔφα). Und auf den Tempeln war die Gestalt der Schweigsamkeit eingemeißelt; sie hielt den Finger an den Mund, und indem sie die Lippen zusammenpreßte, gebot sie allen Vorübergehenden Schweigen. Also die heidnischen Dinge waren so ehrwürdig, die unsrigen aber wären es nicht, im Gegentheile sie wären lächerlich? Die heidnische Religion unterliegt mit Recht der Forschung, — dahin ge hören die wissenschaftlichen Kämpfe, das Bezweifeln und die logischen Operationen, — aber die unsere steht allem Dem ferne. Jene ist eine Erfindung der Menschenweisheit, diese wurde gepredigt durch die Gnade des heiligen Geistes. Jenes sind Lehrsätze der Thorheit und des Unverstandes, Dieses Dogmen der wahren Weisheit. Dort gibt es nicht Schüler und nicht Lehrer, sondern nur Forscher; hier muß Einer, sei er Lehrer oder Schüler, lernen von dem wahren Lehrer; er muß gehorchen, nicht zweifeln; glauben, nicht Syllogismen bauen. Durch den Glauben sind die Männer der alten Zeit berühmt geworden, und ohne ihn geht Alles zu Grunde. Und was rede ich von himmlischen Dingen? Auch wenn wir die irdischen betrachten, wird man finden, daß sie auf dem Glauben beruhen. Weder ein Vertrag noch eine Kunst noch irgend etwas Anderes wird ohne ihn bestehen. Wenn es aber hienieden, hier, wo Alles Täuschung ist, des Glaubens bedarf, um wie viel mehr in himmlischen Dingen. Am Glauben also wollen wir festhalten, ihm wollen wir nachgehen! Auf diese Weise werden wir die verderblichen Lehrsätze aus unserer Seele entfernen, z. B. die fatalistische Weltanschauung.22 Glaubst du, daß es eine Auferstehung und ein Gericht gibt, dann wirst du alles Das aus deinem Herzen entfernen können. Glaube, daß Gott gerecht ist, und du wirst nicht glauben, daß es ein ungerechtes Fatum gibt! Glaube an die Vorsehung, und du wirst nicht glauben, daß das Fatum Alles beherrscht! Glaube, daß es Hölle und Himmel gibt, und du wirst nicht glauben, daß das Fatum unsere Persönlichkeit aufhebt und uns dem Zwang und der Nothwendigkeit unterwirft! Säe nicht, pflanze nicht, thue keinen Kriegsdienst, thue überhaupt Nichts mehr! Das Fatum hat ja jedenfalls seinen Lauf mit und ohne deinen Willen! Was brauchen wir weiter Gebete? Warum willst du ein Christ sein, wenn das Fatum regiert? Es gibt ja kein Gericht mehr für dich! Woher kommen die technischen Fertigkeiten? Vom Fatum? Ja, heißt es; es ist eben Dem oder Jenem vom Fatum bestimmt, daß er durch eigenes Bestreben Etwas lerne. Zeige mir aber Einen, der irgend eine Kunst gelernt hat ohne eigenes Bestreben! Du kannst es nicht. Also liegt es nicht an dem (zwingenden) Fatum, sondern an dem (freien) Bestreben. Warum, sagt man, ist Der oder Jener reich, obwohl ein Verbrecher und Schuft, indem er vom Vater das Erbe übernahm? Ein Anderer aber, der sich endlos abmüht, bleibt arm? Darauf läuft ja die ganze Argumentation immer hinaus, auf Reichthum und Armuth, nicht auf Laster und Tugend. Allein bei dieser Frage muß man nicht von solchen Dingen reden, sondern man muß zeigen, ob schon Einer, der guten Willen hat, ein schlechter Mensch, und Einer, der schlecht gesinnt ist, ein guter Mensch geworden ist. Wenn nämlich das Fatum eine Gewalt hat, dann muß es diese Gewalt an großen Dingen beweisen, an Laster und Tugend, nicht an Reichthum und Armuth. Und warum, heißt es weiter, ist Der und Der kränklich und der Andere strotzt von Gesundheit? Warum ist der Eine berühmt, der Andere verrufen? Warum geht dem Einen Alles nach Wunsch, dem Andern Alles krumm? Entsage der fatalistischen Weltanschauung, dann wirst du’s wissen! Glaube fest an Gottes Vorsehung, dann wird dir Das ganz klar sein! Ich kann es nicht, sagt man. Der Wirwarr in der Welt läßt den Gedanken an eine Vorsehung nicht aufkommen. Wenn Das Werke Gottes sind, wie kann ich denn glauben, daß Gott, der die Güte ist, einem Lüstling, einem Schuft, einem Geizigen Schätze in den Schoß wirft und dem Braven nicht? Wie soll ich Das glauben? Auf Thatsachen muß der Glaube beruhen. Ganz recht. Sind Das Werke eines gerechten oder ungerechten Fatums? Eines ungerechten, sagst du. Wer hat nun ein solches in’s Dasein gerufen? Etwa Gott? Nein, antwortet man, es ist von Ewigkeit. Und wenn es von Ewigkeit ist, wie kann es in solcher Weise wirken? Das ist ein Widerspruch! Also Gott ist ganz und gar nicht der Urheber von diesen Dingen. Gut, untersuchen wir: Wer hat den Himmel geschaffen? „Der blinde Zufall.“ Wer die Erde? wer das Meer? wer die Jahreszeiten? Also bei den leblosen Dingen hat der blinde Zufall eine so schöne Ordnung bethätigt, eine solche Harmonie, bei uns aber, derentwegen Alles da ist, solche Mißverhältnisse? Gerade als ob Einer für ein Haus Sorge trüge, daß es ganz vortrefflich sei, für die Bewohner aber nicht. Wer wacht über den Wechsel der Jahreszeiten? Wer hat die wohlgeordneten Naturgesetze gegeben? Wer hat den Lauf von Tag und Nacht vorgezeichnet? Das sind Dinge, die über jenen blinden Zufall hinausgehen. Nein, erwidert man; Das ist von selber so geworden. Wie könnte eine so schöne Ordnung von selber entstehen! Woher also, frägt man, kommen die reichen, gesunden, berühmten Leute, reich theils durch Geiz, theils durch Erbschaft, theils durch Gewaltthat? Warum hat Gott zugegeben, daß die schlechten Menschen glücklich sind? Weil es sich nicht in dieser Welt um Belohnung und Bestrafung nach Verdienst handelt, sondern erst im Jenseits. Dort zeige mir einen solchen Fall! Einstweilen will ich’s hier auf Erden haben, sagt man; was im Jenseits geschieht, darum kümmere ich mich nicht. Allein deßhalb bekommst du das irdische Gut nicht, weil du dich (gerade darum) so kümmerst. Wenn du schon ohne den Genuß desselben dich so sehr darum kümmerst, daß du es dem jenseitigen vorziehst, so wäre es noch viel ärger, wenn du in lauter Genuß schwimmen würdest. Das beweist dir also, daß irdisches Gut Nichts ist, daß es gleichgiltig ist. Denn wenn es nicht gleichgiltig wäre, so hätte Gott dasselbe auch den Andern mitgetheilt. Sage mir, ist es nicht etwas Gleichgiltiges, schwarz zu sein oder klein oder groß? So verhält es sich auch mit dem Reichthum. Sage mir, was die nothwenigen Dinge betrifft, sind sie nicht Allen gleichmäßig verliehen, z. B. die Disposition zur Tugend, die Vertheilung der Geistesgaben? Wenn du die Wohlthaten Gottes kennen würdest, dann würdest du nicht, während du an geistigen Gütern gleichen Antheil hast, wegen der materiellen dich alteriren und würdest nicht Angesichts der Gleichstellung in Bezug auf erstere nach einem Mehrbesitz bei den letzteren trachten. Es ist Das gerade, als wenn ein Knecht, welcher vom Herrn Nahrung, Kleidung und Wohnung hat und in allem Übrigen gerade so gehalten wird wie seine Mitknechte, sich den Anderen gegenüber Etwas darauf zu Gute thun würde, wenn er mehr Haare auf dem Kopf oder längere Nägel besäße. Auf dieselbe Weise bildet sich also auch der oben geschilderte Mensch umsonst Etwas auf solche Dinge ein, die er nur eine Zeit lang genießen darf. Deßhalb hat Gott uns diese Dinge versagt, damit er diesen rasenden Durst nach denselben in uns auslösche, damit er das Verlangen, das auf sie gerichtet ist, zum Himmel ablenke. Wir kommen ja nicht einmal so zur Vernunft. Gleichwie der Vater, wenn das Kind ein Spielzeug hat und sich mit demselben mehr abgibt als mit den nothwendigen Dingen, ihm das Spielzeug wegnimmt, damit er es auch wider seinen Willen zum Rechten hinlenke: so thut auch Gott Alles, um uns zum Himmel emporzulenken. Warum läßt also Gott die Schlechten reich werden? frägst du. Weil er sich um dieselben nicht mehr viel kümmert. Und warum die Gerechten? Er macht sie nicht selber reich, er gestattet bloß, daß sie es sind.
Ich habe über diesen Punkt für jetzt nur flüchtig zu euch gesprochen als zu Leuten, welche die hl. Schrift nicht kennen. Wenn ihr aber den Worten Gottes Glauben und Gehör schenken wolltet, dann würde ich darüber kein Wort zu verlieren brauchen. Aus der Schrift könnten wir Alles lernen. Und damit du lernest, daß der Reichthum Nichts ist, sowie Gesundheit und Ruhm, so weise ich dich hin auf Viele, die einen Geldgewinn machen könnten und es nicht thun, auf Viele, die gesund sein könnten und ihren Körper abmagern lassen, auf Viele, die Ruhm ärnten könnten und Alles aufwenden, um gering geachtet zu werden. Einen Menschen aber, der gut ist und schlecht werden möchte, gibt es nicht. Also hören wir auf, nach den Gütern dieser Erde zu streben und streben wir nach den himmlischen! Auf diese Weise können wir derselben auch theilhaftig werden und in die ewigen Freuden eingehen durch die Gnade und Liebe unseres Herrn Jesus Christus, mit welchem dem Vater und zugleich dem hl. Geiste sei Lob, Ruhm und Ehre jetzt und immerdar und in alle Ewigkeit. Amen.