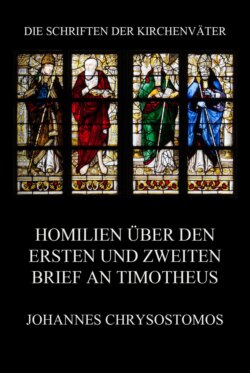Читать книгу Homilien über den ersten und zweiten Brief an Timotheus - Johannes Chrysostomos - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vierte Homilie.
ОглавлениеI.
15. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme werth, daß Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um die Sünder selig zu machen, deren erster ich bin. 16. Aber deßhalb habe ich Erbarmen gefunden, damit an mir zuerst Christus seine ganze Langmuth offenbare, zum Vorbild für Die, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben.
I. So groß sind die Wohlthaten Gottes und so sehr übersteigen sie alle menschliche Erwartung und Hoffnung, daß man oft gar nicht daran glauben will. Was der menschliche Verstand nicht begriffen und nicht erwartet hat, Das hat Gott uns verliehen. Darum sprechen die Apostel oft über diesen Punkt, daß man glauben solle an das Gute, das Gott uns gespendet. Denn wie uns Das bei einem großen Glücke begegnet, — „Ist es denn kein Traum?“ fragen wir ungläubig, — so auch bei den Gaben Gottes. Worin bestand denn also das Unglaubliche? Darin, daß Feinde und Sünder, daß Menschen, die weder durch das Gesetz noch durch gute Werke gerechtfertigt waren, plötzlich bloß auf Grund des Glaubens der höchsten Güter theilhaftig werden sollten. Über diesen wichtigen Punkt verbreitet sich Paulus im Briefe an die Römer sowie an dieser Stelle: „Glaubwürdig,“ sagt er, „ist das Wort und aller Annahme werth, daß Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um die Sünder selig zu machen, deren erster ich bin.“ Da nämlich die Juden zumeist auf diese Weise sich gewinnen ließen, so redet er ihnen zu, sich um das Gesetz nicht zu kümmern, da es nicht möglich sei durch dasselbe ohne den Glauben das Heil zu erlangen. In diesem Sinne polemisirt er hier. Es schien nämlich unglaublich zu sein, daß ein Mensch, der sein ganzes früheres Leben leichtfertig vergeudete und nutzlos mit bösen Handlungen hinbrachte, später einzig und allein durch den Glauben das Heil erlangen sollte. Deßhalb heißt es: „Glaubwürdig ist das Wort.“ Aber Einige glaubten nicht bloß nicht, sondern sie schmähten auch, wie es jetzt noch die Heiden machen, indem sie sagen: „Laßt uns Böses thun, damit Gutes daraus erfolge!“60 Da sie nämlich das Wort des Apostels vernommen: „Wo die Sünde überschwänglich war, da war die Gnade noch überschwänglicher,“61 so zogen sie unsere Lehre in’s Lächerliche durch jenen Satz. So ist’s auch, wenn wir ihnen von der Hölle sprechen. „Wie würde Das der Idee von Gott entsprechen,“ sagen sie, „da doch schon ein Mensch, der seinen Diener auf einer Menge von Vergehen ertappt hat, ihn frei läßt und ihm Verzeihung gewährt? Und Gott sollte ewige Strafen verhängen?“ Und wenn wir hinwiederum vom Taufbad mit ihnen reden und von der durch dasselbe bewirkten Nachlassung der Sünden, dann sagen sie: „Wie entspricht Das der Vorstellung von Gott, daß er einem Menschen, der zahllose Sünden begangen, dieselben nachläßt?“ Siehst du den verkehrten Sinn (dieser Leute)? Siehst du, wie überall ihre Rechthaberei zu Tage tritt? Einmal ist die Verzeihung der Sünden nicht recht, wohl aber die Strafe; das andere Mal ist die Strafe nicht recht, wohl aber die Verzeihung. So ist’s in ihrem Sinn; nach unserem Sinne ist ja Beides recht. Wie so? Das werde ich ein andermal beweisen. Für heute geht es nicht. Denn da dieser Punkt tiefer geht und einer genaueren Erörterung bedürftig ist, so muß ich ihn Euer Lieb (und Andacht) bei passender Gelegenheit einmal vortragen.62 Für heute wollen wir uns an unsern Text halten.
„Ein glaubwürdiges Wort“ heißt es. Warum „glaubwürdig“? Sowohl mit Bezug auf das Vorhergehende als auch auf das Nachfolgende. Man sehe, wie der Apostel einmal den Gedanken einleitet und dann bei demselben länger verweilt! In der Äusserung, daß Gott sich des Lästerers und Verfolgers erbarmte, liegt der vorbereitende Gedanke. Und er hat sich nicht nur erbarmt, will er sagen, sondern er hat ihm auch „Treue“ verliehen. So wenig, meint er, dürfe man sich ungläubig verhalten dagegen, daß Gott sich seiner erbarmt habe. Sieht man einen ehemaligen Gefangenen im Palast des Königs frei herumgehen, so bezweifelt Niemand, daß er begnadigt worden. Und so war es bei Paulus. An seiner eigenen Person liefert er den Beweis und schämt sich nicht, sich als Sünder zu bezeichnen, im Gegentheil, er thut es mit Freunden. Denn auf diese Weise kann er am besten das große Wunder der göttlichen Barmherzigkeit zeigen und beweisen, daß er eines so großen Erbarmens gewürdigt wurde. Und wie ist es erklärlich, daß er, der anderwärts von sich sagt: „Nach der Gerechtigkeit, die dem Gesetze entspricht, war ich tadellos,“63 an dieser Stelle sich für einen Sünder erklärt und zwar für „den ersten der Sünder“? Weil im Verhältniß zu der Gerechtigkeit, welche Gott verlieh, und die in der That verlangt wird, auch die Anhänger des Gesetzes Sünder sind. „Alle haben ja gesündigt und ermangeln des Ruhmes vor Gott.“64 Daher spricht er nicht von der Gerechtigkeit schlechthin, sondern von einer „Gerechtigkeit, die dem Gesetze entspricht“. Gleichwie Jemand, der viel Geld hat, an und für sich als reich gilt, aber im Vergleiche zu den Schätzen eines Königs so arm erscheint, wieder erste beste Arme: so ist’s auch hier. Im Vergleich zu den Engeln sind die Menschen Sünder, auch wenn sie gerecht sind. Wenn aber Paulus, welcher die im Gesetze geforderte Gerechtigkeit übte, der „erste Sünder“ war, welcher von den Andern dürfte sich dann noch einen Gerechten nennen? Indem er gegen sein früheres Leben die Anklage erhebt, bezeichnet er es ja nicht als ein sündhaftes im eigentlichen Sinne, bewahre, sondern er vergleicht nur die frühere Gerechtigkeit mit der jetzigen und zeigt, daß sie Nichts ist, ja noch mehr, er beweist, daß die Besitzer derselben Sünder sind.
„Aber darum fand ich Erbarmen, damit Christus an mir zuerst seine ganze Langmuth offenbare, zum Vorbild für Jene, welche an ihn glauben sollen, zum ewigen Leben.“
II.
Siehst du, wie der Apostel sich neuerdings demüthigt und erniedrigt, indem er eine andere, für ihn noch weniger schmeichelhafte65 Ursache (der göttlichen Erbarmung) anführt. Damit nämlich, daß er sagt, er habe wegen seiner Unwissenheit Erbarmen gefunden, stellt er den Begnadigten nicht als sonderlich großen Sünder und allzu schlimmen Verbrecher dar. In dem Gedanken aber, daß er deßhalb Erbarmen gefunden, damit für die Folge kein Sünder mehr verzweifle, sondern sich zur Hoffnung ermuthigt fühle, daß auch ihm dasselbe Erbarmen zu Theil werde, darin liegt eine überaus große, eine ganz gewaltige Demüthigung. Und obwohl der Apostel ausgerufen hatte: „Ich bin der erste der Sünder, ein Lästerer, Verfolger und Mißhandler, und ich bin nicht werth, ein Apostel zu heissen“ u. dgl., so hatte er doch etwas so Demüthigendes noch nicht ausgesprochen. Ein Beispiel wird Das klar machen. Man denke sich eine volkreiche Stadt! Sämmtliche Bürger sind schlechte Leute, der eine mehr, der andere weniger; alle sind zum Tode verurtheilt. Einer unter dieser Menge aber ist in hervorragendem Grade schuldig und strafbar, ein in jeder Beziehung verruchter Mensch. Wenn nun Jemand ankündigen würde, daß der König Alle begnadigen wolle, so wird seine Ankündigung keinen rechten Glauben finden, als bis man steht, daß dem Schlimmsten unter ihnen allen Begnadigung zu Theil wird. Wenn Das eintritt, zweifelt Niemand mehr. Und so sagt auch Paulus, Gott habe, indem er den Menschen eine Bürgschaft dafür geben wollte, daß er ihnen Alles vergeben, dazu den größten Sünder von allen herausgesucht. Wenn ich Verzeihung erlangt habe meint er, dann darf bezüglich der Andern Niemand mehr Zweifel hegen, wie man auch sonst zu sagen pflegt: „Nun, wenn Gott Dem verzeiht, wird er von den Andern Keinen mehr strafen.“ Auch deutet der Apostel damit an, daß er persönlich eine Verzeihung gar nicht verdient habe, sondern daß ihm dieselbe nur mit Rücksicht auf das Seelenheil Anderer zu Theil geworden sei. Niemand, will er sagen, zweifle jetzt mehr an seinem Heile, nachdem ich es erlangt habe. Man betrachte die Demuth dieses heiligen Mannes! Er sagt nicht bloß: „Damit er seine Langmuth an mir offenbare,“ sondern seine „ganze Langmuth“, als wollte er sagen: „Eine größere Langmuth als bei mir hat Gott bei keinem Anderen bewiesen; einen solchen Sünder findet man nicht mehr, welcher das ganze Erbarmen, die ganze Langmuth Gottes in Anspruch nehmen muß, nicht bloß einen Theil wie Menschen, die bloß theilweise sündhaft sind.
„Als Vorbild für Diejenigen, welche an ihn glauben werden zum ewigen Leben,“ d. h. als Aufforderung, als Lockmittel.
Nachdem aber der Apostel Großes verkündet hat von dem Sohne und von der großen Liebe erzählt hat, die derselbe geoffenbart, so bringt er, damit Niemand wähne, als ob der Vater dieser Liebe entrathe, auch diesem seine Huldigung und fährt fort:
17. Dem Könige des Weltalls aber, dem Unvergänglichen, dem Unsichtbaren, dem alleinigen, weisen Gotte sei Ehre und Herrlichkeit in alle Ewigkeit! Amen.
Für diese Dinge, will er sagen, preisen wir nicht bloß den Sohn, sondern auch den Vater. Wenden wir uns nun an die Häretiker! Siehe, von einem „alleinigen“ Gotte spricht der Apostel, indem er vom Vater redet! Also ist der Sohn nicht Gott? Und von einem alleinigen „Unvergänglichen“. Ist also der Sohn nicht unvergänglich? Und er selber hat nicht, was er uns im Jenseits verleihen wird (die Unsterblichkeit)? So ist es nicht, erwidert man; er ist Gott und ist unvergänglich, aber nicht in derselben Weise wie der Vater. Wie? Er ist nicht der Nämliche, er steht der Natur nach tiefer? Also auch in der Unvergänglichkeit? Was ist aber Das, ein Mehr und Weniger von Unvergänglichkeit? Die Unvergänglichkeit ist ja doch nichts Anderes als die Negation der Vergänglichkeit. Die Herrlichkeit kann ein größeres und geringeres Maaß haben, die Unvergänglichkeit hat Das nicht, sowenig wie die volle Gesundheit. Es muß ein Ding entweder überhaupt vergänglich sein oder gar nicht. Wie steht es nun: Sind wir in derselben Weise unvergänglich (wie der Vater)? Bewahre! Keineswegs! Und warum? Weil der Vater diese Eigenschaft seiner Natur nach besitzt, wir aber nur als Accidens. Ist es dann auch beim Sohne also? Keineswegs. Auch bei ihm liegt sie in der Natur. Worin liegt aber denn der Unterschied? Darin, daß der Vater diese Eigenschaft Niemand Anderem zu verdanken hat, der Sohn aber dem Vater. Auch wir gestehen Das zu. Auch wir stellen nicht in Abrede, daß der Sohn vom Vater in unsterblicher Weise erzeugt worden ist. Darum preisen wir eben den Vater, daß er den Sohn also erzeugt hat. Man sieht, daß der Vater dann am meisten gepriesen wird, wenn man Großes vom Sohne sagt. Wenn er also den Sohn als ein mächtiges, ihm gleiches, als sich selbst genügendes, in sich befriedigtes, starkes Wesen erzeugt hat, fällt dann auf den Sohn mehr Ehre als auf den Vater?
„Dem Könige des Weltalls“ wird sonst auch vom Sohne gesagt, weil auch er das Weltall geschaffen. Und so gilt es auch hier von ihm. In menschlichen Dingen sind „Bauen“ (δημιουργία) und „Schaffen“ zwei verschiedene Begriffe. Der Bauende bereitet vor, konstruirt, arbeitet; Derjenige, der den Bau „schafft“, kommandirt bloß. Weßhalb? Weil der Bauende unter dem Schaffenden steht. Bei Gott Vater und Sohn ist es durchaus nicht so. Da hat nicht der Eine kommandirt und der Andere gearbeitet. Und es fällt nur nicht ein, dem Vater die schöpferische Thätigkeit abzusprechen, wenn ich die Worte höre: „Durch den er die Welt erschaffen hat.“ Und wenn ich den Vater den „König des Weltalls“ nennen höre, dann fällt es mir nicht bei, dem Sohne die königliche Würde abzusprechen. Beiden ist Beides gemeinsam. Der Vater hat die Welt gegründet, indem er den Sohn als ihren Baumeister (δημιουργόν) erzeugte. Der Sohn bekleidet die königliche Würde als Herr der Schöpfung. Er ist ja kein Lohnarbeiter wie die unsrigen, kein Untergebener eines Andern wie diese, sondern sein Wirken entspringt der ihm innewohnenden Güte und Liebe gegen die Menschen.
Wie ist’s ferner? Hat man den Sohn je gesehen? Das dürfte Niemand behaupten können. Warum heißt es also: „Dem unvergänglichen, unsichtbaren, allein weisen Gotte“? Nun, es heißt ja auch (vom Sohne): „Es gibt keinen andern Namen, in welchem wir das Heil erlangen;“ und wiederum: „Es ist in keinem Andern das Heil.“66
„Ehre und Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.“ Ehre und Herrlichkeit wird Gott nicht durch Worte zu Theil. Wie er selber also uns nicht durch Worte zu Ehren gebracht hat, sondern durch Werke und Thaten, so sollen auch wir ihn durch Werke und Thaten ehren, zumal da die Ehre, die er uns erweist, uns sehr nahe angeht, aber die Ehre, die wir ihm erweisen, ihn keineswegs sonderlich berührt. Er braucht sie von uns nicht, wir brauchen sie von ihm.
III.
Wenn wir daher ihn ehren, so werden wir hinwiederum uns selber ehren. Sowie Derjenige, der die Augen öffnet, um das Sonnenlicht zu schauen, nur sich selber nützt, indem er die Schönheit des Gestirnes bewundern kann, der Sonne selber aber keinen Dienst erwiesen hat, — er hat sie ja nicht leuchtender gemacht, sondern sie bleibt dieselbe, — so ist’s noch vielmehr bei Gott. Wer Gott ehrt und bewundert, der thut es zu eigenem Heile und schafft sich den größten Gewinn. Wie so? Weil er der Tugend nachstrebt und auf diese Weise von Gott verherrlicht werden wird. „Die mich verherrlichen,“ heißt es, „werde ich verherrlichen.“67 Wie ist es nun aber denkbar, frägt man, daß er selber verherrlicht wird, da er doch thatsächlich von unserer Verherrlichung gar Nichts hat? Geradeso, wie wenn es von ihm heißt, daß er hungert und dürstet. Er stellt sich nämlich in Allem auf gleiche Stufe mit uns, damit er uns vielleicht auch auf solche Weise an sich ziehe; er empfindet Ehre und Kränkung, um uns vielleicht auch auf diese Weise Furcht einzuflößen. Aber auch Das wirkt bei uns nicht.
„Lasset uns also Gott verherrlichen, lasset ihn preisen an unserem Körper und Geiste!“68 Wie kann Jemand Gott am Körper ehren, frägt man, wie am Geiste? Geist ist hier so viel wie Seele, im Gegensatz zum Körper. Also wie ehrt man Gott am Körper? wie an der Seele? Am Körper ehrt ihn, wer kein Hurer ist, kein Trunkenbold, kein Schlemmer, kein eitler Geck, wer den Körper nur insoweit pflegt, als es zur Gesundheit erforderlich ist, wer kein Ehebrecher ist. Es ehrt ihn die Frau, die sich nicht mit Salben beschmiert, nicht mit Farben das Gesicht bemalt, die mit dem Gebilde aus Gottes Hand zufrieden ist und zu demselben Nichts hinzukünstelt. Sage mir, was willst du denn mit deinen Zuthaten zu dem vollendeten Schöpfungswerke Gottes? Ist dir dieß Gebilde nicht schön genug? Willst du als bessere Künstlerin an das Werk noch die letzte Feile legen? Nein, nein! Darum schminkst du dich, darum kränkst du den Bildner deines Körpers, damit du eine ganze Schaar von Liebhabern gewinnst. „Was soll ich anfangen?“ erwiderst du. „ Ich habe an diesen Sachen keine Freude, aber um meines Mannes willen muß ich es thun. Verstehe ich mich nicht dazu, so finde ich keine Liebe bei ihm.“ Gott hat dir Schönheit verliehen, damit er auch darin bewundert, nicht damit er beleidigt werde. Mache ihm keine solchen Gegengeschenke, sondern erwidere ihm mit Enthaltsamkeit und Ehrbarkeit! Schönheit hat dir Gott verliehen, um den Kampfpreis für deine Tugend zu erhöhen; denn es ist nicht Dasselbe, als viel Umworbene tugendhaft zu bleiben und es zu bleiben, ohne daß man von Jemandem eine Anfechtung erleidet. Weißt du, was die Schrift von Joseph erzählt? Daß er „blühend war und schön von Gesicht“.69 Was für einen Zweck hat Das für uns, wenn wir hören, daß Joseph schön war? Daß wir um so mehr seine Schönheit und Tugend bewundern. Gott hat dir Schönheit verliehen? Warum machst du dich also häßlich? Wie wenn nämlich Jemand eine goldene Bildsäule mit Koth überschmierte, so ist’s bei den Weibern, welche Schminke anwenden. Erdenkoth ist’s, was du dir auflegst, rothes und weisses. Aber die häßlichen Weiber, meint man, haben doch Grund, Das zu thun. Sag’ mir, warum denn? Damit sie ihre Häßlichkeit verbergen? Vergebliches Bemühen! Wann wird jemals die Natur von der Kunst und Pflege übertroffen? Und warum verursacht die Häßlichkeit solches Leid, da sie keine Schande ist? Höre, was ein Weiser spricht: „Tadle keinen Mann ob seines Gesichtes und lobe keinen Mann ob seiner Schönheit!“70 Bewundere vielmehr Gott, den besten Künstler, nicht den schönen Mann; des letzteren Werk ist ja die Schönheit nicht. Sprich, was bringt die Schönheit für einen Gewinn? Gar keinen, im Gegentheil mehr Kämpfe, größere Versuchungen, Gefahren und mehr Argwohn. Eine Frau, die nicht schön ist, wird Niemandem verdächtig; eine schöne aber, falls sie nicht ganz ausserordentliche Tugend zur Schau trägt, kommt gleich in schlechten Ruf, und der Mann faßt Argwohn gegen sie, das Schlimmste, was es geben kann. Sein Vergnügen an der Schönheit der Frau ist geringer als der Schmerz, den ihm dieser Argwohn bereitet. Denn die Schönheit des Körpers verliert durch die Gewohnheit ihren Reiz, während ihre Seele dem schlimmen Ruf der Lüsternheit, des Leichtsinns und der Üppigkeit verfällt, gemein wird und thörichter Gedanken voll ist. Zu all diesen Dingen verleitet gern die Schönheit des Leibes. Das unschöne Weib finden wir nicht von solchen Fallstricken umgeben. Da gibt es keine Hunde, die sie anfallen, sondern wie ein Lämmchen weidet sie in Ruhe und Sicherheit, und kein Wolf springt herzu und belästigt es; der Hirte sitzt ja neben ihm. Es liegt kein Vorzug darin, daß die Eine schön ist, während die Andere es nicht ist. Der Vorzug liegt darin, daß die Eine, obwohl nicht schön, ehrbar ist, die Andere aber schlecht. Sage mir, worin liegt der Werth der Augen? In der leichten Beweglichkeit, in der schönen Rundung, in der blauen Farbe, oder in der Schärfe und Klarheit? Ich behaupte das Letztere und beweise es aus einem Beispiel. Was macht den Werth einer Lampe aus? Daß sie hell strahlt und das ganze Haus erleuchtet, oder daß sie schön rund gearbeitet ist? Das Erstere, wird Jedermann zugeben. Das Letztere ist gleichgiltig; was man will, ist die Beleuchtung. Deßhalb sagen wir auch zu dem Dienstmädchen, welches sie zu besorgen hat, stets: „Du hast die Lampe schlecht hergerichtet.“ So ist das Leuchten der Zweck der Lampe. So ist es also auch mit dem Auge. Sei es so oder so gestaltet, Das macht Nichts, wenn es nur seinen Zweck vollkommen genügend erfüllt. Und so nennt man es ebenfalls „schlecht“, wenn es schwach steht und keine vollkommene Beschaffenheit besitzt. Wir sagen ja von Denen, die mit offenen Augen nicht sehen, daß sie „schlechte“ Augen haben. Alles nämlich, was seinen Zweck nicht erfüllt, nennen wir „schlecht“.71 Und darin besteht die Schlechtigkeit der Augen (nicht in ihrer Gestalt oder Farbe). Dann die Nase! Sage mir, worin liegt ihr Werth? in ihrer geraden Richtung, in ihrer Glätte und Symmetrie oder in ihrer Fähigkeit zum Riechen und in ihrer Kraft, den Geruch schnell aufzufangen und dem Gehirne zuzuführen? Im Letzteren offenbar. Erläutern wir aber die Sache durch ein Beispiel von Instrumenten, die zum Anfassen bestimmt sind! Welche erklären wir für gut konstruirt? diejenigen, die Etwas scharf fassen und festhalten, oder die hübsch gearbeitet sind? Die ersteren, Das ist klar. Ferner die Zähne! Was nennen wir gute Zähne? Die schneidigen, welche die Nahrung gut zerkauen, oder die hübsch aussehenden? Offenbar die ersteren. Und wenn wir die Glieder des ganzen Körpers auf diese Weise untersuchen, so werden wir sie gesund und schön finden, solange jedes den betreffenden Zweck genau erfüllt. Und in diesem Sinne nennen wir ein jedes Geräthe schön, jedes Thier, jedes Gewächs schön; wir sehen nicht auf Gestalt, nicht auf Farbe, sondern auf den Dienst, den es leistet. So nennen wir auch denjenigen Diener „schön“ (καλόν), der zu unserer Bedienung tauglich ist, nicht den schmucken Faullenzer.
Siehst du also, worin die weibliche Schönheit liegt? Wenn wir die größten und wunderbarsten Dinge in derselben Weise wie Andere genießen, so haben wir Nichts voraus. Zum Beispiel: das Weltall, die Sonne, den Mond, die Sterne sehen wir alle, die Luft athmen wir alle, Wasser und Nahrung genießen wir alle in gleicher Weise, ob wir uns einer schönen Gestalt erfreuen oder nicht. Und wenn ich eine überraschende Behauptung aussprechen soll: die häßlichen Weiber sind gesünder als die schönen. Die schönen nämlich unterziehen sich, um ihre Reize zu bewahren, keinen schweren Arbeiten, vegetiren in der Zimmerluft, und dadurch wird die Kraft der Glieder abgestumpft; die häßlichen aber, die sich um Reize nicht zu kümmern haben, widmen sich voll und ganz der Arbeit.
Laßt uns also Gott verherrlichen! Lasset uns ihn preisen an unserem Körper! Verschmähen wir die Schönheitsmittel! Es sind überflüssige und sinnlose Dinge. Erziehen wir die Männer nicht dazu, bloß auf das schöne Gesicht zu schauen! Wenn du dich in dieser Weise schmückst, dann er durch dich, an ein geschmücktes Gesicht gewöhnt, alsbald eine Beute der Hetäre werden. Wenn du ihn aber dahin abrichtest, daß er Sittsamkeit und Tugend (am Weibe) liebt, dann wird er nicht leicht sich mit einer Hure zu schaffen machen. Denn so Etwas findet er bei einer solchen nicht, sondern das Gegentheil davon. Also richte ihn nicht darauf ab, daß er sich von einem Lächeln und von ausgelassenen Geberden fesseln läßt, damit du dir nicht selber Gift bereitest. Erziehe ihn zum Wohlgefallen an der Ehrbarkeit. Und du wirst Das können, wenn du auch dein Äusseres entsprechend einrichtest. Siehst du leichtfertig72 und locker aus, wie kannst du (zum Mann) ein ernstes Wort sprechen? Wer wird dich nicht verspotten und auslachen? Wie ist es also möglich, Gott am Körper zu preisen? Durch Übung der Tugend, durch Schmückung der Seele; diese zu schminken, Das ist nicht verwehrt. So verherrlichen wir Gott, wenn wir in jeder Hinsicht gut sind. Und auch wir werden an jenem Tage verherrlicht, nicht nach Verdienst, sondern in viel höherem Grade. „Ich erachte,“ heißt es ja, „daß die Leiden dieser Zeit nicht zu vergleichen sind mit der zukünftigen Herrlichkeit, welche an uns wird offenbar werden.“73 Mögen wir alle derselben theilhaftig werden durch die Gnade und Barmherzigkeit unsers Herrn Jesus Christus, mit welchem dem Vater und dem hl. Geiste sei Herrlichkeit, Macht und Ehre jetzt und allezeit und in alle Ewigkeit. Amen.