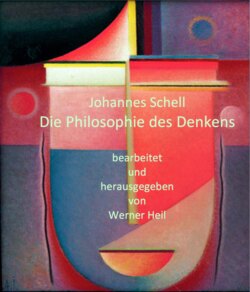Читать книгу Die Philosophie des Denkens - Johannes Schell - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
B. KRISTALLISATIONSPUNKTE DES NAIVEN BEWUSSTSEINS
Оглавление5. Die konkrete Ausgangslage
Um nun wieder auf das Problem des „Anfangs“ zurückzukommen, müssen wir feststellen, dass wir so etwas wie einen Anfang brauchen, obwohl wir wissen, dass es gar keinen gibt, wenigstens nicht in Gestalt überholter „Urprinzipien“, aus denen wir die Weltzusammenhänge deduzieren können. Was sollen wir also tun? Es scheint nichts anderes übrigzubleiben, als das erkenntnistheoretische Problem als unlösbar zu betrachten und auf einen wohlbegründeten philosophischen Ansatz zu verzichten. Oder wir beschreiten willkürliche Wege, die mehr oder weniger zufällig einige brauchbare Anhaltspunkte zutage fördern. Wir können ja von der allgemeinen Alltagserfahrung ausgehen, dass wir ununterbrochen erkennend tätig sind, und können gerade diese Situation, in der wir uns schon immer befinden, einmal probeweise beobachten, um festzustellen, was sich so alles in uns tut. Naiver geht es nicht. Und das geschieht mit Absicht. Wundern Sie sich also nicht, wenn wir nur mit der einfachsten Umgangssprache arbeiten, also keine wissenschaftlichen Begriffe anwenden und schon gar nicht definieren, um den fragwürdigen Schein von Exaktheit zu erwecken. Da es fraglos unsere Natur ist, alles zu betrachten und, wenn auch unbewusst, zu bedenken, was uns begegnet, ist es ebenso natürlich, dass wir einmal, wiederum mehr oder weniger zufällig, auch das unter die Lupe nehmen, was wir so tun, wenn wir unsere alltäglichen Erkenntnisse produzieren. Dabei dürfen wir keine präjudizierenden Begriffsgebilde voraussetzen - außer das begriffliche Element selbst, ohne das wir nichts sagen können. Hören wir dazu die Worte Rudolf Steiners, die das 2. Kapitel seiner „Philosophie der Freiheit“ abschließen und die vorspielhafte Anwendung des naiven Bewusstseins charakterisieren sollen:
„Ich habe deshalb auch keinen Wert darauf gelegt, die einzelnen Ausdrücke, wie «Ich», «Geist», «Welt», «Natur» und so weiter in der präzisen Weise zu gebrauchen, wie es in der Psychologie und Philosophie üblich ist. Das alltägliche Bewusstsein kennt die scharfen Unterschiede der Wissenschaft nicht, und um eine Aufnahme des alltäglichen Tatbestandes handelte es sich bisher bloß. Nicht wie die Wissenschaft bisher das Bewusstsein interpretiert hat, geht mich an, sondern wie sich dasselbe stündlich darlebt.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. 15. Auflage Dornach 1987, S. 34f .)
Das ist tatsächlich der zunächst wenig sagende Ausgangspunkt, nichts weiter als ein Erfassen der eigenen Situation, in die wir immer verwickelt sind, seit wir denken. Ob es uns passt oder nicht: wir müssen jedes Mal Begriffe bilden und aneinanderreihen, wenn uns etwas begegnet, das wir noch nicht begreifen können. Dabei bleiben wir ganz in uns selbst, so wie wir gerade sind, und probieren aus, was in uns geschieht, zumeist ganz naiv, so unmethodisch wie nur möglich. Und wenn wir der Versuchung erliegen sollten, in begriffliche Fernen zu schweifen, dann geschieht auch das mit unbekümmerter Simplizität, die das Denken wie ein Spielzeug verwendet. Dieser Normalzustand ist die konkrete Situation, mit der wir zunächst einmal so oder so fertig werden müssen: sie ist der vorgegebene Ansatzpunkt, um den wir nicht herumkommen und der bereits, ohne dass wir es wissen, theoretisch belastet ist. Hierzu gibt Rudolf Steiner ein treffendes Beispiel. Er schreibt:
„Wir können uns nicht mit einem Sprunge an den Anfang der Welt versetzen, um da unsere Betrachtung anzufangen, sondern wir müssen von dem gegenwärtigen Augenblick ausgehen und sehen, ob wir vom Späteren zu dem Früheren aufsteigen können. So lange die Geologie von erdichteten Revolutionen gesprochen hat, um den gegenwärtigen Zustand der Erde zu erklären, so lange tappte sie in der Finsternis. Erst als sie ihren Anfang damit machte, zu untersuchen, welche Vorgänge gegenwärtig noch auf der Erde sich abspielen, und von diesen zurückschloss auf das Vergangene, hatte sie einen sicheren Boden gewonnen. So lange die Philosophie alle möglichen Prinzipien annehmen wird, wie Atom, Bewegung, Materie, Wille, Unbewusstes, wird sie in der Luft schweben“. (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. 15. Auflage Dornach 1987, S. 53)
Natürlich wird man fragen, auf welchem Boden sich denn diese „gegenwärtigen“ Prozesse abspielen. Auf dem Boden des Bewusstseins? Oder womöglich im „objektiven“ Gefäß der Sprache? Aber woher wissen wir überhaupt, dass es eine Sprache gibt? Doch wohl nur daher, dass wir uns ihrer wie aller anderen Erfahrungen bewusst werden müssen, bevor wir von ihr reden können. Wir müssen sie als Objekt erfasst haben, wenn sie „gegenwärtig“ sein soll. Darüber werden wir später Untersuchungen anstellen müssen. Jetzt haben wir nicht die geringste Veranlassung, von der Beobachtung des naiven Bewusstseins abzugehen. Die Philosophie der Sprache setzt bereits Erkenntnisse voraus, über die wir gegenwärtig noch gar nicht verfügen können.
6. Das naive Bewusstsein.
Wie einfach wäre es für den Menschen, wenn sich die Dingwelt, die uns umgibt, ganz von selbst offenbaren würde, wenn auch nicht gerade mit Hilfe der berühmtem angehefteten „Schildchen“, die uns verraten, was wir vor uns haben - wie das in Museen üblich ist. Aber auch das würde uns nichts nützen. Wir erhielten ein sinnloses Wörterbuch, mit dem wir nichts anfangen könnten. Die tatsächliche „Selbstoffenbarung“ der Dinge geschieht nicht ohne aktive Mithilfe des Menschen. Anstatt Marionetten einer Offenbarung zu sein, werden wir Schöpfer von Begriffen und Begriffsrelationen, ohne zu wissen, wie das vor sich geht. Wir bekommen hier sehr schnell das Gefühl einer rätselhaften Selbstbefangenheit und geben uns leicht der Täuschung hin, dass diese Denk- und Erfahrungsprozesse rein innere, bloß „subjektive“ Vorgänge sind, die mit der „Außenwelt“ nur sehr schwer in Verbindung gebracht werden können. Aus dieser wenig gründlichen Betrachtungsweise entsteht der Schein von zwei einander entgegengesetzten Sphären, sozusagen eine Verdoppelung des Seins, ein undurchschautes „dualistisches“ Prinzip, das der konventionellen Philosophie das Leben schwer gemacht hat. Dabei gibt die Beobachtung des naiven Bewusstseins überhaupt keinen Hinweis auf diese Annahme, die lediglich eine vorschnelle Schlussfolgerung aus unfertigen Wahrnehmungen zieht. Ein einfacher Zeitgenosse, den man fragen würde, was er tut, wenn er auf diese unsere Welt blickt, würde wohl in gebotener Schlichtheit antworten: Ich sehe mir an, was auf mich zukommt- und mache mir meine Gedanken darüber. Er könnte aus seinem Welterleben überhaupt nicht auf die (für ihn absurde) Idee kommen, dass er in einem gespaltenen Weltkreis lebt, der ihn zum Narren hält. Natürlich weiß der Philosoph, dass eine solche Auffassung komplizierte Probleme verdeckt. Und dennoch könnte es sein, dass die unreflektierte Meinung unseres simplen Zeitgenossen mehr Wahrheit enthält, als die meisten Philosophen wahrhaben wollen, weil sie sich seit Jahrhunderten den Weg mit unzureichenden Beobachtungen und überstürzten Schlussfolgerungen verbaut haben. Diese Überlegung könnte sich aber auch gegen uns wenden, indem man uns vorwirft, dass wir selbst in Theorien befangen sind, die alles andere als „naiv“ sind, und zwar nach dem richtigen Wort Poppers: „Die Erfahrungswissenschaften sind Theoriensysteme“ (Karl Popper: Logik der Forschung. Tübingen 1976, S. 31) - und das gilt natürlich ebenso für den Begriff der „Beobachtung“ selbst. Aber dieser Tatbestand ist auch wieder eine Beobachtung, wie sich herausstellen wird, allerdings eine von denen, die das naive Bewusstsein noch nicht vornimmt. Wir wollen deshalb vorsichtig sein und erst einmal unsere Grundbeobachtungen weiter voranbringen, die möglicherweise zu Ansätzen führen, die das Bild von den Erfahrungswissenschaften als bloßen „Theoriensystemen“ in einigen Punkten zurechtrücken. Noch bewegen wir uns nicht im methodisch entwickelten Denken, sondern in jenem Zustand, von dem Rudolf Steiner mit Recht sagt, dass das Denken das völlig „unbeobachtete Element unseres gewöhnlichen Geisteslebens“ ist. (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. 15. Auflage Dornach 1987, S. 42) Jeder Rückbezug des Denkens auf sich selbst ist dem Alltagsbewusstsein fremd. Wir haben aber, werden Sie sagen, diesen Schritt schon vorweggenommen und können gar nicht den Anspruch erheben, im Namen des naiven Bewusstseins zu sprechen. Das ist nur scheinbar richtig, wie Ihnen der tägliche Umgang mit der „Metasprache“ beweist. Sie reden stets über irgendwelche Dinge und kommen gar nicht auf den Gedanken, dass sie diese Dinge verfälschen - oder Ihre Sprache wäre sinnlos.
Der ersten Beobachtung, dass wir das Denken im Alltagsleben übersehen und uns mit der natürlichsten Selbstverständlichkeit der Betrachtung des Objektes widmen, das wir ins Zentrum unseres Bewusstseins rücken, um gleichsam mit ihm zu verschmelzen, können wir eine zweite wichtige Beobachtung folgen lassen, die später noch von Bedeutung sein wird: ich meine das rätselhafte und dem Anschein nach unvermittelte Phänomen, dass wir die gesamte Welt immer als „Einheit“ betrachten, obwohl wir uns des Subjekt-Objekt-Gegensatzes durchaus bewusst sind. Diese Welteinheit war zu allen Zeiten Gewissheit und Sehnsucht der Menschen, in den großen Religionen und Philosophien, auch in den ersten Entwicklungsstufen der Naturwissenschaft, und es gibt wohl kein denkendes Wesen, das sie nicht unbewusst voraussetzt - selbst dann, wenn in der modernen Wissenschaft davon gesprochen wird, dass es voneinander unabhängige Welten geben könnte. Dieser neue Gedanke kann sogar einleuchten, aber er trägt die unverkennbaren Merkmale der einheitsstiftenden Vernunft des Menschen, lebt also erkenntnistheoretisch aus dem Prinzip der Einheit und muss sich damit arrangieren. Wir wollen hier aber kein „Prinzip“ aufstellen, sondern lediglich eine beobachtbare Tendenz der menschlichen Vernunft festhalten, oder, um es aktologisch zu sagen: wir greifen eine natürliche Funktionsweise des Denkens auf, ohne uns um die epistemologische Qualität zu kümmern. Wir wollen auch keine Wissenschaftstheorie vorwegnehmen und schon gar nicht in den Fehler des empiristischen Philosophen Moritz Schlick verfallen, der zwar ebenfalls in seiner „Allgemeinen Erkenntnislehre“ von dem naiven Bewusstsein ausgeht, aber unvermittelt seine Beobachtungen abbricht und sich mit einem plötzlichen Sprung in der naturwissenschaftlichen Methodologie wiederfindet, weil er sie schon als die einzig mögliche Wissenschaft vorausgesetzt hatte, ohne es wahrhaben zu wollen. Der Empiriker Schlick verleugnet die Empirie, seine Beobachtungen waren schon wissenschaftstheoretisch präjudiziert, bevor er mit ihnen begonnen hatte. Außerdem konnte er das dualistische Prinzip nicht überwinden und fiel in die alte Bewusstseinsphilosophie zurück, die das Bewusstsein als so etwas wie einen abgeschlossenen Kasten betrachtet, der das unnötige Problem aufwirft, wie der Mensch jemals mit der Außenwelt in Verbindung treten soll. Diese Fragen haben mit unserem Problem nichts zu tun.
Zu den zwei bisher beobachteten Phänomenen können wir noch ein drittes finden, das zunächst unerheblich zu sein scheint, aber sehr bald an Bedeutung gewinnen dürfte. Rudolf Steiner hat es folgendermaßen formuliert:
„Es ist zweifellos: in dem Denken halten wir das Weltgeschehen an einem Zipfel, wo wir dabei sein müssen, wenn etwas zustande kommen soll.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. 15. Auflage Dornach 1987, S. 49).
Wenn wir uns Rechenschaft ablegen, wo wir innerhalb des Weltgeschehens unmittelbar „dabei“ sind, dann müssen wir den Offenbarungseid leisten: alle äußeren Naturprozesse verlaufen ohne unser Zutun, aber auch die inneren Vorgänge unseres Körpers (Blutkreislauf, Herzschlag, Verdauung, Gehirnprozesse usw.) vollziehen sich im Dunkel des Unbewussten, nach ihren eigenen Gesetzen, d.h. jederzeit fremdbestimmt und prinzipiell dem menschlichen Zugriff entzogen. Sie sind immer existent, ob wir wollen oder nicht. Nur einen einzigen Vorgang gibt es, bei dem wir ständig dabei sind, weil wir ihn selbst in Gang setzen müssen, wenn es ihn geben soll: das ist die Denktätigkeit des Menschen. Das ist auch dann richtig, wenn wir aus Gewohnheit schon automatisch denken. Nirgends in der Welt existieren Begriffe, es sei den, wir bringen sie hervor und stellen sie uns gegenüber. Das ist ja einer der wesentlichen Gründe dafür, dass wir das Denken so leicht unterschätzen und manchmal bereit sind, es als eine Fata Morgana zu betrachten und vollständig zu entobjektivieren. So geistert es durch manche Wissenschaften und Philosophien als ein bloß „Subjektives“ (was immer das sei) und als rein „Selbstproduziertes“, das durch eine solche Entstehungsweise notwendig suspekt ist. Es gibt sogar Positivisten, die bereit sind, die Existenz des Denkens zu leugnen und an seine Stelle die Sprache zu setzen, von deren objektiver Realität sich jeder Mensch überzeugen kann. Dagegen werden wir gute Gründe auffahren. Aber zunächst bleiben wir bei unseren simplen Beobachtungen. Es ist auf jeden Fall richtig, dass wir auf Eigenschöpfungen stoßen, wenn wir Begriffe bilden, und es stimmt auch, dass uns Welt- und Naturprozesse ohne unser Zutun gegenübertreten. Aber wir haben hier noch kein Recht, schon theoretische Bestimmungen vorzunehmen und voreilig von „subjektiven“ und „objektiven“ Prozessen zu sprechen. Wir teilen mit, was wir vorfinden, und stellen fest, dass Begriffe in uns entstehen, die auf irgendeine Weise mit jener Sphäre verbunden sind, die wir nicht hervorgebracht haben. Es besteht noch kein Grund, über diese Beobachtung hinauszugehen. Sie kann nur in der Feststellung münden, die Rudolf Steiner einmal so ausgesprochen hat:
„Und in der Überbrückung dieses Gegensatzes besteht im letzten Grunde das ganze geistige Streben der Menschheit“... Erst „wenn wir den Weltinhalt zu unserem Gedankeninhalt gemacht haben, erst dann finden wir den Zusammenhang wieder, aus dem wir uns selbst gelöst haben.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. 15. Auflage Dornach 1987, S. 28)
Ich zitiere jetzt schon diese etwas weiterführende Stelle, um die Bedeutung unserer Beobachtung abzuschließen. Bringen wir die beiden genannten Pole ins Spiel miteinander, dann entsteht der von Rudolf Steiner angegebene Zusammenhang unmittelbar aus der Sache selbst, wenn man das menschliche Erkenntnisbedürfnis als beobachtbaren Tatbestand miteinbaut. Wenn wir den Begriffspol weiter im Auge behalten, stoßen wir auf ein viertes Phänomen, das uns deutlich gegenübertritt, ohne dass wir jetzt schon in der Lage wären, Genaueres darüber zu sagen. Mit der Herstellung begrifflicher Relationen tauchen wir in ein Element ein, in dem wir uns gleichsam zu Hause fühlen: es erzeugt tiefe, gemeinhin unreflektierte Befriedigung, die ihre Wurzeln in einem „Evidenzerlebnis“ hat, das außer einem Philosophen niemand bezweifeln kann, mit anderen Worten: wir beruhigen uns im Element der Wahrheit, wenn wir das Glück haben, dass sie plötzlich erscheint, selbst dann, wenn wir irren, ohne es zu wissen. Nur hier erfahren wir mit absoluter Unmittelbarkeit, was im genauen Sinne des Wortes die so oft berufene „Selbstverständlichkeit“ überhaupt ist. Wir erleben sie logisch und psychisch, als Klarheit und Sicherheit, als existentielle Heimat, mit der wir uns verwachsen fühlen. Und wer den Wahrheitsbegriff als eine chimärische Täuschung ablehnt, gibt sich alle Mühe, ihn mit Hilfe logischer Argumentationen als persönliche Überzeugung wieder in sein Bewusstsein hereinzuholen und die gewollte innere „Befriedigung“ wiederherzustellen. Und wer sogar die gewöhnliche Logik noch als Subjektivum denunziert, tut das Gleiche auf eine etwas kompliziertere Weise, falls er seine Sicherheit behalten will. Sie werden gemerkt haben, dass wir hier bereits auf das früher so genannte „Junktim“ stoßen, und zwar ganz empirisch, aber ohne die Absicht, es jetzt schon untersuchen zu wollen. In unserer vierten Beobachtung begegnen wir einem Fixpunkt des Denkens, der durch keine geistige Operation zu beseitigen ist.
All das besagt natürlich nicht, dass wir irgend etwas darüber ausmachen könnten, was „Wahrheit“ ist. Die berühmte Pilatusfrage bleibt unbeantwortet, und Sie dürfen sich keine Hoffnung machen, dass ich in der Lage wäre, eine Antwort zu geben, wie sie gewöhnlich gewünscht wird. Aber wir werden über die „Wahrheit“ einiges zu sagen haben, das über den Zweifel ein wenig hinausführt und das Vertrauen in das Denken wieder herstellen dürfte.
Zur Verdeutlichung dieses Problems wollen wir den bekannten Gegenpol zur Wahrheit noch einmal abtasten: ich meine unsere Erfahrungen mit den „Dingen“ der Innen- und Außenwelt des Menschen, die in völlig rätselhafter Gestalt an uns herantreten und so gar nichts Evidentielles an sich haben, wenn wir keine Begriffe produzieren, um sie, wie man sagt, zu begreifen. Es spielt dabei keine Rolle, ob es sich dabei um seelische Vorgänge oder „bewusstseinstranszendente“ Phänomene der Außenwelt handelt. Wir können jetzt schon sagen, dass Brentano im Irrtum war, wenn er glaubte, dass Innenwahrnehmungen evident seien. Sie sind nicht einmal unmittelbar, sondern mit Begriffen durchsetzt, wenn sie uns überhaupt ins Bewusstsein treten sollen.
Demselben Fehler ist Schopenhauer erlegen, wenn er den „Willen“ als essentiellen Weltgrund hypostasiert, ohne die konstituierende Aufgabe der Begriffe zu berücksichtigen. Ich wiederhole noch einmal die beiden Elemente, die sich zunächst anbieten, wenn wir die ersten Beobachtungen machen: wir nehmen zwei voneinander unterscheidbare Sphären wahr: (1) das Reich der Begriffe, das dann, aber auch nur dann vorhanden ist, wenn wir es selbsttätig hervorbringen, und (2) die immer vorgegebenen „Dinge“ der Innen- und Außenwelt, an deren Zustandekommen wir nicht den geringsten Anteil haben. Und wir stellen fest, dass beide Sphären in dauernder Wechselwirkung stehen. In der ersten Wahrnehmungsweise vermittelt das eigene Tun das schon erwähnte Gefühl der geistigen „Befriedigung“, ein sog. „Wahrheitserlebnis“, dem wir unsere Sicherheit verdanken, in der zweiten Wahrnehmungsweise entsteht das Erlebnis eines absolut Anderen und damit die Rätselhaftigkeit des vorgegebenen Weltinhalts, das platonische „Staunen“, das erst in begrifflichen Relationen seine Aufhebung findet. Mehr lässt sich hier noch nicht sagen, oder man bemüht wieder die Relikte der überholten „Bewusstseinsphilosophie“, die mit voreilig produzierten Begriffen wie „Vorstellung“, „Evidenz“, „Bewusstsein überhaupt“ u.a. gearbeitet hatte. Wir stehen - und mehr gibt unsere Beobachtung noch nicht her - zwei Phänomenen gegenüber, die wir der Genauigkeit halber so bezeichnen wollen: Befriedigendes Selbstgetanes und Unbefriedigendes Nichtselbstgetanes. Erlauben Sie mir eine solche unschöne Formulierung. Sie hat die Aufgabe, einen Zusammenhang zu fixieren, der den Charakter einer notwendigen Korrelation haben könnte, die auf einen gemeinsamen Hintergrund hinweist. Rudolf Steiner hat zum ersten Mal in diese Richtung gedacht. Unser Problem ist nicht leicht zu erfassen. Es sei nur noch vermerkt, dass es völlig verfehlt wäre, bereits Begriffe wie „Subjekt“ oder „Objekt“ hier anwenden zu wollen.
7. Der Inhalt unseres Bewusstseins
Mit den genannten vier Beobachtungen, die jeder macht, der behutsam vorgeht, haben wir Fixpunkte entdeckt, die sich wie Inseln inmitten eines Meeres ausnehmen, die ein Seefahrer mehr oder minder zufällig findet und die er vorsichtig und versuchsweise anlaufen möchte. Doch dieser Vergleich bedarf der Erweiterung. Wir müssen voraussetzen, dass dieser Seefahrer seine Entdeckungsreise mit überlieferten kartographischen Skizzen begonnen hatte, d.h. so etwas wie eine „Vorinterpretation“ seiner Wege in Händen hielt, aber mit dem Gefühl des Misstrauens und mit der bewussten Absicht, eine gründliche Überprüfung vorzunehmen. Er benützt also nicht die Daten der Karte als absoluten Wegweiser, sondern nur als problematische Anhaltspunkte, d.h. er bedient sich einer im Laufe des Lebens erworbenen Fähigkeit, die es ihm erlaubt, mit seinem Kartenmaterial umzugehen, wie er es für angemessen hält - oder in philosophischer Sprache: er setzt nicht fertige Begriffe voraus, und seien sie noch so geheiligt, er wendet sich an die Quelle aller Begriffe, nämlich an die Denktätigkeit selbst, um notfalls Korrekturen vorzunehmen oder neue Begriffe zu bilden, wenn es die Sache verlangt. Dabei kann es ihm passieren, dass er mehrfach von vorne anfangen muss, ohne einen anderen Rückhalt als eben diese Fähigkeit selbst. Dieser Vorgang rückt das Denken in ein anderes Licht als bisher. Was nur psychologisch von Bedeutung schien, erlangt eine epistemologische Qualität, die uns noch zu schaffen machen wird. Wir müssen uns von dem ererbten Trauma lösen, dass unser Denken nur aus Begriffen besteht, die man lediglich zu analysieren braucht, um eine Philosophie zu begründen. Aber Begriffskritik und -analyse reichen nicht aus. Was wir untersuchen müssen, ist das Denken als begriffsproduzierende Tätigkeit, die immer dem einzelnen Begriff vorausgeht. Vielleicht gelingt es uns dann, auch das schwer lösbare Problem der sog. „Vorinterpretation“ besser in den Griff zu bekommen, als das unter den konventionellen Auspizien der Hegelschen Begriffsdialektik, der Sprachanalyse und der Erkenntnislogik bisher möglich gewesen ist. Das Denken ist nun einmal ebensowenig die Summe seiner Begriffe, wie eine Mutter die Summe ihrer Kinder. Und der zweite Fehler wäre (ich wiederhole es), wenn man das Denken als Tätigkeit kurzerhand in die „empirische Psychologie“ abschieben würde, also in jenen Bereich, den man erkenntnistheoretisch für irrelevant hält. Ich glaube, das Gegenteil dartun zu können.
Mit den Phänomenen, die wir bisher beobachtet haben, mit diesen „Inseln“ des Bewusstseins, die wir auch Kristallisationspunkte nennen können, sind wir auf so etwas wie festes Land gestoßen, allerdings ohne zu wissen, was uns im einzelnen erwartet. Wir besitzen einen Anfang, der wenig Anfängliches enthält. Es ist bloß eine Situation, in der wir uns befinden, die sicher vieles vorweist, aber gewiss kein Absolutum, kein kategoriales Urgestein, auf dem wir eine dauerhafte Bleibe errichten könnten. Situationen sind erfahrungsgemäß in ständigem Wandel begriffen. Uns bleibt also vorläufig die einzige Möglichkeit, im Sinne Rudolf Steiners: die „gegenwärtige“ geologische Schicht, auf der wir gerade stehen, als Ausgangsbasis zu betrachten und zu erforschen, in welchem Zusammenhang sie steht, stand und stehen wird.
Langsam wird es nun Zeit, das „naive“ Bewusstsein aufzugeben und uns an das „philosophische“ Denken heranzutasten. Obwohl die Grenzen hier fließend sind, nähern wir uns behutsam dem Extremfall des „Denkens über das Denken“, den wir dadurch vorbereiten, dass wir die Rückwendung auf unsere eigene Verfahrensweise immer gründlicher vorzunehmen gezwungen sind. Was ist nun der „Inhalt“ unseres Bewusstseins? Doch diese Frage kann schon dahingehend missverstanden werden, als wollten auch wir wieder das Bewusstsein als eine Art Kasten betrachten, in dem etwas aufbewahrt wird. Nehmen Sie diese Formulierung als bloße „facon de parler“, die nur die Aufgabe hat, Ihre Aufmerksamkeit auf die zwei einzigen konkreten Erscheinungen zu lenken, die auf irgendeine (später näher zu bestimmende) Weise die Struktur des menschlichen Bewusstseins markieren. Sie mögen sich anstellen, wie Sie wollen, was Ihnen immer und unverrückbar gegenübertritt, das sind stets die zwei selben Dinge: auf der einen Seite der Begriff, auf der andern Seite die Wahrnehmung - wobei wir hier, dem Sprachgebrauch Rudolf Steiners folgend, unter „Wahrnehmung“ das Erfahrungsobjekt, das Wahrgenommene verstehen wollen, also nicht den Akt des Wahrnehmens, auf den wir später zu sprechen kommen. Sie werden bei allen Bemühungen nie etwas anderes finden als diese beiden Elemente, wenn Sie Ihr Bewusstsein durchforschen - und sollten Sie glauben, noch anderes und Gleichrangiges entdeckt zu haben, so werden Sie bei genauer Beobachtung sehr schnell feststellen müssen, dass Ihre Ausgangspunkte immer dieselben sind: Begriff und Wahrnehmung. Das Bewusstsein hat keinen anderen „Inhalt“. Um diese beiden Phänomene dreht sich von jeher alle Philosophie und kritische Wissenschaft. Dabei neigt sich die Waagschale, je nach Bedürfnis und Interesse, einmal dem ideellen Element des Begriffes und ein andermal dem psychischen oder materiellen Element der Wahrnehmung zu, ohne dass bis heute eine verbindliche Vermittlung gefunden werden konnte. Damit tangieren wir bereits den problematischen Wahrheitsbegriff, also das Kernproblem der Philosophie überhaupt. Das gibt unserer fünften Beobachtung, die wir bisher nur beiläufig miterwähnt haben, die universelle Bedeutung.
Diese letzte und entscheidende Beobachtung erlaubt uns, den Fortgang unserer Überlegungen unmittelbar aus der Sache zu bestimmen. Was wir immer wieder erfahren, ist die Tatsache, dass Begriff und Wahrnehmung in dauernder Wechselwirkung begriffen sind. Keines von beiden kann ohne das andere existieren. Wir wollen uns aber davor hüten, diesen unvermeidlichen Prozess schon hier mit theoretischen Analysen zu befrachten, die uns sofort in ein erkenntnistheoretische Labyrinth führen müssten, aus dem uns kein logischer Ariadnefaden heraushelfen könnte. Was uns diese genannte Wechselwirkung vor Augen führt, lässt sich in einfacher Weise sagen, und ebenso einfach ist die Konsequenz, die wir daraus zu ziehen haben. Mit dem Element des Begriffs verbindet sich, wie bereits erwähnt, das sog. „Wahrheitserlebnis“, also das Deuten und Erklären, d.h. die verifizierende Tätigkeit, die wir das Denken nennen - im diametralen Gegensatz zur Wahrnehmung, die ohne das begriffliche Element gar nicht für das menschliche Bewusstsein vorhanden wäre. So ergibt sich ganz von selbst, was Rudolf Steiner folgendermaßen formuliert hat:
„Was frommt es uns, wenn wir vom Bewusstsein ausgehen und es der denkenden Betrachtung unterwerfen, wenn wir vorher über die Möglichkeit, durch denkende Betrachtung Aufschluss über die Dinge zu bekommen, nichts wissen? ... Ehe anderes begriffen werden kann, muss es das Denken werden.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. 15. Auflage Dornach 1987, S. 52f.)
Damit ist, als Schlussfolgerung aus unserer fünften Beobachtung, der weitere Weg vorgezeichnet, gleichviel ob wir ihn zu Ende gehen können oder nicht. Wir fragen allerdings nur nach den Tätigkeitsweisen des Denkens, also ohne von bereits vorproduzierten Begriffen (von fertigen „Universalien“, „Axiomen“ oder „Kategorien“) auszugehen. Wir lassen uns auch weiterhin von Beobachtungen leiten, um erst hinterher Schlüsse zu ziehen, die in der Sache begründet sind.
Nun glaube ich nicht fehlzugehen, wenn ich annehme, dass ich Sie in einem wesentlichen Punkt enttäuscht habe: Sie wären keine Freunde Rudolf Steiners, wenn Sie mit meinen Ausführungen zufrieden wären, in denen gerade das Wichtigste im Menschen, sein „Ich“, unter den Tisch gefallen ist. Ihnen wird es wohl mehr als „Begriff“ und „Wahrnehmung“ bedeuten. Aber es ergibt sich nun einmal die Tatsache, die wir noch interpretieren werden, dass unser Ich zum universellen Bereich der Wahrnehmung gehört, genau wie unsere Gefühle und Triebe und genauso wie Tiere, Blumen und Steine - so befremdlich es Ihnen scheinen mag, ein so hohes geistiges, „übersinnliches Wesen“ auf ein- und dieselbe Stufe mit „gewöhnlichen“ Gegenständen herabgewürdigt zu sehen. Wir können nicht anders verfahren. Wenn es ein Ich geben sollte, dann kann es nur wie alle anderen Wahrnehmungen mit Hilfe des Begriffs auf der Bühne des Bewusstseins auftreten und sich als Realität ausweisen. Noch sind wir nicht so weit. Zunächst bleibt das, was wir „Ich“ nennen, außer Betracht.