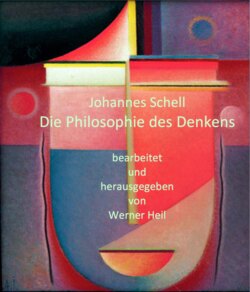Читать книгу Die Philosophie des Denkens - Johannes Schell - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
F. DER „MONISTISCHE WAHRHEITSBEGRIFF“
Оглавление17. Die Erfahrbarkeit der Welt. Der Seinsentzug
Bisher bewegten wir uns in Begriffen des reinen Denkens, in selbstständigen „Kategorien“, deren Ursprung nicht in den Tatsachen des raumzeitlichen Weltpanoramas aufzufinden sind. Alles, was wir gedacht haben, von der umgangssprachlichen Hinführung abgesehen, bezieht sich ausschließlich auf sich selbst, lebt von eigenen Gnaden - und wäre doch nicht existent, wenn es nicht die reale Welt des Seins gäbe, also die reiche Vielfalt der Dinge, Gestalten, Farben und Düfte, die wir als unsere eigentliche Welt betrachten und deshalb verstehen wollen. Aber alle Fragen, die sich auf sie beziehen, haben wir so systematisch ausgeräumt, dass es den Anschein hat, als hätten wir an die Stelle der „Realität“ rein geistige Abstraktionen setzen wollen. Wir sprachen lediglich von „spezifischen Kogitaten“, um auf raumzeitliche Zusammenhänge hinzuweisen, also von Gedankenbildungen, die der „Wirklichkeit“ entnommen und nur innerhalb ihrer gültig sind. Noch radikaler ausgedrückt: wir haben das Sein hinausgeworfen, um Platz für die Wahrheit zu bekommen - und dabei möglicherweise das eine wie das andere verkannt. Wenn ich von „Sein“ spreche, dann nur in volkstümlichem Sinne, als naive Bezeichnung dessen, was uns umgibt und hervorgebracht hat, und nicht im philosophischen Sinne berühmter Seinslehren, die mit unserer Philosophie des Denkens nur wenig zu tun haben. Trotz der bekannten Begriffe des „Soseins“ und des „Seienden“ möchte ich bei der Reduzierung auf den schlichten Begriff „Sein“ bleiben, der dem Laien unmittelbar verständlich ist. Deshalb möchte ich unsere bisherige Ausgestaltung einer speziellen „Epoche“ mit einem Begriff belegen, der als Parallele zu einem späteren Ausdruck nützlich ist: ich spreche von „Seinsentzug“ und meine damit den Versuch einer nahezu absoluten Abgrenzung der Idealität von der Realität, des Unableitbaren vom Ableitbaren, der Wahrheit von der Welt. Diese Unterscheidung hat natürlich nur methodologische Bedeutung, in Wirklichkeit besteht eine solche Trennung nicht, jedenfalls nicht in dieser radikalen Form. Welt und Wahrheit gehören auf irgendeine Weise zusammen, oder sie bilden so etwas wie eine Einheit, die wir aus Konvention zu zerlegen gewohnt sind, obwohl wir die Problematik dieses Vorgehens kennen. Wahrscheinlich ist das naive Bewusstsein daran schuld, dass wir so häufig zwei ganz verschiedene Sphären konstruieren, und zwar in ontologischem Sinne, als hätten wir zwei prinzipiell selbstständige Welten vor uns, die uns vor die Aufgabe stellen, ihr Zusammenwirken zu erforschen. Sie erinnern sich an unsere Ausführungen über die alltägliche Erfahrung, dass wir Selbstschöpfer unserer Begriffe sind und deshalb dem naheliegenden Bedürfnis verfallen, alles, was als Ideelles erscheint, entweder gläubig zu hypostasieren, weil es nicht in die raumzeitliche Welt passt, oder es aus demselben Grunde zu nominalisieren, um es loszuwerden. Wir sind immer geneigt, das „Vorgegebene“, wie wir es nannten, also das, was wir nicht selbst produziert haben, als ein Autochthones zu betrachten, von dem wir ausgehen müssen, wenn wir die Wahrheit erforschen wollen. Wir sehen das etwas anders. Uns ist bekannt, dass wir den Begriff des „Vorgegebenen“ nur in Korrelation zum Begriff des „Selbstproduzierten“ bilden können. Keiner ist für sich allein denkbar. Doch damit befasst sich das ursprüngliche Bewusstsein noch nicht: es bleibt beim naiven Subjekt-Objekt-Verhältnis stehen und muss dann auch konsequent die Frage aufwerfen, wie die beiden Sphären, die ideelle und die „materielle“, ihren qualitativen Gegensatz überwinden können, oder, in anderer Sprache: wie das Subjekt die „bewusstseinstranszendente“ Realität überhaupt erreichen kann. Aus diesen sehr alten Überlegungen stammt der seit Aristoteles meistdiskutierte Wahrheitsbegriff, der nichts definiert, sondern den Kern des Problems kaschiert. Ich meine den Adäquationsbegriff der Wahrheit, der auf die simple Feststellung hinausläuft, dass wir nur dann über Wahrheit verfügen, wenn ein Begriff mit einer Wahrnehmungstatsache zur „Deckung“ (oder „Übereinstimmung“) kommt, oder in der mittelalterlichen Formulierung: wenn die „adaequatio intellectus et rei“ vollzogen ist. Leider habe ich mir darunter nie etwas Brauchbares vorstellen können. Kein einziges Problem ist damit gelöst. Mit Hilfe einer künstlichen Klebestelle spiegelt man sich eine scheinbare Einheit vor, die nichts erklärt. Heidegger, neben vielen anderen, hat sich entschieden gegen einen solchen Wahrheitsbegriff gewandt, leider in einem Zusammenhang, der nicht weniger problematisch ist. Seine großen philosophischen Ansätze verdecken den menschlichen Erkenntnisprozess und mystifizieren die Idee der Wahrheit.
Nun zurück zum aktologischen Gedankenexperiment des „Seinsentzugs“. Wenn man diesen Versuch konsequent zu Ende führt, dann geschieht kein unerwartetes Wunder, das uns eine höhere Welt offenbart, die in Gestalt essentieller Wesen ein unabhängiges Leben vorzeigt. Damit wäre auch gar nichts gewonnen. Wir hätten uns nur eine geistige Sphäre erfahrbar gemacht, die genauso wie alle anderen Seinsweisen mit dem unableitbaren Denken begriffen werden müsste, also mit der Hilfe der Denkbeobachtung, der sich alles Erscheinende unterwerfen muss. Idealisierungen, Entsinnlichungen und Hypostasen ändern nichts an den epistemologischen Urverhältnissen, nach denen jegliche Form der Gegenüberstellung dem „bestimmungslosen Denken“ unterworfen werden muss, das alle erkennbaren Verhältnisse übergreift und bestimmt, ob wir nun von Gott, von Göttern, von ewigen Ideen oder von irdischen Phänomenen und Stoffen reden. Und wenn uns selbst ein „Außerweltliches“ mit dem Siegel der letzten Allwahrheit gegenübertreten würde, müsste es mit der übrigen Welt in erkennbarer Verbindung stehen, sonst wäre seine Wahrheit absolut unverständlich, also weder Wahrheit noch Unwahrheit, sondern sinnlos. Wahrheit kann sich nur selbst begründen, indem sie alles andere mitbegründet. Aus diesen Überlegungen gibt es keinen Ausweg. Wenn wir den reinen Seinsentzug durchexperimentieren, dann versuchen wir, wenn auch vergeblich, alle Gegenüberstellungen aus dem Denken hinauszuwerfen - und mit ihnen uns selbst und die Welt. Wir landen im puren Nichts, oder, um es mit dem treffenden Ausdruck Rudolf Steiners zu bezeichnen: wir begegnen dem leeren „ideellen Schein“, der völlig inhalts- und formlosen Phantasmagorie des Geistes, die alles Denken aufhebt, sogar das „reine Denken“, das ja auch aus Gegenüberstellungen lebt, die es an sich selbst gewinnt. Die Wahrheit ist kein weltfernes „ens“, aber auch kein „regulatives Prinzip“, ebenso wenig ein spezifisches Kogitat, sie ist auch nicht Gott, weil dieser Begriff nichts erklärt, sie lässt sich weder „realistisch“ noch „nominalistisch“ erfassen - sie ist, wie wir vorläufig sagen wollen, der evidentielle Prozess im Weltprozesses, in dem sie sich verwirklicht. Wir werden das später genauer untersuchen. Was wir jetzt deutlich machen wollen, läuft auf die Tatsache hinaus, dass es außerhalb des Denkens keine Wahrheit gibt, nur innerhalb des Denkens, und auch nur dann, wenn wir die Welt mit hineinnehmen. Andernfalls landen wir im „ideellen Schein“. Natürlich ist dieser Begriff eine aktologische Metapher - der „ideelle Schein“ ist weder herstellbar noch denkbar - aber seine Kennzeichnung bleibt unerlässlich, weil er uns darauf hinweist, dass es keine Wahrheit ohne Welt geben kann. Der Seinsentzug führt uns an eine Grenze, die wir nicht überschreiten dürfen.
18. Der Denkentzug
Ursprünglich waren wir von der Erkenntnis ausgegangen, dass unser Bewusstsein nur zwei Elemente enthält, die allem Denken zugrunde liegen, nämlich Begriff und Wahrnehmung. Etwas Drittes hatte sich nicht finden lassen. Und alles, was wir bisher herausgearbeitet haben, diente dem einzigen Zweck, die beiden in ein vertretbares Verhältnis zueinander zu bringen. Ohne uns dem Adäquationsbegriff der Wahrheit anschließen zu können, war uns doch klar geworden, dass Begriff und Wahrnehmung in dauernder Wechselwirkung miteinander stehen, die mit dem Problem der Wahrheit etwas zu tun haben muss. Statt nun zu deduzieren und Begriffe auseinanderzuspinnen, wollen wir wieder aktologisch vorgehen und dasselbe Verfahren anwenden, das den Seinsentzug charakterisiert: wir hatten festzustellen versucht, was der Begriff ohne Wahrnehmung wert ist; jetzt wollen wir die Gegenprobe machen und herausfinden, was von der Wahrnehmung ohne den Begriff übrigbleibt. Beide sind aufeinander angewiesen, wie uns die Erfahrungen und unsere Untersuchungen zeigen, aber wir wissen nicht, wie wir die Wechselwirkung beider verstehen sollen. Beim Seinsentzug ging uns alles Ideelle unter den Händen verloren, wir landeten bei einem Unmöglichen, beim „ideellen Schein“ - was wird nun geschehen, wenn wir den entgegengesetzten Weg gehen und einmal alles Denken, alle Begrifflichkeit aus der Wahrnehmung herausnehmen? Dabei ist es gleichgültig, wie das Denken philosophisch begriffen wird, denn jeder muss denken, wenn er sich in der Welt der Wahrnehmungen zurechtfinden will. Die genannte Wechselwirkung kann nicht geleugnet werden. Werfen wir also das gesamte Denken aus dem „Gegenüberstehenden“, aus dem „Vorgegebenen“, das wir nicht selbst produziert haben, hinaus. Zur Bezeichnung dieses speziellen Falles bediene ich mich des Ausdrucks „Denkentzug“, den ein Schüler Rudolf Steiners geprägt hat. Es sei noch einmal erwähnt, dass wir unter „Wahrnehmung“ alles verstehen, was durch den Begriff „Gegenüberstellung“ abgedeckt wird, also das raumzeitliche Weltpanorama und die innere Sphäre der Gefühle, Triebe und Bedürfnisse einschließlich der Vorstellungen und Erinnerungen.
Geben wir zum Denkentzug gleich Rudolf Steiner das Wort:
„Sehen wir uns die reine Erfahrung einmal an. Was enthält sie, wenn sie an unserem Bewusstsein vorüberzieht, ohne dass wir sie denkend bearbeiten? Sie ist bloßes Nebeneinander im Raum und Nacheinander in der Zeit, ein Aggregat aus lauter zusammenhangslosen Einzelheiten. Keiner der Gegenstände, die da kommen und gehen, hat mit dem anderen etwas zu tun. Auf dieser Stufe sind die Tatsachen, die wir wahrnehmen, die wir innerlich durchleben, absolut gleichgültig füreinander. Die Welt ist da eine Mannigfaltigkeit von ganz gleichwertigen Dingen. Kein Ding, kein Ereignis darf den Anspruch erheben, eine größere Rolle in dem Getriebe der Welt zu spielen als ein anderes Glied der Erfahrungswelt. Soll uns klar werden, dass diese oder jene Tatsache größere Bedeutung hat als eine andere, so müssen wir die Dinge nicht bloß beobachten, sondern schon in gedankliche Beziehung setzen. Das rudimentäre Organ eines Tieres, das vielleicht nicht die geringste Bedeutung für dessen organische Funktionen hat, ist für die Erfahrung ganz gleichwertig mit dem wichtigsten Organe des Tierkörpers. Jene größere oder geringere Wichtigkeit wird uns eben erst klar, wenn wir über die Beziehungen der einzelnen Glieder der Beobachtung nachdenken, das heißt, wenn wir die Erfahrung bearbeiten ... Die Welt ist uns auf dieser Stufe der Betrachtung gedanklich eine vollkommen ebene Fläche. Kein Teil dieser Fläche ragt über den anderen empor; keiner zeigt irgendeinen gedanklichen Unterschied von dem anderen. Erst wenn der Funke des Gedankens in diese Fläche einschlägt, treten Erhöhungen und Vertiefungen ein, erscheint das eine mehr oder minder weit über das andere emporragend, formt sich alles in bestimmter Weise, schlingen sich die Fäden von einem Gebilde zum anderen; wird alles zu einer in sich vollkommenen Harmonie.“ (Rudolf Steiner: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung. Dornach 7. Auflage 1979, S. 30f.)
Es kommt Rudolf Steiner auf den Zusammenhang der Dinge an, die uns in ihrer Verschiedenheit entgegentreten. Er fährt fort:
„Damit glauben wir zugleich vor dem Einwand gesichert zu sein, dass unsere Erfahrungswelt ja auch schon unendliche Unterschiede in ihren Objekten zeigt, bevor das Denken an sie herantritt. Eine rote Fläche unterscheide sich doch auch ohne Betätigung des Denkens von einer grünen. Das ist richtig. Wer uns aber damit widerlegen wollte, hat unsere Behauptung vollständig missverstanden. Das gerade behaupten wir, dass es eine unendliche Menge von Einzelheiten ist, die uns in der Erfahrung geboten wird... Auf diesem Gesamtbilde erscheint nach Betätigung des Denkens jede Einzelheit nicht so, wie sie die bloßen Sinne vermitteln, sondern schon mit der Bedeutung, die sie für das Ganze der Wirklichkeit hat. Sie erscheint somit mit Eigenschaften, die ihr in der Form der Erfahrung vollständig fehlen“. (Rudolf Steiner: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung. Dornach 7. Auflage 1979, S. 32f.)
So weit Rudolf Steiner. Natürlich erhebt sich hier eine Fülle erkenntnistheoretischer Fragen, auf die Rudolf Steiner in anderen Zusammenhängen eingeht und die wir später in Betracht ziehen werden, obwohl unsere früheren Ausführungen über das Denken vollauf genügen sollten. Sie werden an den zitierten Sätzen festgestellt haben, dass Rudolf Steiner sein Gedankenexperiment bis zu einer bestimmten Grenze ausführt. Erst viel später polarisiert er die beiden Ergebnisse, ohne sich näher darauf einzulassen. So lesen wir:
„Was im Menschen ist, ist ideeller Schein, was in der wahrzunehmenden Welt ist, ist Sinnenschein“. (Rudolf Steiner: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung. Dornach 7. Auflage 1979, S. 137, Erste Anmerkung zur Neuauflage 1924)
Hier könnten sehr leicht Missverständnisse auftreten, dahingehend, dass man den Begriff „Schein“ als etwas interpretiert, das mit einer Vorspiegelung gleichzusetzen ist, der jede Realität fehlt. Natürlich gibt es das Ideelle, aber nicht für sich allein, sondern immer im Verbund mit den Phänomenen der Welt. Genauso verhält es sich mit dem „Sinnenschein“. Auch er ist existent, aber ohne ein Realitätserlebnis zu vermitteln, weil das ideelle Element unfassbar wird. Wir wollen deshalb zum besseren Verständnis die beiden Ausdrücke von Rudolf Steiner, mit denen er die subjektive Scheinwelt der bloßen Sinneserfahrung bezeichnet, nämlich „reine Erfahrung“ und „Sinnenschein“, so formulieren, dass Eindeutigkeit besteht: wir sprechen in Zukunft nur vom „begrifflosen Sinnenschein“, um den Gegensatz zum „ideellen Schein“ deutlich hervorzuheben. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Stellen Sie sich eine camera obscura vor, die irgendeinen Ausschnitt eines räumlichen Panoramas abbildet, rein nach optischen Gesetzen, also ohne die Möglichkeit, dieses so gewonnene Lichtbild in eigener Regie als begrifflich geordnete Erscheinung zu erfassen, d.h. genauso, wie es unsere physischen Wahrnehmungsorgane machen, die ja auch nicht denken können -, und Sie haben das, was wir den „begrifflosen Sinnenschein“ nennen. Dasselbe müssen Sie natürlich auch auf Ihre inneren Wahrnehmungen übertragen: Sie erfahren Gefühle aller Art von denen Sie nichts wissen könnten, wenn Sie keine begriffliche Vernetzung erfahren würden. Nun sind wir aber keine camera obscura, wir sind denkende Wesen, die dem jeweiligen „Schein“ zuordnen, was dem andern fehlt. Als für sich gesonderte Zustände sind diese bloß gedachten Formen des „Scheins“ überhaupt nicht erlebbar, weil der erste die Sinnesphänomene ausschließt und der zweite keine ideelle Profilierung aufweist. Wir könnten überhaupt kein Bewusstsein entwickeln, weil es ohne das Denken kein Bewusstsein und ohne die Sinneserfahrungen keinen Bewusstseinsinhalt geben würde. Woran sollten wir uns halten? Ein ontischer Dualismus ist völlig sinnlos. Die vorgenommene Spaltung in zwei verschiedene Sphären hat ausschließlich methodologischen Charakter. Hüten wir uns davor, methodologische Probleme in ontologische zu verwandeln. Wir sitzen sonst einer vordergründigen Täuschung auf, einer vermeintlichen ideellen Innen- und einer raumzeitlichen Außenwelt. Wir verabsolutieren vielleicht nur unsere menschliche Organisation, die einem geschichtlichen Entfaltungsprozess unterworfen sein könnte. Darüber später.
19. Der primäre Erkenntnisakt
Es ist nun bei allen Menschen das untrügliche und geradezu evidente Gefühl vorhanden, dass uns die Sinneswahrnehmung eine unmittelbar reale Welt vermittelt, die ohne alles Ideelle auskommt. Woher dieser unverwüstliche Eindruck? Gewiss nicht aus je einer der beiden Formen des „Scheins“, die wir gefunden haben, sondern aus beiden zusammen. Aber dennoch beharren wir in unserer jetzigen Evolutionsstufe auf der unmittelbaren Rechtskraft dieses Weltgefühls und sind gerade heute sehr leicht bereit, in diesem naiven Wahrheitsbegriff des naiven Bewusstseins zu schwelgen. Die bloße Sinnenwelt betrachten wir, wie schon mehrfach gesagt, als von oben bis unten fertig, als durch sich selbst bestehend, in sich selbst gegründet, als unabhängig von uns und unbezweifelbar - als reines Sein, zu dem wir alle gehören, ohne dass wir irgend etwas hinzufügen müssen, um sie zu sich selbst zu bringen. Alles Ideelle hat für diese Welt keine ontologische Bedeutung. Mit Hilfe des Intellektes, der als Erscheinungsform der menschlichen Subjektivität betrachtet wird, versuchen wir uns zurechtzufinden, wohl wissend, dass sich diese Welt nicht um den zufällig entstandenen homo sapiens kümmert. Darüber sind sich die im Unbewussten wirkenden (verinnerlichten) Zeitevidenzen völlig im klaren, auch dann noch, wenn man sich herauszuideologisieren versucht. So weit noch einmal die Ansichten des naiven Bewusstseins. Wie sollte es auch anders sein? Wenn diese Weltbetrachtung falsch wäre, dann bliebe die Frage, in welcher anderen Welt wir nun eigentlich leben sollten; wenn sie richtig wäre, dann müssten wir uns fragen, welchen Sinn es denn haben soll, dass wir zu einer fertigen Welt noch etwas hinzufügen müssen, um sie zu verstehen und um in ihr leben zu können. Es muss dann doch zwischen Begriff und Welt einen Realzusammenhang geben, ohne den unser Leben nicht möglich wäre.
Nun ist es aber tatsächlich so, wie wir bereits dargelegt haben: unsere inneren und äußeren Sinne stoßen nirgends auf eine fertige, in sich ruhende, in sich abgeschlossene Welt. Was sie ergreifen, ist jeweils ein Teil der Welt, oder eine „Hälfte“, wie Rudolf Steiner sagt, nämlich den „ideellen Schein“ oder den „begrifflosen Sinnenschein“, also Phänomene, denen genau das abgeht, was uns die Welt zur „Welt“ macht - im Sinne des naiven Bewusstseins. Alles, was unsere Sinne wahrnehmen (auch die inneren Sinne), ist immer nur begriffloser Sinnenschein, entbehrt der ideellen Struktur, vermittelt also nicht die Welt, in der wir leben. Ein Fertiges ist nirgends zu finden. Beide Wahrnehmungssphären sind in sich selbst im strengen Sinne des Wortes absolut sinnlos. Erst wenn beide zusammentreffen, auf irgendeine Weise, entsteht ein sich selbst tragendes Ganzes, das die Eigentümlichkeiten der beiden Sphären miteinander „verschmilzt“ und das Erlebnis einer ideell geordneten und zugleich anschaubaren Welt hervorbringt. Sie werden mir jetzt entgegenhalten, dass ich unversehens wieder bei dem früher schon bezweifelten Adäquationsbegriff der Wahrheit gelandet bin und außerdem Begriffe wie „zusammentreffen“ und „miteinander verschmelzen“ gebrauche, die nichts wirklich erklären. Sie haben zunächst recht. Ich werde erst später - mit nicht ganz einfachen Überlegungen - mehr dazu sagen. Was wir jetzt schon begreifen können, ist die entscheidende Tatsache, dass und wo sich die Verbindung beider Wahrnehmungssphären vollzieht: nämlich im ersten und ursprünglichen Erkenntnisprozess, der uns die Welt als „Welt“ übergibt, d.h. als vorbegriffene Anschauung, aus der wir bereits denken, wenn wir zu denken anfangen. Diesen entscheidenden Erstvollzug der Vereinigung des „Doppelscheins“ wollen wir den primären Erkenntnisakt nennen. Er schafft die logisch-existentiellen Prämissen für alles zeitlich nachfolgende Denken, für unsere täglichen Begriffsgestaltungen, deren wie immer gearteten Ablauf wir den sekundären Erkenntnisakt nennen wollen. Beide Akte sind ein und derselbe Vorgang, allerdings im Nacheinander der Zeit, ohne das Ineinander aufzuheben. Für die Leistungen des primären Erkenntnisaktes werden gewöhnlich die Ausdrücke „Vorinterpretation“ und „Seinsvorverständnis“ gebraucht, nicht ohne einen Anhauch des Rätselhaften und Mystischen, weil sie das menschliche Erkenntnisvermögen zu übersteigen scheinen. Oder man erklärt sie zu bloßen „Fiktionen“, die keiner philosophischen Analyse bedürfen, also krass positivistisch oder irgendwie idealistisch bis herunter zu den Neuhegelianern. Dabei wird das Problem verfehlt. Der primäre Erkenntnisakt ist weder ein Nichts noch ein Mystikum, sondern ein in jeder Hinsicht glasklarer, durchsichtiger Vorgang, der sich auf nichts weiteres zurückführen lässt als auf sich selbst. Es kann nichts Erkenntnismäßiges geben, das über ihn hinausführt, weil er als Prozess selber das Absolute ist.
Diese Überlegungen beweisen sich (außer durch die „Kategorien“ des Denkens) in der folgenschweren Tatsache, dass ein scheinbar neues Phänomen auftritt, wenn sich die beiden Formen des „Doppelscheins“ amalgamieren: es tritt etwas hervor, das weder der „ideelle Schein“, noch der „begrifflose Sinnenschein“ produzieren kann: das unmittelbare Erlebnis dessen, was wir „Wirklichkeit“ nennen. Es gibt keine „Wirklichkeit“ ohne die Leistungen des primären Erkenntnisaktes. Damit erschließt sich unser früher erwähntes „Junktim“, die prinzipielle Zusammengehörigkeit von „Logik“ und „Erlebnis“, zum ersten Mal als unmittelbare Erfahrung: der abstrakte Begriff „Sein“ erhält erst seinen philosophischen Wert, seine brauchbare logische Bestimmung, wenn in ihm die Wirklichkeit mitgedacht und miterlebt wird. Ein Sein ohne Wirklichkeit ist eine Chimäre, und Wirklichkeit ohne mitgedachten Begriff des Seins können wir uns nicht vorstellen, oder wir werden Opfer von nur semantischen Differenzierungen, die einzelne Aspekte des Gesamtphänomens festhalten. Diese „Seinswirklichkeit“, wie wir sie einmal nennen wollen, hat ganz verschiedene Begriffsbildungen produziert, die dasselbe Phänomen bezeichnen: so den Begriff „Objektivität“, der nichts anderes sagen will, als dass wir in einer auf sich selbst beruhenden Seinswirklichkeit leben, die aus der Selbsttragekraft des Denkens und damit aus dem Ansich und der Wahrheit kommt, wie wir das früher bereits dargestellt haben. Die Begriffe „Sein“ und „Wirklichkeit“ sind nur anders formulierte Aspekte ein und derselben Sache, nämlich des Absolutums der Selbsttragekraft unseres Denkens. Das ist ja der Grund dafür, dass sie nicht hinterfragbar und unableitbar sind. Und sie existieren zugleich als psychische Faktoren, als konkrete Erlebnisse, mit denen sich zwar die empirische Psychologie auf ihre Weise befassen kann, die aber genauso, im exakten Sinne des Wortes, Urelemente der reinen Logik darstellen, ohne welche die Logiker kein philosophisches Fundament finden können. Wir wollen schon jetzt einen Begriff vorausnehmen, der das Phänomen des Junktims auch für alle späteren Fälle benennt, in denen wir es mit ähnlichen Sachverhalten zu tun haben: wir werden von der psychomentalen Erfahrung sprechen, wenn wir das „mentale“ wie das psychische Element in konkreten und besonderen Erlebnissen und Kogitaten vorfinden. Für jetzt halten wir fest: die erste große psychomentale Erfahrung vermittelt sich uns im primären Erkenntnisakt als Phänomen des Denkens und des Erlebens, d.h. als erfahrene Seinswirklichkeit und Objektivität. Dass es dasselbe Phänomen auch im sekundären Erkenntnisakt gibt, wird uns später beschäftigen.
Lassen wir einmal Rudolf Steiner das Wort. Ihnen ist ja der folgende Satz bekannt:
„Erst die durch die Erkenntnis gewonnene Gestalt des Weltinhaltes, in der beide aufgezeigte Seiten desselben vereinigt sind, kann WIRKLICHKEIT genannt werden.“ (Rudolf Steiner: Wahrheit und Wissenschaft. Dornach 5. Auflage 1980, S. 70)
Daran knüpft Rudolf Steiner später die nachfolgenden Ausführungen:
„Das Resultat dieser Untersuchungen ist, dass die Wahrheit nicht, wie man gewöhnlich annimmt, die ideelle Abspiegelung von irgend einem Realen ist, sondern ein freies Erzeugnis des Menschengeistes, das überhaupt nirgends existierte, wenn wir es nicht selbst hervorbrächten. Die Aufgabe der Erkenntnis ist nicht: etwas schon anderwärts Vorhandenes in begrifflicher Form zu wiederholen, sondern die: ein ganz neues Gebiet zu schaffen, das mit der sinnenfällig gegebenen Welt zusammen erst die volle Wirklichkeit ergibt. Damit ist die höchste Tätigkeit des Menschen, sein geistiges Schaffen, organisch dem allgemeinen Weltgeschehen eingegliedert. Ohne diese Tätigkeit wäre das Weltgeschehen gar nicht als in sich abgeschlossene Ganzheit zu denken. Der Mensch ist dem Weltlauf gegenüber nicht ein müßiger Zuschauer, der innerhalb seines Geistes das bildlich wiederholt, was sich ohne sein Zutun im Kosmos vollzieht, sondern der tätige Mitschöpfer des Weltprozesses; und das Erkennen ist das vollendetste Glied im Organismus des Universums.“ (Rudolf Steiner: ebd. S. 11f.)
So weit der Text. Der Schlusssatz führt schon über unsere Betrachtungen hinaus. Er hat nur Sinn, wenn wir ihn auf das Gesamtphänomen der Evolution beziehen. Es wird noch mancher Untersuchungen bedürfen, um ihn ganz zu verstehen. Auch mit der Wahrheit als einem sog. „freien Erzeugnis des Menschengeistes“ werden wir Schwierigkeiten haben. Aber dieses Thema müssen wir beim jetzigen Stand unserer Überlegungen vorerst liegen lassen. Uns interessieren weiterhin Sein und Wirklichkeit, vor allem jedoch der Seinsbegriff.
20. „Sein“, „Substanz“, „Copula“ und „Selbstbegründung“
Von jeher hatten die Philosophen ihre Schwierigkeiten mit dem Chamäleon des Seinsbegriffs. Dasselbe gilt für die aufdringliche Copula „ist“, die wie ein Sauerteig unser Reden und Denken durchdringt. Bereits Aristoteles beschrieb die Einzigartigkeit dieser Phänomene, ohne eine befriedigende Lösung anbieten zu können. Der Seinsbegriff hat zwar den Charakter des Allgemeinen, ist aber trotzdem kein Gattungsbegriff. Und in der verbalen Form „sein“ treten zahlreiche Bedeutungen auf, die, wie es scheint, auf keinen gemeinsamen Nenner zu bringen sind. Die Situation ist hoffnungslos verfahren. Erst Martin Heidegger hat neuerdings wieder den Versuch unternommen, das „Sein“ und den Seinsbegriff zum Ausgangspunkt einer Philosophie zu machen, ohne dabei in eine überholte Form der Erkenntnistheorie zu verfallen, die ja selbst von Gnaden des Seins lebt. Das alles ist sehr einleuchtend und kann bis zu einem gewissen Grade vertreten werden. Heidegger fragt konsequent nach Sinn und Gehalt des Seins und des Seinsbegriffs, verfehlt aber die konkrete Erkenntnissituation, aus der wir denken müssen: er geht von einem Vorverständnis aus, das er nicht der intermittierenden Denkbeobachtung und damit der Erfahrung unterwirft. Dass schon die linguistische Ausdeutung der Seinsstruktur auf Irrtümern beruht, wie das Charles H. Kahn in seinem ausgezeichneten Werk „The Verb «Be» and its Synonyms“ nachgewiesen hat, ist allerdings für die Sache unerheblich. Anders liegt der Fall, wenn psychologisierende Begriffe zur Bestimmung eines konkreten Seinswesens herangezogen werden, und zwar als ontologische Qualitäten, als dem Sein inhärente Strukturformen, die gar keine erkenntnismäßig-logische Funktion aufweisen und somit unphilosophisch sind. Keine Erkenntnis darf das zentrale Phänomen der Logik ausschließen, wenn sie nicht in den Bereich des Unverbindlichen absinken will, wie es besonders den sog. „Lebensphilosophen“ passiert ist. Heideggers „Sein als Sorge“ könnte uns zwar vom Standpunkt unseres „Junktims“ interessieren, und es ist sogar etwas Wahres daran, aber Heidegger lässt genau das liegen, worum wir uns so redlich bemühen: er untersucht nicht die ersten Erfahrungsformen des Seins und Seinsbegriffs, d.h. er übergeht deren logische und psychologische Erscheinungsformen im menschlichen Bewusstseins und erkennt auch nicht das „bestimmungslose Denken“, das über allen seinen Begriffen steht, auch über dem Begriff des Seins, weil es ihn sonst nicht hervorbringen könnte. Wir wissen das bereits. Und gerade diese Komplikationen werden uns ja noch einiges zu schaffen machen. Kein Wunder, dass Heidegger keinen tragfähigen Wahrheitsbegriff entwickeln konnte. Es bleibt ein Rest von scholastischem Aristotelismus, den er bekämpfte, aber niemals ganz überwinden konnte.
Aus unseren bisherigen Überlegungen wird auch die kategorische Anwendung der Copula „ist“ sinnvoll und damit verstehbar. Wie wir wissen, gehört es zum Urphänomen aller Wissenschaft, dass alles, worüber wir denken, die unvermeidbare Form der Gegenüberstellung (also des Objektiven) besitzt, und jede Gegenüberstellung erscheint uns immer als ein etwas, das „ist“, als ein Seiendes, das uns Gegenstände oder „Quasi-Gegenstände“ anbietet, seien es nun raumzeitliche Gestalten, seien es Gedanken, Begriffe, Irrtümer, Täuschungen, Illusionen oder Triebe, Gefühle und moralische Intentionen usw. Es ist nun nicht der Inhalt dieser Objekte, wie so häufig gemeint wird, sondern ausschließlich dieser Akt der Gegenüberstellung als solcher, ganz für sich allein, der uns dazu zwingt, die Copula „ist“ immer und in allen Fällen anzuwenden. Der Inhalt wird naturgemäß impliziert, weil sich unser naives Bewusstsein auf die Sache richtet, aber nicht auf den Akt selbst. Wie hier auch Sprachphilosophen irren können, zeigt eine Bemerkung Wittgensteins, der einmal sagt, dass schon der Ausdruck „ein Bewusstsein besitzen“ eine unberechtigte Verdinglichung vornimmt, die zu Hypostasen verführt, also im gegeben Fall einen Gegenstand „Bewusstsein“ als Sache vorspiegelt, die es gar nicht in der gemeinten Weise gibt. Das ist zwar im Prinzip richtig, aber wenn man Inhalt und Akt voneinander trennt, dann ist der Sachverhalt klar: wir stellen uns unser eigenes Bewusstsein gegenüber, sonst wüssten wir nicht, dass wir eins haben, und dieser notwendige Objektivierungsvorgang, der in unserer Ich-Organisation (wie auch immer) gründet, zeigt ganz eindeutig, dass wir etwas „besitzen“, d.h. besagt nicht mehr, als was die Copula „ist“ bezeichnet. Was das menschliche Bewusstsein faktisch-strukturell ist - im Sinne der Seinsqualitäten - bleibt völlig offen. Wittgenstein hat möglicherweise, dem zitierten Ausdruck entsprechend, an ein eng begrenztes menschliches Bewusstsein gedacht, also ohne die theoretische Plausibilität eines Weltbewusstseins zu denken, das in den Menschen hineinragt. Die Logiker denken sehr scharfsinnig, aber sie beobachten nicht genügend und werden manchmal erstaunlich leicht die Opfer des naiven Bewusstseins, das sie gerade überwinden wollen. In der Copula „ist“ werden unsere „Kategorien des Denkens“ gleichsam auf einen einzigen Punkt zusammengezogen, ohne dass wir es bemerken: neben dem Sein auch die Wirklichkeit, das Ansich und die Wahrheit. Und hier nicht allein: es sind die Verben „sein“, „haben“ und „werden“, die durch alle ihre Konjugationen dieselben Phänomene spiegeln oder, um es anders zu sagen, die „Tiefengrammatik“ der Sprache enthüllen, der alten wie der neuen. Die zahlreichen „Bedeutungen“ des Verbums „sein“, von denen gerne gesprochen wird, gehören überhaupt nicht in diesen Zusammenhang. Sie entstehen auf konkreten Anwendungsgebieten, sie explizieren die Seinsverhältnisse spezieller Kogitate, wie etwa die im Einzelfall präzisen mathematischen Symbole „=“ usw., die aber dennoch die ursprünglichen Seinsstrukturen implizieren. Es ist ein Irrtum, hier von verschiedenen Bedeutungen des Seins als solchem zu sprechen. Auch die historischen und die sozialökonomischen Strukturen der menschlichen Sprachen mit allen zuweilen erheblichen Differenzierungen können nur als spezielle Realisationsformen der „Kategorien des Denkens“ in der Sprache gelten, es sei denn, man sei von der Sprache so „verhext“, dass einem der Unterschied zwischen Denken und Sprechen verloren gegangen ist. Wir werden darüber noch zu Wort kommen.
Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang noch etwas zum Begriff der „Substanz“ sagen, den wir bereits kurz in Verbindung mit Spinoza gestreift hatten. Sie erinnern sich der aufschlussreichen Definition in der „Ethik“, die wir noch einmal zitieren wollen:
„Unter Substanz verstehe ich das, was in sich ist und durch sich begriffen wird“. (Spinoza: Werke. Ethik. Erster Teil. Von Gott. Definitionen Nr. 3. Hrsg. von Konrad Blumenstock. Darmstadt 1980, Bd. II, S. 87).
So weit Spinoza. Es bedarf jetzt keiner weiteren Ausführungen mehr; Sie haben sofort begriffen, welche Rolle hier der primäre Erkenntnisakt mit seinen Denkleistungen spielt. Wir könnten auch so formulieren: „Substanz“ ist das, was auf sich selbst beruht, autochthon und unableitbar. Das gilt nach Spinoza sowohl für materielle wie auch für ideelle Substanzen, für alles, was für sich ist, und deshalb auch für die höchste Substanz: für Gott. Gott, Sein und Wahrheit werden identisch, weil sie sich nur noch auf sich selbst zurückführen lassen. An diese Grenze stoßen alle, die über solche Begriffe philosophieren wollen. Jedes begriffliche Darüber hinaus gehört in die phantasierende Metaphysik. Es kommt hinzu, dass der Begriff „Substanz“, als Spiegelbegriff zur Selbsttragekraft des Denkens, die zunächst berechtigte Bezeichnung für etwas war, was uns als unveränderlich entgegenzutreten schien. Aber heute ist der Substanzbegriff in der Naturwissenschaft ins Wanken geraten. Auch die sog. und geliebte „Materie“ kann nicht mehr als Substanz im ursprünglichen Sinne des Wortes verstanden werden. Dasselbe gilt für den Begriff „Geist“, sofern darunter eine Substanz verstanden wird, es sei denn, man halte mit Haeckel den lieben Gott für ein „gasförmiges Wirbeltier“. Ich weiß nicht, was Gott als „Substanz“ bedeuten soll, wenn ich bei der alten Begriffen bleibe, aber ich erkenne sofort seinen konkreten Sinn, wenn ich seine Relation zu den „Kategorien des Denkens“ herstelle. Dort hat er seine sinnvolle Heimat, gleichviel welche berechtigte oder unberechtigte Rolle er in den speziellen Kogitaten spielt. Er ist wegen seiner vielfältigen Konnotationen auf jeden Fall mit höchster Vorsicht zu behandeln.
In all unseren bisherigen Überlegungen stellt sich eindeutig heraus, dass in sämtlichen sekundären Erkenntnissen die Vorleistungen des primären Erkenntnisaktes wirksam sind. Gerade die Copula „ist“ beweist das. Aber es muss immer wieder klargemacht werden, dass wir von keinem kategorialen Apriori sprechen, von keiner strukturellen Bestimmtheit des Denkens, obwohl wir die traditionellen Sprachbilder brauchen, die zu dieser Annahme verführen könnten. Das hat seine Ursache darin, dass wir zunächst einmal wegen unserer doppelten Wahrnehmungsform das Ideelle, also unsere Begriffe, isoliert betrachten müssen und Gefahr laufen, sie als unabhängig von der Erfahrung zu betrachten. Alle unsere „Kategorien des Denkens“ sind ausschließlich reine Erfahrungsbegriffe, sind in genauem Sinne des Wortes introspektiv gewonnenes wirklichkeitsgetreues Aposteriori, sind konkrete Weltstrukturen, obwohl sie als abstrakte Formen erscheinen, wenn wir sie uns im Bewusstsein isoliert gegenüberstellen. Die reale Anschauung eines raumzeitlichen Gegenstandes, eines Baumes etwa, kennt diese Abstraktion nicht: wir identifizieren den Baum als Baum, ohne seinen Begriff als etwas von ihm Verschiedenes zu erfahren. Dasselbe gilt für die innere Wahrnehmung: wir erfahren unmittelbar die Selbsttragekraft des Denkens als objektiv vorgegebene Weltstruktur, als auf sich selbst beruhende Wirklichkeit, die nirgends den unlogischen Anlass bietet, ein dahinterstehendes „Ding an sich“ zu konstruieren, das doch nur wieder in semantischer Variation dieselbe Aussage macht, die uns bereits aus der „fertigen Welt“ entgegen leuchtet. Eine solche Verdoppelung hat keinen Sinn: man kann kein Etwas durch und mit sich selbst erklären wollen.
Im Sinne unserer bisherigen Überlegungen ist auch der mit Recht heute so umstrittene „Platonismus“ nicht sinnvoll. Wer die Begriffe oder Ideen zu selbstständigen Wesen macht, verkennt die Tatsache, dass wir vermöge unserer Ich-Organisation, über die wir nachher reden werden, die einzelnen Begriffe aus einem Ganzen herauslösen und für sich allein (als sog. „Quasi-Gegenstände“) in die „intermittierende Denkbeobachtung“ hereinnehmen und betrachten können. Das ist aber Sache unserer Organisation und kein erkenntnistheoretisches Problem. Alles Ideelle ist zwar eine Realität, sonst könnten wir keinen Gegenstand erkennen, es gehört zur Sache, aber seine Erscheinungsform in Gestalt von Begriffen hängt zweifellos mit gewissen subjektiven Strukturen unserer Organisation zusammen. Allerdings dürfen wir nicht in der Fehler verfallen, den Wahrheitsgehalt der Begriffe zu leugnen oder sie in ihrer jetzigen Erscheinungsweise essentialistisch zu verabsolutieren. (Dies Überlegungen werden noch Konsequenzen haben.)
Nun erst tritt der „monistische Wahrheitsbegriff“ in das rechte Licht. Der primäre Erkenntnisakt führt das getrennt Wahrgenommene zusammen und macht es zu einem Einheitlichen, das objektiv existiert, d.h. unabhängig von uns und von uns auch nicht hervorgebracht - im Sinne unserer früheren Feststellungen, dass „Selbstproduziertes“ und „Fremdproduziertes“ korrelative Begriffe sind. Von der Seite des Objektes gesehen müssen wir sagen, dass jedes Objekt ein konkretes Drittes ist, also kein Konglomerat aus „ideellem“ und „begrifflosem Sinnenschein“, sondern ein unzerlegbares Etwas, das wir erst in unserer Wahrnehmung zerlegen, um es dann im Erkenntnisakt wieder als Ganzes zu erfassen. Erst so entsteht das, was wir „Welt“ und „Wirklichkeit“ zu nennen gewohnt sind.
Eine andere Frage ist es, warum uns der raumzeitliche Wahrnehmungshorizont in endlos auseinander gegliederten Einzelgestalten erscheint: es wäre doch, rein hypothetisch, denkbar, dass er uns auch in einer davon völlig verschiedenen Weise gegenübertreten könnte. Probieren Sie es einmal, irgendeine andere Vorstellung, d.h. in gestaltloser Art, zu imaginieren, und Sie werden sofort erkennen, dass Sie dazu gar nicht in der Lage sind. Schon diese Aufforderung ist unsinnig. Wie ist das zu erklären? Hierzu erst einige Vorbemerkungen. Es liegt schon in ihrem Begriff, dass eine Gestalt durch eine Tatsache bestimmt ist, die ihr Wesen ausmacht: sie hebt sich von ihrer Umwelt ab und führt ein Eigenleben, das auf ein verborgenes Zentrum hinzuweisen scheint. Welche philosophischen Interpretationen Sie auch hinzufügen mögen: voraus geht die Grundeigenschaft der Gestalt, sich als ein Etwas darzubieten, das, scheinbar unabhängig von allem, ganz auf sich selbst beruht. Man ist versucht, an die „Monaden“ von Leibniz zu denken. Jede Wissenschaft hat es immer und ausschließlich mit Gestalten zu tun, wenn sie Objekte untersucht, seien es nun Atome, Moleküle, Strukturen, Energieformen oder komplizierte Lebensprozesse. Auch die nicht sinnenfälligen Wahrnehmungen, wie Begriffe, Gedanken und Gefühle, verfügen auf ihre eigene Weise über Struktur- und Gestaltcharakter, also über innere Zusammenhänge, die sich uns als so etwas wie „Ganzheiten“ darbieten. Es spielt dabei gar keine Rolle, was die „Gestaltpsychologie“ und „-philosophie“ (Driesch, Lorenz u.a.) im einzelnen diskutieren: sie alle leben von der ursprünglichen Gestaltwahrnehmung, sonst gäbe es nichts, aber auch gar nichts zu identifizieren. Wir müssen immer und überall in der Lage sein, ein Etwas als Dieses und kein Anderes zu bestimmen, wenn wir erkennen wollen. Das geht nur mit Hilfe der „Gestalt“. Und den Zusammenhang aller „Dinge“ erleben wir als Gestaltzusammenhang; und diesen Zusammenhang erfassen wir innerhalb der evolutiven Form- und Bilderfolge als den langen Entwicklungsweg zu immer mehr zentrierten und immer intimer auf sich selbst beruhenden Gestaltensteigerungen. Und wir identifizieren sie, gewollt oder ungewollt, nach dem Rang der Unmittelbarkeit ihrer Selbstbeziehung. Es hat noch nie eine andere Evolutionslehre gegeben. Und wenn wir schließlich bis hinauf zum Menschen kommen, finden wir das letztmögliche Phänomen der Selbstbeziehung vor, nämlich die immanente Selbstrückbezüglichkeit, d.h. wir erkennen und ergreifen uns als mit uns selbst identische Gestalten. Diese Überlegungen weisen den Weg zu einer spirituellen Evolutionslehre. Damit sind wir schon wieder bei unseren „Kategorien des Denkens“ angelangt: wir suchen naturgemäß allemal und überall das, was auf sich selbst beruht, sich selbst trägt und bei sich zu Hause sein will, ohne uns daran zu stoßen, dass es sich in so verschiedenen Stufen manifestiert. Auch unser persönliches Erkenntnisstreben sucht ein Zuhause in einer sich begreifen wollenden Selbsterkenntnis, also nicht auf dem bloß formalen Weg der abstrakten Identitätsfindung (A = A), sondern in der höchstmöglichen Form aller möglichen Identitätsstrukturen: in einer durchsichtigen Form von „Selbstbegründung“, in der unser Fragen immer mehr zur Ruhe kommt. Wir kennen diesen Begriff von früher und wissen, was er meint, aber wir sind nicht in der Lage, ihm eine vorstellbare Kontur zu geben, d.h. als „Gestalt“ zu ergreifen und zu verstehen. Wir erinnern uns dabei der Formel „causa sui“, einer inhaltlichen Leerformel, die nichts weiter hergibt als den formalen Hinweis auf ein logisches Postulat, das bereits unseren Zwecken gedient hat. Wenn der Begriff „Selbstbegründung“ mit konkretem Inhalt gefüllt werden soll, dann muss er auf irgendeine Weise mit dem Phänomen der Anschauung zu tun haben, er muss seine logische Natur überwinden und in unserem geistigen Gesichtskreis präsent, also wahrnehmbar werden, so unsinnig diese Forderung auch erscheinen mag. Über die „causa sui“ können wir nicht hinaus, weil sie das Denken auf sich selbst zurückwirft, wie wir früher nachgewiesen haben. Diese Grenze ist unübersteigbar, oder wir konstruieren metaphysische Dinge, die in der Luft hängen. Es könnte aber etwas geben, das uns herunterführt - und zwar in den tatsächlichen Gang der evolutiven Gestaltprozesse, wo jede Form der inneren und äußeren Anschauung beheimatet ist. Aber auch hier stoßen wir auf Widerstand: es kann in Begründungszusammenhängen weder Metaphysik noch Anschaulichkeit geben, weil beide Vorstellungselemente enthalten, die mit logischer Begründung unverträglich sind. Auch die Introspektion ist keine beweisende Tätigkeit und fehl am Platze. Größer kann das Dilemma nicht sein. Genau in dieser Situation befindet sich die moderne Philosophie, von Popper bis zu den Sprachphilosophen. Alle anderen Weltbilder scheinen Rückfälle in vergangene Konglomerate von essentialistischen Begriffen und anschaulichen Phantasiegebilden zu sein, zuweilen groß und gewaltig, aber immer ohne sich selbst tragenden Begründungshorizont, der aus Urteilen und nicht aus Realien besteht. Allerdings steckt in diesen Betrachtungen auch eine unbewusste Vorinterpretation, die der Überprüfung bedarf. Die Erkenntnisverhältnisse sind nicht so einfach, wie man uns heute glauben machen will. Wir haben schon in der Struktur des primären Erkenntnisaktes gesehen: die Selbsttragekraft des Denkens ist eine überlogische Erfahrung, zwar nicht sinnlich-anschaulich, aber als psychomentales Erlebnis wahrnehmbar - und dennoch das bedeutsamste Urelement aller Logik überhaupt. Es gibt also einen dritten Bereich neben der geistlosen Anschauung und der urteilenden Logik, einen Bereich, der über beiden liegt, weil er beide umschließt. Genau um diese Wahrnehmungsform hat sich die Philosophie betrogen, als sie mehr und mehr im materiologischen und logischen Positivismus versank, wie das heute in extremer Weise der Fall ist. Die so gepriesene „kritische Periode“ (seit Kant) ist nicht selbstkritisch genug gewesen, um diese übersinnlichen Phänomene als Erkenntnisfaktoren ausfindig zu machen. Sie blieb den Zeitevidenzen verhaftet, ohne es zu merken. Darüber hinaus degoutiert sie aus purer Animosität den Begriff des „Übersinnlichen“, weil sie dahinter etwas philosophisch Unreelles vermutet, ohne auch nur zu ahnen, dass jeder Mensch von morgens bis abends aus Erfahrungen lebt, die über das hinausgehen, was die inneren und äußeren Sinne angeblich als Tatsachen vermitteln. Wir werden uns mit diesem Problemkreis noch eingehend beschäftigen. Es könnte sich ein Weg finden, der neue Perspektiven eröffnet.
In diesem Zusammenhang sei auch noch einmal der religiöse Aspekt der „causa sui“ erwähnt, die ja als eine logifizierte Form des Gottesbegriffs aufzufassen ist. Spinoza machte gar nicht erst den Versuch, diese Grenze zu übersteigen, weil er sie wohl als das Ende aller logischen Denkwege angesehen hat. Ganz anders verhalten sich die Gläubigen. Ihnen bleiben theoretische Tüfteleien fremd und gleichgültig. Aber auch sie erliegen einem schwerwiegenden Irrtum: mit ihrer religiösen Formel „höher denn alle Vernunft“ weisen sie genau das zurück - und oft mit erschreckender Feindseligkeit -, was den Menschen zum Menschen macht, nämlich des Erkennen. Es gibt keinen Glauben, der nicht aus der Erkenntnis geboren wäre. Und nichts ist schlimmer, auch in religiöser Hinsicht, als diesen beweisbaren Tatbestand zu leugnen. Niemand darf, im Namen Gottes oder der Wahrheit, das eigene beschränkte Subjekt mit allen seinen Vorurteilen, Barrieren, Grenzen und Schwächen zum Maßstab des Denkens und Glaubens erheben, oder er macht sich der Dummheit schuldig. Jedes Dogma ist tödlich. Dazu hat uns das 20. Jahrhundert die blutigsten Beweise geliefert. Aber trotz aller Einwände muss es doch etwas geben, was den ehrlichen und ernsten Gläubigen trägt und befriedigt. Woher mag das kommen? Erinnern wir noch einmal an die vorhin gestellte problematische Frage, ob es auf dem konkreten Weg der evolutiven Gestaltenfolge, also im Bereich des Erfahrbaren, ein Faktum gibt, das in der Form seines Auftretens irgend etwas mit den Begriffen „causa sui“ und „Substanz“, also auch mit „Gott“ und „Wahrheit“, zu tun hat. Wenn ja, dann hätten wir eine kugelrunde contradictio in adjecto provoziert, nämlich einen sichtbaren Begründungszusammenhang, den es nicht geben kann, auch nicht in irgendwelchen Vorstufen. Und doch scheinen die Gläubigen diesen Widerspruch nicht anerkennen zu wollen, wenigstens nicht in ihren unbewussten Denkprozessen. Die Gläubigen gehen nicht von abstrakten Begriffen aus, sie leben mit „Gestalten“, mit Vorstellungen, mit Bildern, die aussagekräftig sein müssen, sonst könnten sie nicht eine so nachweisbare große Wirkung ausüben. Dasselbe gilt ja auch für die Kunst. Alle Einsichtigen wissen das. Gehört das alles nur in die „empirische Psychologie“? Ist hier nirgends das Erkennen beteiligt? Oder nur jenes Erkennen nicht, das wir heute „Erkennen“ nennen? Lassen Sie mich ein religiöses Bild herausgreifen, das in seiner unklaren Feierlichkeit einen tiefen Eindruck machen kann: ich meine das paulinische Wort, dass wir einmal Gott „von Angesicht zu Angesicht“ sehen werden. Welche Befriedigung kann eine solche Metapher dem Gläubigen geben? Heute sind wir natürlich sofort bereit, „soziologisch“ zu denken und patriarchalische Reminiszenzen hineinzudeuten, den Feudalherrn als gesellschaftlichen „Gott“, der langsam zum „Alten Herrn mit Rauschebart“ degenerierte. Und das ist unter sinnvollen Gesichtspunkten nicht einmal ganz falsch. Aber man sollte in Betracht ziehen, dass Paulus einen hohen Bildungsgrad und ein von unserem verschiedenes Denkbewusstsein hatte. Er hat gewiss keine Gesellschaftsstrukturen „verinnerlicht“. Er war auch nicht das naive Opfer von unbewussten „anthropomorphistischen“ Vorstellungen, wie wohl heute eine andere Interpretation lauten könnte. Vor diesen vordergründigen Auslegungen sollte uns auch sein personalistisches Damaskuserlebnis bewahren. Wo liegt nun der Erlebniskern? Im menschlichen „Angesicht“ erfahren wir auf anschauliche Weise genau das, nach dem wir immer auf der Suche sind: das seelische und geistige Zuhause. Keine andere erfahrbare Erscheinung vermittelt etwas Vergleichbares. Unsere persönliche, in sich selber sinnlose Robinsonade endet unmittelbar im Anblick eines menschlichen Antlitzes: wir kommen in ihm vorübergehend zur Ruhe, als hätten wir das gefunden, was sich selbst erklärt. Das tut es zwar nicht, aber es ist der Anfang eines Evidenzerlebnisses, das wir deshalb ganz instinktiv zu geistigeren Formen weiterimaginieren können, bis das hervortritt, was wir, in subjektiver Färbung, das „Angesicht Gottes“ nennen. Der rote Faden dieser ideellen Steigerung ist die Entfaltung des ursprünglichen Evidenzerlebnisses. Daher die immer damit verbundene intelligente Idealstruktur dieses „überirdischen“ Angesichts, das sich als universelles Kommunikationswesen offenbart. Hier liegen auch die Ursprünge des alten Schönheitsbegriffs, der das idealtypische Urbild des Menschen inkarnieren wollte, ohne auf die konkrete Individualität Rücksicht zu nehmen, wie wir das heute tun müssen. Dahinter steht allemal jene Erfahrung, die wir das „psychomentale Erlebnis“ genannt haben, das darin besteht, ideell-reelle Dinge und Vorgänge zu erleben und stufenweise zu verwandeln, bis ihr Wesen sich in sich selbst konzentriert und immer deutlicher in die „Sichtbarkeit“ tritt. Auch das sind Urteile, aber mit einer anderen Methode gewonnen, die uns noch beschäftigen soll.