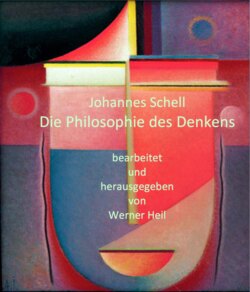Читать книгу Die Philosophie des Denkens - Johannes Schell - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
C. DIE INTERMITTIERENDE „DENKBEOBACHTUNG“ ALS URSPRÜNGLICHE BEWUSSTSEINSPOLARITÄT
Оглавление8. Das methodologische Urphänomen der Wissenschaft und Philosophie
Uns liegen nun fünf erste Beobachtungen vor: (1) Worauf wir im täglichen Denken niemals reflektieren, ist das Denken selbst - wir übersehen es; (2) wir streben im Erkennen der Welt immer und ausschließlich nach „Einheit“, weil wir nur eine einheitliche Welt begreifen können; (3) unter allen Prozessen der Welt ist das Denken der einzige, bei dem wir dabei sein müssen, wenn er ablaufen soll; (4) Mit der Produktion von Begriffen tauchen wir ins lebensnotwendige Element dessen ein, was wir Wahrheit nennen; (5) die selbstproduzierten Begriffe dieser Wahrheitswelt stehen in dauernder Wechselwirkung mit allen Wahrnehmungen, die ohne unser Zutun vorhanden sind. Aus diesen Beobachtungen haben wir geschlossen, dass zuerst die geistig ordnende Macht, also das Denken, untersucht werden muss, sofern das überhaupt möglich ist.
In diesen „Kristallisationspunkten“ versteckt sich aber eine Fülle von Zusammenhängen, deren Struktur noch ungeklärt ist. Bevor wir uns dem Denken zuwenden, müssen wir konkrete Beziehungen aufdecken, die wir etwas großzügig überspielt haben. Schon das Doppelphänomen von Begriffsschöpfung und fertigem Begriff, von tätigem Hervorbringen und Hervorgebrachtem, von Akt und Resultat kann Verwirrung stiften. Mit der Bezeichnung „Selbstproduziertes“ für die ideelle Seite, also das erste Phänomen, kommen wir nicht durch, oder wir müssten diesen Vorgang zugleich vollziehen und beobachten können. Das scheint unmöglich zu sein. Was geschieht wirklich? Zunächst ist festzustellen: unser Denken erzeugt nur dann seine Begriffe, wenn ihm in irgendeiner Weise eine konkrete Wahrnehmung entgegentritt, also ein Objekt, das sozusagen von außen kommt oder so erscheint, sei es uns vorgegeben. Worüber wir auch Begriffe bilden mögen, zuerst muss uns eine Wahrnehmung gegenübertreten, an der sich das Denken entzündet, um einen passenden Begriff zu erzeugen. Ohne Anstoß von „außen“ würde es in ewiger Ruhe verharren, also niemals aktiv werden, d.h. wir könnten von seiner Existenz nichts erfahren. Ohne dieses vorgegebene Widerlager, worauf ja der Begriff „Wahrnehmung“ (in immer noch unklarer Weise) zielt, wird unser Denken nicht tätig. Und wenn es tätig wird, produziert es etwas, das wie jede andere Wahrnehmung vor uns steht, wie ein Gegenstand, der sich nur darin von so vielen anderen unterscheidet, dass wir selbst seine Erzeuger sind. Und wir müssen uns dem so plötzlich Erscheinenden gegenüberstellen, können unsere Aufmerksamkeit darauf richten und darüber nachdenken, was es mit diesem „Objekt“ auf sich hat, das in so „fragwürdiger Gestalt“ wie der Geist im „Hamlet“ vor uns hintritt. Aber wie wir uns auch verhalten, wie lange wir auch beobachten und rätseln: dieser persönliche Willensvorgang fügt nichts Neues zu den beiden Grundelementen des Bewusstseins hinzu, „Begriff“ und „Wahrnehmung“ in ihrer charakteristischen Existenz bleiben unangetastet. Wir umkreisen diese beiden Phänomene, um neue dazugehörige Begriffe zu bilden. Es gibt keine andere Möglichkeit: der Blitz des Gedanken entzündet sich am Widerlager der „Wahrnehmung“, wobei es völlig gleichgültig ist, ob es sich um „innere“ oder „äußere“ Wahrnehmungen handelt, d.h. wir bewegen uns immer in konkreten „Gegenüberstellungen“, deren Entstehungsweise zunächst keine Rolle zu spielen braucht. Begriffe wie „Wahrnehmungsakt“, „Vorstellung“, „Schein“ und „Erscheinung“ sind bereits Resultate langer theoretischer Überlegungen und haben hier noch gar nichts zu suchen. Wir wissen überhaupt noch nicht, in welchem Zusammenhang unser Doppelphänomen mit uns und anderen Welttatsachen steht. Wir bewegen uns ausschließlich in Gegenüberstellungen, die sich, wie wir wissen, miteinander verbinden, ohne uns zu verraten, wie diese Verbindung zustande kommt und welches endgültige Ziel sie verfolgt.
Eins aber ist gewiss: wenn uns Objekte, also Phänomene der Gegenüberstellung, als sog. „Widerlager“ entgegentreten, dann müssen wir sie mit den Kräften der Aufmerksamkeit beobachten, um Begriffe zu bilden, d.h. wir müssen beobachten und denken. Zur bereits vorhandenen Wahrnehmung, wie sie auch entstanden sein mag, produzieren wir das begriffliche Element, das wir als Komplettierung der Wahrnehmung empfinden - und zwar ohne Rücksicht darauf, ob uns materielle, psychische oder mentale „Gegenstände“ (physische Raumgestalten, Gefühle oder Begriffe und Gedanken) entgegentreten. Für die materielle Seite hat Rudolf Steiner am Beispiel des Billardspiels dieses Verhältnis klar zu machen versucht. Er schreibt:
„Wenn ich beobachte, wie eine Billardkugel, die gestoßen wird, ihre Bewegung auf eine andere überträgt, so bleibe ich auf den Verlauf dieses beobachteten Vorganges ganz ohne Einfluss. Die Bewegungsrichtung und Schnelligkeit der zweiten Kugel ist durch die Richtung und Schnelligkeit der ersten bestimmt. Solange ich mich bloß als Beobachter verhalte, weiß ich über die Bewegung der zweiten Kugel erst dann etwas zu sagen, wenn dieselbe eingetreten ist. Anders ist die Sache, wenn ich über den Inhalt meiner Beobachtung nachzudenken beginne. Mein Nachdenken hat den Zweck, von dem Vorgange Begriffe zu bilden. Ich bringe den Begriff einer elastischen Kugel in Verbindung mit gewissen anderen Begriffen der Mechanik und ziehe die besonderen Umstände in Erwägung, die in dem vorkommenden Falle obwalten. Ich suche also zu dem Vorgange, der sich ohne mein Zutun abspielt, einen zweiten hinzuzufügen, der sich in der begrifflichen Sphäre vollzieht. Der letztere ist von mir abhängig. Das zeigt sich dadurch, dass ich mich mit der Beobachtung begnügen und auf alles Begriffesuchen verzichten kann, wenn ich kein Bedürfnis danach habe. Wenn dieses Bedürfnis aber vorhanden ist, dann beruhige ich mich erst, wenn ich die Begriffe: Kugel, Stoß, Geschwindigkeit usw. in eine gewisse Verbindung gebracht habe, zu welcher der beobachtete Vorgang in einem bestimmten Verhältnisse steht. So gewiss nun ist, dass sich der Vorgang unabhängig von mir vollzieht, so gewiss ist es, dass sich der begriffliche Prozess ohne mein Zutun nicht abspielen kann.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. 15. Auflage Dornach 1987, S. 36)
Er fährt dann vorläufig einschränkend fort:
„Ob dieses Tun in Wahrheit unser Tun ist oder ob wir es einer unabänderlichen Notwendigkeit gemäß vollziehen, lassen wir vorläufig dahingestellt.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. 15. Auflage Dornach 1987, S. 37)
Daraus ergeben sich die Konsequenzen von selbst:
„Beim Zustandekommen der Welterscheinungen mag das Denken eine Nebenrolle spielen, beim Zustandekommen einer Ansicht darüber kommt ihm aber sicher eine Hauptrolle zu.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. 15. Auflage Dornach 1987, S. 39)
Diese Überlegungen schließen das wichtige Problem der Ableitungsmöglichkeit des Denkens ein, mit dem wir uns noch beschäftigen werden.
Damit haben wir alles in der Hand, um den Ausgangspunkt aller Wissenschaft und Philosophie formulieren zu können. Wir folgen wieder Rudolf Steiner:
„Beobachtung und Denken sind die beiden Ausgangspunkte für alles geistige Streben des Menschen, insofern er sich eines solchen bewusst ist. Die Verrichtungen des gemeinen Menschenverstandes und die verwickeltsten wissenschaftlichen Forschungen ruhen auf diesen beiden Grundsäulen unseres Geistes. Die Philosophen sind von verschiedenen Urgegensätzen ausgegangen: Idee und Wirklichkeit, Subjekt und Objekt, Erscheinung und Ding an sich, Ich und Nicht-Ich, Idee und Wille, Begriff und Materie, Kraft und Stoff, Bewusstes und Unbewusstes. Es lässt sich aber zeigen, dass allen diesen Gegensätzen der von Beobachtung und Denken, als für den Menschen wichtigste, vorangehen muss.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. 15. Auflage Dornach 1987, S. 38)
So weit Rudolf Steiner. Man kann ergänzend hinzufügen, dass jedes der soeben genannten Gegensatzpaare selbst erst ein Ergebnis der Beobachtung und des Denkens ist. Wegen der zentralen Bedeutung dieser Grundtatsache erlauben Sie mir eine nützliche und einprägsame terminologische Kurzfassung, die ich von jetzt an verwenden werde: ich nenne diese ursprüngliche Ausgangssituation „Denkbeobachtung“, um beide Elemente in einem einzigen Wort festhalten zu können. Damit besitzen wir eine praktikable Bezeichnung für das methodologische Urphänomen aller Wissenschaft und Philosophie, der Naturwissenschaften wie der Geisteswissenschaften. Und dieses Urphänomen ist von den Naturwissenschaftlern weit besser in Rechnung gestellt worden als von den Geisteswissenschaftlern. Daher die großen theoretischen und praktischen Erfolge, mit denen die materiologischen Erkenntnismethoden aufwarten können. Gewiss ist die Untersuchung so universeller und immer noch unbestimmter Phänomene in den sog. „humanities“ (Geist, Seele, Geschichte, Gesellschaft usw.) weitaus komplexer und schwieriger als alle materiellen Prozesse zusammen, die wir bis dato kennen, aber trotzdem bleibt festzuhalten, dass die Geisteswissenschaften eine methodologische Weiterentwicklung zum „experimentell“ orientierten Denken (zum „aktologischen Versuch“) auf Gebieten, die dafür offen stehen, nicht in Angriff genommen haben. Was im Wege stand, war, wie bereits gesagt, die axiomatologische, dialektische und nicht selten die bloß verbalistische Interpretationskunst, die immer wieder ins Schwimmen geriet, und dann die wachsende Tendenz zur „Logifizierung“ aller Wissenschaftsbereiche, ein Vorgang, der sich dann zu weltfremden Glasperlenspielen verengt, wenn der Mensch als Objekt der Erkenntnis eliminiert wird. Das Urphänomen der „Denkbeobachtung“, von dem wir ausgehen, zeigt einen grundverschiedenen Ansatz: ein lebendiges, aber analysierbares Aktgewebe, das wir nach allen Seiten handhaben können, also geistige Tätigkeiten, die sich grenzenlos erweitern und variieren lassen. An diesem Anfang steht kein Prinzip, kein Axiom, keine Kategorie und schon gar keine Hypostase, wir gehen von einer durchschaubaren Tätigkeit des menschlichen Geistes aus, die wir logisch und praktisch in den Griff bekommen wollen. Dabei wird sich zeigen, ob diese „Seelischen Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode“ nur in die empirische Psychologie gehören oder darüber hinaus auch epistemologische Qualitäten aufweisen.
9. Das Denken als Objekt der Beobachtung
Wir wissen, dass wir denken, und wissen, dass wir gedacht haben. Was wir das Urphänomen der Denkbeobachtung nennen, kann selbst nichts anderes als eine denkend herbeigeführte und begriffene Beobachtung sein. Es erweist sich als sinnlos, von „Fakten“ zu sprechen, deren Vaterschaft nicht im Denken liegt. Damit ist der Angriff auf den „Mythos des Gegebenen“ zunächst gerechtfertigt. Gehen wir so weit, das Denken selbst zum Objekt der Beobachtung zu machen, dann geraten wir in die berühmte „Zirkularität“ des Denkens über das Denken, vor der wir kapitulieren müssen. Wir leben immer in Begriffen und Begriffsrelationen: auch „denken“ und „beobachten“ sind Begriffe, die wir miteinander in Verbindung bringen müssen, wenn wir Erkenntnisse erlangen wollen. Damit werden alle „Fakten“ zu Theoremen, und diese Theoreme treten uns wieder als „Fakten“ gegenüber - zumeist aber so, dass wir das ideelle Element verschlafen. Wenn wir es trotzdem zur Kenntnis nehmen, wächst die Verwirrung ins Ungemessene, und wir werden Verständnis dafür aufbringen, dass sämtliche erkenntnistheoretischen Bemühungen in Verruf geraten sind. Unlösbare Probleme soll man liegen lassen.
Es könnte aber sein, dass diese Probleme auch noch eine andere, besser zugängliche Seite zeigen, die bisher so gut wie nicht beachtet worden ist - und zwar aus dem scheinbar so einleuchtenden Grunde, weil man nicht in so etwas wie den „Psychologismus“ der Jahrhundertwende zurückfallen wollte. Dagegen ist nichts zu sagen. Die damalige Form des „Psychologismus“ ist zweifellos überholt und unfruchtbar. Aber es gibt andere Wege, die unmittelbar in das Erkenntnisproblem hinüberleiten und einen Zusammenhang aufschließen, der uns weiterhelfen kann. Da ist zunächst das Problem der Beobachtbarkeit des Denkens, von dem jeder weitere Schritt abzuhängen scheint: man kann nichts erkennen, das uns nicht in irgendeiner Weise als Wahrnehmbares gegenübertritt. Um diese Überlegung kommt niemand herum. Aber es stellt sich hier die Frage, ob wir deshalb auch schon berechtigt sind, das weitere Nachforschen aufzugeben. Gehen wir diesem Problem etwas nach.
Sie alle wissen, dass das Denken kein Gegenstand ist, den man wie eine Blume betrachten und begutachten kann. Schon der erste Schritt in diese Richtung führt ins Nichts. Rudolf Steiner äußerst sich dazu mit großem Nachdruck, um klarzumachen, dass wir uns in einer unmöglichen Situation befinden, wenn wir das Denken beobachten wollen. Er äußert sich dazu folgendermaßen:
„Ich kann mein gegenwärtiges Denken nie beobachten; sondern nur die Erfahrungen, die ich über meinen Denkprozess gemacht habe, kann ich nachher zum Objekt des Denkens machen. Ich müsste mich in zwei Persönlichkeiten spalten: in eine, die denkt, und in die andere, welche sich bei diesem Denken selbst zusieht, wenn ich mein gegenwärtiges Denken beobachten wollte. Das kann ich nicht. Ich kann das nur in zwei getrennten Akten ausführen. Das Denken, das beobachtet werden soll, ist nie das dabei in Tätigkeit befindliche, sondern ein anderes. Ob ich zu diesem Zwecke meine Beobachtungen an meinem eigenen früheren Denken mache, oder ob ich den Gedankenprozess einer anderen Person verfolge, oder endlich, ob ich, wie im vorigen Falle mit der Bewegung der Billardkugeln, einen fingierten Gedankenprozess voraussetze, darauf kommt es nicht an. Zwei Dinge vertragen sich nicht: tätiges Hervorbringen und beschauliches Gegenüberstellen.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. 15. Auflage Dornach 1987, S. 43)
So weit Rudolf Steiner. Sie können nun selbst die einzig mögliche Konsequenz aus diesen zweifellos richtigen Überlegungen ziehen. Wenn dem so ist, dann werden wir uns den Resultaten des Denkprozesses widmen müssen, also den „Erfahrungen“, die uns begegnen, wenn wir feststellen wollen, was übrigbleibt. Wir werden also auf zwei grundverschiedene Elemente verwiesen, die aber zwangsläufig miteinander in Verbindung stehen müssen: auf das Denken, von dem ich weiß, dass ich es tätig vollziehe, und auf das Ergebnis dieser Arbeit, auf das Endprodukt, dessen ich mir bewusst werde, auf die Eigengeschöpfe, die mir so gegenübertreten, als seien sie dem Haupte des Zeus entsprungen. Von diesen beiden Elementen können wir nur das eine beobachten, das andere entzieht sich unserem Zugriff. Alles, was uns sonst von „innen“ und „außen“ entgegentritt, hat zweifellos, wenn auch in verschiedenen Formen der Klarheit, den Charakter der Beobachtbarkeit. Nur das Denken ist die große Ausnahme. Damit entzieht sich die Denkbeobachtung der Denkbeobachtung. Das scheint ein endgültiges Ergebnis unserer Überlegungen zu sein. Die Frage ist nur, ob wir dabei stehen bleiben dürfen.
10. Die intermittierende Denkbeobachtung
Wenn uns nur das zweite Element des Denkprozesses in Gestalt fertiger Resultate gegenübertreten kann, dann wird uns nichts anderes übrigbleiben, als sie etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Es handelt sich also um das schwer analysierbare Phänomen der „Gegenüberstellung“, wie wir es im Anklang an Rudolf Steiners Formulierungen genannt haben. Hören wir zuerst ihn selbst:
„Unser Denken ist, besonders wenn man seine Form als individuelle Tätigkeit innerhalb unseres Bewusstseins ins Auge fasst, Betrachtung, das heißt es richtet den Blick nach außen, auf ein Gegenüberstehendes. Dabei bleibt es zunächst als Tätigkeit stehen. Es würde ins Leere, ins Nichts blicken, wenn sich ihm nicht etwas gegenüberstellte ... Dieser Form des Gegenüberstellens muss sich alles fügen, was Gegenstand unseres Wissens werden soll. Wir sind unvermögend, uns über diese Form zu erheben. Sollten wir an dem Denken ein Mittel gewinnen, tiefer in die Welt einzudringen, dann muss es selbst zuerst Erfahrung werden. Wir müssen das Denken innerhalb der Erfahrungstatsachen selbst als eine solche aufsuchen.“ (Rudolf Steiner: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung. Dornach 7. Auflage 1979, S. 29f.)
Mit anderen Worten: der bereits vollzogene, also vergangene Denkprozess hinterlässt greifbare Spuren, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, weil sie das einzig Wahrnehmbare sind, dem wir bisher im Bereich des Denkens begegnen. Ich darf Sie bitten, noch keine speziellen psychologischen Vorstellungen mit den sprachlichen Ausdrücken, die wir verwenden, verbinden zu wollen. Wir treffen keine empirischen Feststellungen über den genauen psychischen Ablauf der Vorgänge, die zu dem führen, was wir „Gegenüberstellung“ nennen, d.h. wir reden nicht von „Wahrnehmungsorganen“, von denen wir ohnehin nichts wissen, wir bedienen uns einer metaphorischen Sprache, wozu auch die Begriffe „Auge“, „Leere“ und „Nichts“ gehören. Es wird Ihnen nicht schwer fallen, das Phänomen der Gegenüberstellung als die reale und erfahrbare Situation zu betrachten, in der wir uns immer schon befinden, wenn wir denken wollen. Wie sie zustande kommt, soll uns später im Rahmen des Möglichen beschäftigen. Was wir aber hier schon feststellen können und was unmittelbar durch sich selbst einleuchtet, ist die Tatsache, dass es nur dort Gegenüberstellungen geben kann, wo sich ein Ich befindet. „Ich“ und „Gegenüberstellung“ sind korrelative Begriffe und damit die genuine Form einer unausweichbaren Situation, die völlig unabhängig davon ist, wie man sie interpretiert. Uns interessiert hier ausschließlich, was uns innerhalb des Denkprozesses gegenübertritt, und zwar in einer Weise, dass die Philosophie so häufig in Versuchung geriet, dieses Etwas als ein Gegenständliches einzuführen, das aus und für sich selbst existiert. Dieser „Platonismus“, wie man heute sagt, war nicht in der Lage, die verwunderliche Gegenständlichkeit der begrifflichen Gegenüberstellung zu durchschauen, und zwar deshalb nicht, weil er sich vom scheinbaren Dingcharakter der Begriffe hat täuschen lassen. Und zunächst ist der Eindruck dieser Dinglichkeit ja tatsächlich vorhanden. Wir wollen hier noch nicht untersuchen, worauf er in Wahrheit beruht. Was uns innerhalb des Denkens gegenübertritt, das sind Begriffe, von denen wir glauben, dass wir sie von den raumzeitlichen Vorstellungen trennen und isolieren können. Aber wir wissen noch nicht, was Vorstellungen überhaupt sind. Trotzdem bleiben wir bei dem „Begriff des Begriffs“, weil wir gezwungen sind, ihn irgendwie zu denken.
Die Denktätigkeit, so hatten wir festgestellt, bringt Begriffe hervor, sog. Resultate, mit denen wir uns befassen können, während der Vorgang des Produzierens, die Entstehung der Begriffe, sich jeder Beobachtung entzieht. Es gibt demnach ein Denken und ein Gedachtes, eine Tätigkeit und ein fertiges Ergebnis - und dieses „Gedachte“ wollen wir der leichteren Verständigung halber als Kogitat bezeichnen. Kogitate sind die Resultate der Denktätigkeit, das zweite Element des Denkens, und zwar das einzige, das in die Gegenüberstellung übergeht und der mehr oder weniger klaren „Betrachtung“ offensteht. Damit erhalten die Begriffe prinzipiell denselben Wahrnehmungsstatus wie alle anderen Wahrnehmungen aus der Seelen- und Sinnenwelt, den Status der Gegenüberstellung, mögen die psychologischen Unterschiede sein, wie sie wollen. Um wenigstens einen Anhaltspunkt zu haben, wo sich diese Kogitate nach ihrem Entstehungsvorgang in der psychischen Sphäre des Menschen niederlassen, um wahrgenommen (ins Bewusstsein gehoben) werden zu können, wollen wir wieder einen metaphorischen Ausdruck verwenden, der allerdings einen realen Vorgang bezeichnen soll, obwohl wir nicht in der Lage sind, seine empirische Struktur zu analysieren. Wir dürfen als unmittelbare Parallele das Erinnerungsvermögen heranziehen, das Vergangenes in Vorstellungen festhält, die wir im Bedarfsfall je nach Zusammenhang reproduzieren können, wenigstens so häufig, dass die Kontinuität unseres Lebens gewahrt bleibt. Kein Psychologe kann Ort und Stelle angeben, wo die Erinnerungsbilder aufbewahrt werden. Lassen Sie mich deshalb eine metaphorische Aussage machen, die den prinzipiellen Sachverhalt wiedergibt, ohne empirische Strukturen aufdecken zu wollen. Wenn der Begriff geboren wird, muss er irgendwo in die Erscheinung treten, wenn wir etwas von ihm wissen sollen. Wir können von einer seelischen Bildwand sprechen, auf die das tätige Denken seine Resultate „projiziert“, damit sie wahrnehmbar werden. Worum es sich faktisch handelt, wird wohl schon deshalb niemand angeben können, weil diese Prozesse im Verborgenen ablaufen. Der Begriff „Bildwand“ hat also lediglich die Aufgabe, darauf aufmerksam zu machen, dass die Gegenüberstellung nichts anderes als die Endphase eines psychischen Vorgangs ist, von dem wir nur hoffen können, dass er eines Tages analysiert wird. Jede Gegenüberstellung beruht auf einem Realprozess - mehr wollen wir nicht sagen.
Nun sind wir berechtigt, die begriffliche Gegenüberstellung eine selbstproduzierte Wahrnehmung zu nennen, ein Eigenprodukt mit dem Charakter der Objektivität. Und unsere früheren Äußerungen über den Inhalt unseres Bewusstseins, den wir, wie Sie sich erinnern werden, auf die Phänomene „Begriff“ und „Wahrnehmung“ reduziert hatten, scheinen ins Wanken zu geraten. Das ist aber nicht der Fall. In Wahrheit reden wir von Beziehungen, die sich ergeben, wenn man die Tätigkeit des Denkens, das Produzieren von Begriffen, mitansetzt, also etwas erschließt, was der Beobachtung unzugänglich ist. Nehmen wir diesen Denkprozess als untrennbares Ganzes, dann ergibt sich die Polarität, auf die wir hinauswollen und die wir bereits in anderem Zusammenhang angedeutet hatten. Wir sprachen in etwas umständlicher Weise von den beiden Polen: „Befriedigendes Selbstgetanes“ und „Unbefriedigendes Nichtselbstgetanes“, um eine verborgene Korrelation anzudeuten, die wir später aufdecken wollen. Diese beiden polaren Gegensätze lassen sich aber auch anders formulieren, wenn wir das, was wir unausgesprochen mitdenken müssen, gesondert herausheben: ich meine das menschliche Ich, das ja in jeder Wortverbindung mitgedacht wird, in der das Wörtchen „selbst“ vorkommt. Begriffe wie „Selbsttätiges Denken“, „Selbstgetanes“ u. a. enthalten auch den Begriff des „Ich“, den wir automatisch mitdenken; und wir brauchen ihn erst recht, wenn wir uns an den erwähnten Sachverhalt erinnern, dass wir beim Denken - und nur beim Denken - dabei sein müssen, wenn etwas geschehen soll. Mit anderen Worten: wir meinen das vielberedete Phänomen, das so viel Verwirrung gestiftet hat und das man gemeinhin als „Subjektivität“ bezeichnet. Wegen seiner Simplizität verführt dieser Ausdruck zu unberechtigten Schlüssen: so werden das Ich, das Denken, Fühlen und Wollen gar zu gerne als einheitliches Ganzes, eben als „Subjekt“, betrachtet, dem eine andersartige „objektive“ Außenwelt gegenübersteht. Diese Auffassung beruht, wie wir noch im einzelnen sehen werden, auf einer Selbsttäuschung ersten Ranges, die unmögliche Philosophien hervorgebracht hat. Nach unseren bisherigen Untersuchungen können wir lediglich feststellen, dass sich Prozesse vollziehen, von denen ein Teil nur zustande kommt, wenn wir unmittelbar „dabei“ sind. Noch sind wir nicht in der Lage, eine Entscheidung darüber herbeizuführen, ob es sich um „subjektive“ oder um „objektive“ Vorgänge handelt, sofern diese Begriffe überhaupt einen Sinn haben. Wenn wir von einem „Subjekt“ reden wollen, bleibt uns nichts anderes übrig, als jenes undefinierbare Element, das immer in diesen Begriff eingeschlossen ist, mitzudenken, nämlich das menschliche „Ich“ - obwohl wir nicht wissen, was es ist. Aber wir erfahren es in einer sehr konkreten Weise: es offenbart sich als jenes aktive Etwas, das alle genannten Denkprozesse in Gang bringt und mit solch erstaunlicher Willkür handhabt, dass wir das unmittelbare Erlebnis der persönlichen „Freiheit“ erhalten. Dieses Aktionselement ist unverzichtbar, und wir wollen es, dem allgemeinen Sprachgebrauch entsprechend, das menschliche „Ich“ nennen, auch wenn wir noch nicht so weit sind, genauere Angaben darüber vorlegen zu können. Wir entdecken es im Zusammenhang unserer Beobachtungen als zentrales aktologisches Element, als Quelle von Willensstößen, die jede Art von Begriff und Wahrnehmung in Bewegung bringt, mit dem Drang, immer neue Beziehungen herzustellen, um mit ihnen zu arbeiten, wie es ihm passt. Dieses Wollen müssen wir gelten lassen. Es wäre verfehlt, bereits kausalistisch zu argumentieren, von „Gehirnprozessen“ oder von einem „Unbewussten“ zu reden, wie es uns unser naturwissenschaftlich überformtes Bewusstsein suggerieren möchte. Wir schildern Phänomene, die wir vorfinden, und enthalten uns theoretischer Schlussfolgerungen, die nicht aus der Sache hervorgehen.
Damit erhellt sich die ursprüngliche Polarität des menschlichen Bewusstseins. Auf der einen Seite steht die „Ich-Organisation“, wie wir von jetzt an das Zusammenspiel von Willenszentrum, Beobachtung und Denktätigkeit nennen wollen, auf der andern Seite steht die Fülle der vorgegebenen Wahrnehmungen, innen und außen, einschließlich des Sonderfalls der „selbstproduzierten Wahrnehmungen“, also der fertigen Begriffe, die uns gegenübertreten. Im Zentrum der Ich-Organisation befindet sich das, was wir unser „Ich“ nennen - und dieses Ich ist der eigentliche Mittelpunkt der ersten Seite der Polarität und kann Ich-Pol genannt werden, wenn wir das folgende berücksichtigen. Das Ich hebt sich aus der Ich-Organisation deshalb heraus, weil es sein eigenes Verhalten in Begriffe fasst und damit objektiviert. Auf diese Weise steht es den Phänomenen, die wir beschrieben haben, in einer (bald näher zu bestimmenden) aktiven Freiheit gegenüber und geht mit seinem aktologischen Umfeld immer wechselnde Verbindungen ein, die einem gewissen Rhythmus unterliegen, d.h. die scheinbar statische Polarität von Ich und Gegenüberstellung aktualisiert sich im konkreten Prozess der Denkbeobachtung, die wir zum methodologischen Ausgangspunkt gemacht hatten. Beide Phänomen erhellen sich gegenseitig und verweben sich zu einem Aktgefüge, das wir handhaben können. Wir dürfen jetzt diesen Sachverhalt auch einmal ganz simpel aussprechen, ohne missverstanden zu werden: das Ich bemächtigt sich denkend seiner Wahrnehmungsobjekte, setzt sich tätig mit ihnen auseinander und findet die bereits erwähnte geistige „Befriedigung“, wenn es ihm gelingt, eine ideelle Ordnung herzustellen, die etwas von dem hat, was als Wahrheit gilt. Und noch einmal anders: Denken ist immer Handeln, ja sogar die Urform des Handelns, von der feinsten Begriffsbildung bis zur schlichtesten praktischen Tätigkeit in allen ihren Formen, in allen möglichen materiellen Vermittlungen. Denken ist Arbeit.
Wie sieht nun diese aktologische Arbeit aus? Um das festzustellen, brauche ich mich nur auf Ihre täglichen Erfahrungen zu berufen, die sie alle machen, auch wenn Sie sich ihrer nicht immer bewusst werden. Ich bin sicher, Sie haben den lebendigen Pendelschlag Ihres Bewusstseins, das tätige Hin und Her zwischen Ich und Umwelt, die rhythmischen Übergänge von dem einen zum andern zuweilen so intensiv erfahren, dass Sie deutlich gewahr wurden, was in Ihnen vorgeht. Ich sage Ihnen also nichts Neues. Aber die Frage ist, ob Sie bereits die ganze Bedeutung dieser Vorgänge eingesehen haben. Wir werden sie im Laufe der Zeit noch genauer kennenlernen. Heute beschränken wir uns auf einen grundlegenden Zusammenhang, den wir hier bereits brauchen. Wenn das Ich beobachtend tätig wird, entfaltet es eine einzigartige Hingabefähigkeit, die weitreichende Konsequenzen hat. Es tritt etwas ein, was schwer zu begreifen ist und kaum untersucht wird: das Ich verliert sich in seinem Objekt, das es erkennend ergreifen will, und zwar bis zur Selbstaufgabe, bis zur „Selbstvergessenheit“, wie wir richtig sagen. Es verliert, bis zu einem gewissen Grade, sein Selbstbewusstsein, seine Identifikation, weil es sich mit dem Wahrnehmungsobjekt vorübergehend identifiziert. Diese Auslöschung des Selbstes hat Rudolf Steiner immer wieder, in vielfachen Zusammenhängen, nicht zu Unrecht mit dem Phänomen des Einschlafens verglichen, allerdings mit dem Unterschied, dass natürlich das Bewusstsein nicht völlig erlischt. Aber dieser Zustand ist so ausgeprägt, wenn auch nur für kurze Momente, dass eine radikale „Selbstvergessenheit“ eintritt, von der wir uns ganz selten Rechenschaft abgeben. Wir verlieren uns nahezu völlig, aber ohne irgendein Angstgefühl, das uns zurückholen möchte. Jedenfalls wissen wir nichts davon. Der etwas rätselhafte Umschwung, das „Erwachen“, kommt ganz plötzlich und wie von selbst. Mit einer nur selten kontrollierbaren Automatik schwingt das Pendel in die Ausgangslage zurück, d.h. auf die Gegenseite, zum Ich-Pol der Selbsterinnerung, zum Selbstbewusstsein - aber auch das nur einen kurzen, kaum messbaren Augenblick lang, um sich sofort wieder demselben Objekt oder einem anderen zuzuwenden, je nach Erkenntnisbedürfnis. Wie lange auch die Wiederholungen dieses Aktes, die der Begriffsbildung dienen, währen mögen, sie unterliegen einem übergeordneten Rhythmus: von Zeit zu Zeit findet eine nahezu vollständige Zurücknahme des Ichs statt, eine Abwendung von allen Einzelobjekten und Tätigkeiten, um das Gesamtresultat der bisher geleisteten Arbeit zu begutachten. Der Schöpfer betrachtet sein Werk als Ganzes. Das Gesamtresultat wird jetzt zum Objekt der denkenden Betrachtung, das Neue: die „selbstproduzierte Wahrnehmung“ stellt sich als frisch hinzugekommenes Erfahrungselement dem Denken zur weiteren Bearbeitung. Mit sich allein könnte das Ich nichts anfangen. Das Pendel muss wieder ausschlagen, aber diesmal mit der Absicht, die Gesamtsituation zu erfassen, in der sich das Ich während seiner Tätigkeit befunden hatte. Wenn wir nun voraussetzen, dass die getane Arbeit erfolgreich war, dass sich neue Begriffe gebildet haben, die zu den Objekten passen, dann wird die Ich-Organisation eine mehr oder minder bedeutsame Verwandlung feststellen: der Begriffshorizont hat sich genau um soviel Begriffe vermehrt, wie entdeckt worden sind. Eine kaum spürbare Verwandlung der Gesamtsituation hat stattgefunden. Die erste Objektbetrachtung geschah mit Hilfe der bereits vorhandenen Begriffssphäre, also aus dem Bereich, den wir manchmal „Vorinterpretation“ nennen, die zugleich ein „Vorverständnis“ ist. Nach der Totalzurücknahme findet sich die Begriffssphäre um die erworbenen Begriffe bereichert vor - und macht sehr schnell die Erfahrung, dass nun neue Möglichkeiten von Begriffsrelationen auftauchen, von denen sie vorher nichts wissen konnte. Das kann unter Umständen sogar von großer wissenschaftlicher Bedeutung sein. Aber bleiben wir bei den kleineren Resultaten. Wenn nun der denkende Betrachter seine Gesamtzurücknahme aufgibt und sich dem verlassenen Werk zuwendet, dann tut er das mit einem neuen Verständnis, das er sich durch seine Arbeit erworben hat. Er ist, wenn auch in noch so geringem Grade, wissender geworden und, wenn es hochkommt, auch um einen Schritt reifer und weiser. Er wird Erkenntnisse erlangen, die ihm bisher verschlossen waren, und damit seine Begriffssphäre noch einmal bereichern - und so weiter. An einem praktischen Beispiel lässt sich dieser Vorgang am besten illustrieren.
Nehmen Sie einen Handwerker, der sich selbst eine Maschine bauen möchte, die er auf dem Markt noch nicht auftreiben konnte, weil sie noch nicht erfunden wurde. Er wird sich zuerst gewisse brauchbare ideelle Vorstellungen machen, dann einen Werkplan entwerfen und schließlich an die Arbeit gehen. Weil er Neuland betritt, ist er sich des Risikos, das er eingeht, durchaus bewusst. Er vertieft sich in jede Einzelheit, experimentiert mit Material und Begriffsverbindungen und probt einige praktische Konstruktionen so lange durch, bis er am Ende des ersten Arbeitstages das angefangene Werk betrachtet und begutachtet. Er muss feststellen, dass ihm nicht alles so gelungen ist, wie er gehofft hatte - d.h. er entdeckt Zusammenhänge und Möglichkeiten der Konstruktion, die das Ergebnis einer fortschreitenden Begriffsbildung während der Arbeit waren. Nun vollzieht er eine „Totalzurücknahme“, setzt sein Denken mit neu erworbenen Begriffen in Bewegung, entdeckt bessere Konstruktionsmöglichkeiten und tut am nächsten Morgen, so wollen wir annehmen, den radikalsten Schritt, den es geben kann: er beginnt noch einmal ganz von vorn. Das Werkstück von gestern stellt er in irgendeine Ecke, damit es aus dem Weg ist.
Mit der Zeit werden sich in dieser Ecke unfertige oder fertige, aber unvollkommene Werkstücke ansammeln, die man in chronologischer Reihenfolge aneinanderreihen könnte, um ein genaues Anschauungsbild der Entwicklung bis zum endgültigen Produkt zu erhalten. Und ein solches Anschauungsmaterial gibt es tatsächlich, vor allem für die Erzeugnisse großer Firmen. Und wenn Sie diese Bilderfolgen gerne genießen wollen, dann betrachten Sie einmal sorgfältig die internen historischen Werksberichte oder die öffentlichen Prospekte über die Entwicklung z.B. des Fahrrads, des Automobils, des Computers oder der Betriebsmaschinen, und Sie werden eine Reihenfolge von Bildern finden, die als Vorstufen des Endproduktes eine ausdrucksvolle Sprache sprechen; beim Automobil etwa vom Postkutschengefährt bis zum modernen windgeschnittenen, rasanten Fahrzeug, in das die begriffliche Arbeit von Jahrzehnten eingegangen ist, und zwar mit allem Drum und Dran, angefangen mit den simpelsten physikochemischen Überlegungen, über den mehrfach geprüften Einbau verschiedenster Materialien auf genau berechneter ökonomischer Basis, des weiteren über die optimalen Anpassungsformen an alles und jedes - bis hin zum bestausgeklügelten Optimum des Endproduktes, in dem alle Umweltfaktoren, Naturgesetze und Stoffe sachgerecht und rationell ineinandergreifen. Das ist der langwierige Weg, auf dem sich die erste Vorstellung des geplanten Werkstücks so präzise wie möglich verwirklicht. Machen Sie sich die Mühe, einen solchen scheinbar harmlosen, historisierenden Bilderbogen in Augenschein zu nehmen, und Sie werden erkennen, wie sich der Rhythmus der Denkbeobachtung in sichtbaren Erscheinungen vor Ihnen abspielt. Jede Veränderung in den einzelnen Bildern offenbart die Begriffsbildung, die kleinen Zurücknahmen des Ichs und die immer neuen Zuwendungen zu den Objekten der Erkenntnis und Gestaltung. Und die Leerräume zwischen den einzelnen Bildern markieren die großen Totalzurücknahmen, die produktiven Gesamtunterbrechungen, also jene Vorgänge, die sich innerhalb des Geistes der Ingenieure abspielen und nicht unmittelbar in die visuelle Sichtbarkeit des konkreten Werkstücks übergehen können. Nur die herausdestillierten Resultate werden sichtbar. Natürlich greifen alle diese Prozesse tausendfach ineinander, aber immer nach demselben Grundmuster: als Spiel und Widerspiel der Denkbeobachtung. In der Bilderfolge der Produkte präsentiert sich ein Entwicklungsablauf, der sich in konzentrischen Stufen vollzieht, zwischen denen die Nullpunkte der Selbstbesinnung, der Pendelschläge zum Ich-Pol liegen, mit denen die neue Arbeit in der erweiterten Begriffssphäre ihren Anfang vorbereitet, deren Ergebnisse erst später ihren Niederschlag im Werkstück finden. Dieser Nullpunkt ist wichtig und wird uns später noch ausführlich beschäftigen.
Damit haben wir auch die praktische Seite dessen, was wir Denkbeobachtung nennen, andeutungsweise miterwähnt. Aus allen diesen Überlegungen und Schilderungen wird ersichtlich, dass es keinen gleichförmig-linearen Entwicklungsgang gibt. Alle organisierten Werdeprozesse, die der Mensch in sich selbst und in seinen Schöpfungen in Gang setzt, verlaufen intermittierend, d.h. in rhythmischen Unterbrechungen, von Pol zu Pol, vom Beobachten zum Gegenüberstellen, von der Enträumlichung zur Verräumlichung, von der „Zusammenziehung“ zur „Ausdehnung“, von der „Involution“ zur „Evolution“ - und wieder zurück. Dem Deutschen Idealismus waren diese Phänomene bekannt, ganz besonders dem großen Philosophen Hegel, der sie in mystisch logifizierender Weise in eine objektive Weltdialektik verwandelt hat. Aber nirgends lässt sich eine „Selbstbewegung der Begriffe“ wahrnehmen. Der Fall liegt so, wie wir ihn beschrieben haben: es ist einzig der Mensch, der seine Begriffe erzeugt und bewegt, und zwar in der angegeben Weise.
Wir wollen diesen Prozess des menschlichen Geistes die „intermittierende Denkbeobachtung“ nennen und versuchen, sie nach und nach genauer kennenzulernen. Sie werden auch immer besser begreifen, warum wir den Begriff „Philosophie der Denkakte“ verwenden.
11. Das bestimmungslose Denken und seine Kogitate
Natürlich werden Sie sich mit diesen Ausführungen nicht zufrieden geben und eine weitergreifende Darstellung dessen, was wir das „Denken“ nennen, erwarten. Dazu bedarf es der Hereinnahme eines neuen Begriffs.
Dazu bedarf es noch einmal einer kurzen Betrachtung dessen, was wir die „Kogitate“ genannt hatten. Nach unseren bisherigen Überlegungen sind Kogitate nichts anderes als die Resultate des Denkprozesses, die sich, so hatten wir (metaphorisch) festgestellt, auf einer psychischen „Bildwand“ eingravieren und dort wie Erinnerungen und Vorstellungen beobachtet und abgelesen werden können. Das ist natürlich eine Vereinfachung, die wir gleich korrigieren werden, aber an der Tatsache des Übergangs vom unbewusst ablaufenden Denkprozess bis hin zur bewussten Gegenüberstellung lässt sich nicht rütteln, auch wenn wir die konkreten Abläufe nicht analysieren können. Wir beschäftigen uns mit unseren Gedanken und Begriffen wie mit allen anderen Wahrnehmungen, wie mit Objekten der Außenwelt, auch wenn es uns unüberwindliche Schwierigkeiten macht, ihre substantielle Existenzform zu bestimmen. Ob wir nun „Nominalisten“ oder „Realisten“ sind, ob wir von „Fiktionen“ oder „Realwesen“ reden - sie besitzen immer die Gestalt des Gegenüber, mit dem wir uns als einer unabweisbaren Erscheinungsform unserer Welt auseinandersetzen müssen, auch dann, wenn nichts da ist, was wir mit Händen greifen können. Die Schwierigkeiten liegen in der Tatsache, dass wir, wie es den Anschein hat, gar nicht in der Lage sind, einen Begriff oder Gedanken ohne die Mitwirkung einer psychischen Vorstellung zu bilden. Daher kommen ja die diversen Ansichten von der angeblichen Identität der Vorstellungen mit den Begriffen und als Folge davon die zunehmende Bereitwilligkeit, dem Denken jede Realität abzusprechen. Schon der Begriff „Abstraktion“ suggeriert eine Philosophie des fiktionalistischen Theoretisierens, obwohl jeder Mensch weiß, dass unsere Begriffe etwas mit der realen Welt zu tun haben müssen, sonst wäre dem Menschen keine sinnvolle Orientierung in seiner Umwelt möglich. Auch kann der Begriff der „Fiktion“ nicht in sich selbst fiktiv sein, oder man hebt das Denken auf. Bei Rudolf Steiner lesen wir:
„Durch das Denken entstehen Begriffe und Ideen. Was ein Begriff ist, kann mit Worten nicht gesagt werden. Worte können nur den Menschen darauf aufmerksam machen, dass er Begriffe habe.“ (Rudolf Steiner: Philosophie der Freiheit. Dornach 15. Auflage 1987, S. 57)
Wir gehen also mit einem Etwas um, von dem wir nur wissen, dass es in uns entsteht; und vielleicht sagt uns dieser Entstehungsprozess etwas mehr über das Denken aus, als es die einzelnen Begriffe können. Begriffe sind nicht einfach da: sie werden hervorgebracht. Diese Tätigkeit des Hervorbringens, so haben wir bereits endgültig festgestellt, lässt sich aber nicht beobachten. Damit fallen wir in ein Fass ohne Boden, das für alle Spekulationen offensteht. Was geschieht in diesem Abgrund des Unbewussten? Sind es geheime Führungen, die uns eine Fata Morgana der Freiheit vorgaukeln, vielleicht sogar nur Reflexe von sog. „Gehirnprozessen“, wie uns der positivistische Zeitgeist einreden möchte, oder geschehen höhere Dinge in Form von „Eingebungen“, „Inspirationen“ und dergleichen? Keine dieser Annahmen ist berechtigt. Gehirnprozesse und Inspirationen erklären sich nicht aus sich selbst: sie sind, sofern wir uns ihrer bewusst werden, bereits Gedachtes, sind produzierte Kogitate, enthalten also, wie wir später genau analysieren wollen, das Element des Ideellen, ohne das es keine Erkenntnis gibt. Dasselbe gilt für alle metaphysischen Konstruktionen, in denen die Begriffe ohne Wahrnehmungsgrundlage mit sich selber spielen. Wir besitzen also, nach dem jetzigen Stand der Dinge, nichts, um den Abgrund der Denktätigkeit, von der wir gesprochen haben, mit greifbaren Erfahrungsinhalten zu besetzen. Aber das brauchen wir auch gar nicht. Der kausalistische Ableitungsgedanke stößt irgendwann einmal auf seine methodologischen Grenzen, oder er siecht im unendlichen Regress dahin. Es gibt logischerweise nichts vor dem Denken als das Denken selbst. Wie wir uns auch anstellen mögen, wir kommen aus dem Denken niemals heraus, ebenso wenig wie aus der Wahrnehmungswelt, ohne die wir überhaupt nicht denken könnten. Damit klärt sich ein wichtiges Verhältnis zwischen Begriff und Wahrnehmung in rein formaler Hinsicht. Den ontologischen Aspekt lassen wir noch beiseite. Begriffe beziehen sich immer und ausnahmslos auf das Besondere, auf das Individuelle, auf spezifische Objekte, die sich voneinander unterscheiden, wobei es völlig gleichgültig ist, wo und wie sie als Gegenüberstehendes auftreten, ob als Begriffe, Gedanken, Formeln, ob als Stimmungen, Gefühle und Triebe oder als raumzeitliche Gegenstände der materiellen Umwelt. Mit Hilfe des Begriffs treffen wir unsere Unterscheidungen, um ein Objekt als dieses und kein anderes identifizieren zu können. Und wenn wir ideelle Relationen (Synthesen aller Art) herstellen, dann stehen wir wieder in ganz individuellen Bezügen, die nur im jeweiligen Fall gültig sind. Daran ändert auch der „allgemeine“ Charakter der Begriffe nichts: jeder Allgemeinbegriff - und das sind alle außer den Namen - hat immer einen konkret-spezifischen Bezug auf ein Vorgegebenes, auch im Sonderfall der „selbstproduzierten Wahrnehmung“, und seien es „nur“ die subtilsten mathematischen Kogitate, die wir uns „vorstellen“ oder sogar niederschreiben, um das Gegenüber mit materiellen Mitteln zu stützen. Kogitate „an sich“, ohne spezifischen Realbezug, gibt es nirgends. Damit erschließt sich die „Denktätigkeit“ als die Produktionsstätte von ideellen Einzelgeschöpfen, deren individueller Charakter niemals aufgehoben werden kann - mit anderen Worten: das Denken ist kein Vorgang wie alle anderen, es nimmt eine ausgezeichnete, d.h. einmalige Stellung ein, die sich vorläufig nur als Negativum fassen lässt: Das Denken zeigt keine inhärenten Strukturen. Es ist unbestimmt.
Natürlich meint der Begriff „unbestimmt“ etwas anderes als die immer wieder schwer überwindbare Unklarheit oder Ungenauigkeit des menschlichen Denkens. Um solchen Missverständnissen vorzubeugen, wollen wir vom „bestimmungslosen Denken“ sprechen und damit eindeutig ausdrücken, was gemeint ist: die Strukturlosigkeit des Denkelementes, das die Begriffe produziert, also jener Tätigkeit, die wir von ihren Resultaten unterscheiden mussten. Wir entdecken keinen Vorratskasten, in dem Begriffe, Kategorien oder Prinzipien aufbewahrt sind, um bei Gelegenheit zum Vorschein zu kommen, sondern das genaue Gegenteil: ein Etwas, das die Fähigkeit besitzt, spezifische begriffliche Bestimmungen hervorzubringen, die zur Welt gehören, aber nicht unmittelbar aus den Wahrnehmungen hervorgehen. Diese Begriffsbildung richtet sich nach den Objekten, die uns gegenübertreten, und holt heraus, was sie unterscheidet und verbindet. Das ist auch der Grund dafür, dass wir die ideelle Ordnung der Dinge als objektive Weltordnung begreifen. Aber es ist nun einmal Tatsache, dass wir uns selbst als die Produzenten der Begriffe fühlen und deshalb Gefahr laufen, alles Begriffliche zum Denkinhalt zu machen oder zu Objekten zu stilisieren, die von der Erfahrungswelt grundsätzlich verschieden sind. Die berühmte Kategorientafel Kants ist ein herausragendes Beispiel für diese Auffassung, die sich gegen den Empirismus Humes wendet. Die Erfahrung bietet nichts an, was innere Notwendigkeit aufweist. Nur die sog. kategorialen Begriffe enthalten ein Element, das allem entgegensteht, was Innen- und Außenwelt zu bieten haben, die unableitbare „Denknotwendigkeit“, mit der Kant seine Erkenntnislehre begründet. Wir werden sehen, dass darin ein interessanter Trugschluss verborgen liegt, der daher kommt, dass die Kategorien aus ihrem Zusammenhang herausgehoben und als Denkbestimmungen behandelt wurden. In Wahrheit unterscheiden sich diese Kategorien in nichts von den anderen Begriffen: sie alle sind Bestimmungen, die zur Wahrnehmungswelt gehören. Und sie werden von einem tätigen Denken produziert, das über jede einzelne Bestimmung hinaus ist, sonst wäre es unfähig, Bestimmungen hervorzubringen. Nur ein Unbestimmtes kann Bestimmtes erkennen. In dem Augenblick, wo wir dem Denken eine bestimmte Struktur zuweisen, stellen wir es in eine Reihe mit allen strukturierten Wahrnehmungen und stehen vor dem unlöslichen Problem, wie es möglich sein soll, dass eine Struktur die andere erkennen soll. Kant hat sich Begriffe gegenübergestellt, die eine führende Rolle im Denken spielen, war aber nicht in der Lage, den Grund hierfür anzugeben. Er nahm sie als endgültige Strukturen des Denkens, nach denen sich die Erfahrung zu richten hat. So wird die Welt zum Spiegel einer überpersönlichen Denkstruktur, für deren Annahme keine Veranlassung vorliegt, wenn man sich die Mühe macht, von Beobachtungen auszugehen. Auch Hegel klammert sich an Begriffe, allerdings mit dem Unterschied, dass er sie „in Bewegung“ bringen will, um ihre gegenseitigen Beziehungen aufzudecken. Beiden Philosophen fehlt der Blick auf das bestimmungslose Denken, das über allen Begriffen steht, die nur spezifische Resultate seiner Arbeit sind. Kant sieht es überhaupt nicht, und Hegel, der es erlebt, setzt es kurzerhand als ontologisches Urprinzip, als sog. „Weltgeist“ an, der sich an seinen eigenen Begriffsstrukturen entwickelt und damit, entgegen allen Versicherungen, die Menschen in Begriffe verwandelt, wie seine mystifizierende Logik eindeutig beweist. Wir können hier schon feststellen: es gibt kein dialektisches Denken, auch wenn wir zweifellos polarisierte und korrelative Begriffe handhaben müssen. Dialektische Bewegungen gehören - und hier war Karl Marx im Recht - der Erfahrungswelt an, werden begrifflich erfasst, d.h. erkannt und von unserem Ich in Freiheit „bewegt“. Kein Weltgeist dirigiert uns. Wenn das Denken selbst dialektisch wäre, könnte es immer nur die jeweilige Position oder Gegenposition beziehen und müsste ganz und bewusstlos in ihr aufgehen und automatisch weitere Positionen hervorbringen, ohne irgend etwas davon zu wissen. Schon die Tatsache, dass Hegel von „Dialektik“ spricht, zeigt das wahre Verhältnis des bestimmungslosen Denkens zu seinen Begriffen: es ist sozusagen neutral, es steht über allen seinen Produkten, es ist in diesem Sinne weder logisch noch alogisch, auch nicht dialektisch, sondern überlogisch und universell. Es wäre allerdings unzulässig, von einem „Metadenken“ zu reden, weil das bestimmungslose Denken und die Produktion von Begriffen doch nur so verstanden werden können, dass sie unmittelbar ineinandergreifen, d.h. dass sie zwei Aspekte eines Geburtsvorgangs sind, die wir nur begrifflich auseinanderhalten dürfen, während sie realiter als höhere Einheit gelten müssen - auch wenn sich dieser Prozess aus naheliegenden Gründen nicht mehr analysieren lässt. Aber wir werden noch manches hinzufügen können.
Was geschieht nun rein aktologisch, wenn wir denken? Lassen Sie es mich einmal in der folgenden Weise sagen. Das bestimmungslose, in sich selbst neutrale Denken bringt Begriffe hervor, wenn ihm von „außen“ kommende Wahrnehmungen entgegentreten, mit denen es sich ideell auseinandersetzen muss. Diese neugeschaffenen Begriffe nehmen sofort die Gestalt von Gegenüberstellungen an und werden als „selbstproduzierte Wahrnehmungen“, als „Objekte“ unter Objekten behandelt, wie alle anderen, die wir begreifen wollen. Was tun wir nun? Wir unterbreiten die neuen Begriffs- und Sachzusammenhänge, d.h. unsere ideell geordneten Vorstellungen, wiederum dem bestimmungslosen Denken, um neue begriffliche Bestimmungen zu produzieren, mit denen dann in willkürlicher Folge immer dasselbe geschieht. Hier begegnen wir wieder der „intermittierenden Denkbeobachtung“, aber in deutlicheren Umrissen. Die unklar gebliebene „Denktätigkeit“, die unsere Begriffe hervorbringt, wenn das Ich den Anstoß gibt, erweist sich als die Arbeit des bestimmungslosen Denkens. Wenn wir den Pendelschlag vom Ich zur Gegenüberstellung in Gang bringen, aktivieren wir einen komplizierten Prozess auf der Seite des Ich-Pols, der die scheinbaren Gegensätze überbrückt. Wir arbeiten mit einem überlogischen Etwas, dem wir noch auf die Spur kommen wollen. Aber eine wichtige Schlussfolgerung können wir bereits ziehen, die weitreichende Folgen hat. Sie entsinnen sich des unlösbaren Problems der epistemologischen „Zirkularität“, von der wir einmal kurz gesprochen hatten: ich meine die Anwendung des Denkens auf das Denken, der Logik auf die Logik, desselben auf dasselbe - also jenen Kreislauf, den wir in logischer Hinsicht als widerlogisch ansehen müssen. Ich möchte es kurz machen: diese epistemologische Zirkularität existiert überhaupt nicht. Sie ist ein Scheinproblem, das dadurch zustande kommt, dass man von einem Denken ausgeht, das bereits in sich selbst logische Strukturen besitzt, denen zugemutet wird, sich auf sich selbst anzuwenden, sich also am eigenen Schopf aus dem Sumpfe zu ziehen. Strukturen, so sagten wir, können keine Strukturen erkennen. Was geschieht, ist etwas ganz anderes. Wenn ein Logiker sich Begriffsrelationen der reinen Logik zuwendet, um weitere logische Beziehungen aufzudecken und zu interpretieren, dann geht er von bereits fertigen Begriffen aus, von vorher produzierten Resultaten der Denktätigkeit, also von vorgefundenen Objekten, die eine begrifflich-logische Gestalt haben - und tut das Folgende: er unterbreitet sie dem bestimmungslosen Denken, um neue Begriffe oder Begriffskombinationen zu erhalten, die in der Lage sind, das logische Bezugssystem, mit dem er sich abquält, näher zu bestimmen. Diese Bestimmungen mögen verschiedene Grundlagen haben, sie mögen die logifizierte Form der realen Weltzusammenhänge sein, aber eines ist gewiss: sie sind in keinem Fall die Offenbarung von immanenten Strukturen des Denkens. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Die Erkenntnistheoretiker und Logiker haben das volle Recht, ihre epistemologischen und logischen Untersuchen anzustellen, sie geraten mit ihrem Denken nicht in Widerspruch, wenn sie nicht die Torheit begehen, ihre Begriffe und Begriffsbeziehungen für das Denken zu halten.
Mit diesen Überlegungen gerät auch die moderne Sprachphilosophie in ein neues Licht, das uns noch beschäftigen soll. Damit haben wir alles zusammengetragen, was wir brauchen, wenn wir das Denken untersuchen wollen. Wir werden aber einen neuen Ansatz machen, um unser Problem von einer anderen Seite angehen zu können. Vielleicht lässt sich alles, was uns bisher begegnet ist, noch besser begründen, wenn wir einen Stellungswechsel vornehmen.