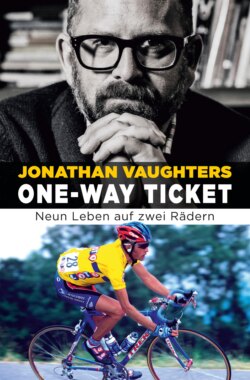Читать книгу One-Way Ticket - Jonathan Vaughters - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 1
Allerletzter
Ich weiß gar nicht so genau, warum ich mich für mein erstes Radrennen angemeldet habe.
Ich war mies in der Schule und mies im Sport. Ich war nicht gerade ein Bewegungstalent, hatte kaum Muskeln und war einen halben Kopf kleiner als das nächstkleinere Kind in meiner Klasse. Niemand wäre auf die Idee gekommen, mich als »sportlich« zu bezeichnen. Kurzum, ich besaß das schulische und athletische Talent eines nassen Regenwurms.
Wie oder warum ich also mit zwölf Jahren beschloss, den Radsport zu meinem großen Abenteuer zu machen, kann ich nicht sagen. Aber so geschah es. An einem frühen Julimorgen des Jahres 1986 fuhren meine Eltern mit mir aus den grauen Vororten von Denver hinauf ins malerische, unter einem blauen Himmel gelegene Boulder. Ich nahm am Red Zinger Mini Classic teil, einem einwöchigen Etappenrennen für Kinder, das dem berühmten Coors Classic nachempfunden war.
Die erste Etappe war ein Zeitfahren. Ich war mit dieser Disziplin nicht so recht vertraut und fragte mich, ob das wirklich das war, worauf ich mich hier eingelassen hatte: ganz für mich allein über eine einsame Straße zu fahren. Ich bemerkte, wie nervös und fokussiert meine Mitstreiter waren, und zog mich auf den Rücksitz unseres Kombis zurück und balgte mit Angie, unserem knuddeligen Bedlington-Terrier. Vielleicht war ich doch eher ein Radfahrer als ein Rennfahrer? Klar, ich liebte es, mit meinem Fahrrad herumzufahren, um Freunde zu besuchen und Mädchen, in die ich verknallt war. Aber um die Wette fahren? Die anderen Kinder sahen größer, fieser und stärker aus. Auf mich wirkten sie wie hungrige Wölfe.
Ich rollte verzagt an den Start, ohne überhaupt zu wissen, was auf mich zukam. Es schien eigentlich ganz simpel: Fahr so schnell du kannst die acht Kilometer von A nach B. Aber wie es in meiner Natur lag, hatte ich mir viel zu viele Gedanken über das ganze Prozedere gemacht und hätte mich nun am liebsten in unseren Oldsmobile verkrochen und meine Eltern gebeten, mich heimzufahren. Aber ich fuhr los und begab mich auf das unbekannte Territorium eines Solorennens gegen die Uhr auf dem Highway 36. Schon bald nach dem Start wurde ich von einem anderen Fahrer überholt. Und dann, wenig später, von einem weiteren. Auch dieses Radrenn-Ding zeichnete sich für mich offenbar durch exakt den gleichen Mangel an Erfolg auf sportlicher Ebene aus, den ich mein Leben lang schon zu genüge kennengelernt hatte. Ich war langsam. Sehr langsam.
Wir waren in alphabetischer Reihenfolge gestartet und ein paar Plätze hinter mir war Chris Wherry auf die Strecke gegangen. Wherry war eine hoch aufgeschossene, gut aussehende Radsport-Legende, zumindest in der Szene der zwölfjährigen Radrennfahrer von Colorado. Er gewann so ziemlich jedes Rennen, bei dem er an den Start ging, und er flößte allen einen ungeheuren Respekt ein, auch den anderen zwölfjährigen »Superstars«, die sich auf dem lehmigen Parkplatz herumtrieben, der als Startbereich diente.
Natürlich sauste er auf dem Weg zu seinem nächsten Sieg bald an mir vorbei. Als er mich überholte, brüllte er: »Komm schon, Alter! Streng dich mal ein bisschen an!« Es war äußerst beschämend. Pflichtgemäß versuchte ich, das Tempo zu erhöhen und mit ihm mitzuhalten, was mir ungefähr 30 Meter gelang. Er ließ mich nach Luft schnappend und halb vor Scham, halb vor Schmerzen bibbernd zurück.
Ich schleppte mich über die Ziellinie. Mir war klar, dass ich mich nicht besonders gut geschlagen hatte, aber ich dachte, da Wherry mich nicht allzu früh eingeholt hatte, würde ich schon irgendwo im Mittelfeld in meiner Altersklasse gelandet sein. Ich war ein bisschen zu optimistisch.
Meine Eltern hatten ein Picknick mitgebracht, das wir zwischen dem Zeitfahren am Morgen und dem Kriterium am Nachmittag essen wollten. Wir saßen mit all den anderen Familien zusammen und warteten, dass die Ergebnisse des Zeitfahrens bekanntgegeben würden.
Ich aß ein Sandwich mit Mortadella und Käse und schlürfte eine Limo, während ich Angie heimlich mit Brocken von dem Sandwich fütterte, das ich nicht besonders mochte. Schließlich wurde an der Seite eines Klohäuschens im Park eine Ergebnisliste angeschlagen.
Schweren Herzens trottete ich mit meinem Vater hinüber, um zu schauen, wie ich mich aus der Affäre gezogen hatte. Über all die gereckten Hälse und Köpfe hinweg entdeckte ich endlich meinen Namen – ganz am Ende der Liste.
Auf dem allerletzten Platz.
Ich war am Boden zerstört und schämte mich, überhaupt da zu sein. Ich wollte nach Hause. Ich wollte nur noch weg von diesem grässlichen Ort, und zwar sofort.
Es war wie mit allem anderen, was ich versucht hatte. Ich war einfach nicht besonders gut darin. Genau wie in der Schule, genau wie bei den Spielen auf dem Pausenhof, genau wie mit meinen Versuchen, mich anzupassen und dazuzugehören. Ich hatte bei all dem versagt und nun versagte ich auch im Radsport. Ich war einfach nicht besonders gut – in allem.
Ich sprach mit meiner Mutter und sagte ihr, dass ich nach Hause wolle und zwar sofort. Ich hatte dort nichts verloren. Sie war sehr verständnisvoll und hörte einfach zu, während ich erzählte, wie schlecht ich im Radfahren sei und dass wir besser aufbrechen und nach Hause fahren sollten.
Angie spürte, dass ich aufgewühlt war. Sie trottete herüber und fing an, mich mit kleinen Hundeküsschen zu überschütten. Sie versuchte zu begreifen, was los war. Ich umarmte sie lange und hoffte, dass wir einfach abfahren würden, fort von diesem Ort und diesen Menschen.
Unterdessen waren meine Mutter und mein Vater in ein Gespräch über irgendetwas verstrickt. Es war offenkundig eine hitzige Debatte und ich schaute zu, wie mein Vater mit den Armen wedelte.
Meine Eltern hatten mit Sport nie viel am Hut gehabt. Mein Vater ist Anwalt. Er besaß eine innige Zuneigung zur Verfassung der Vereinigten Staaten und einen sehr ausgeprägten Sinn für Fairness. Seine große Liebe zur Literatur und zur Gerechtigkeit war etwas, das er an mich weitergab. Er liebte es, Menschen zu helfen, und riss sich ein Bein dafür aus, die Rechte seiner Klienten zu schützen.
Er war beliebt und geachtet. Häufig, wenn er Klienten vertrat, die sich sein Honorar nicht leisten konnten, wurden wir in Naturalien bezahlt – mit Geflügel oder Brennholz oder in Form handwerklicher Arbeiten rund ums Haus. Er ließ sich von der Idee des gleichen Rechts für alle leiten, nicht von der Liebe zum Geld.
Meine Mutter unterrichtete Kinder mit Lern- und Sprachstörungen. Sie hatte Ärztin werden wollen, aber ihr Großvater, selbst Doktor der Medizin, hatte es ihr ausgeredet mit der Begründung, der Medizinerberuf sei nichts für Frauen. Die Entscheidung, nicht diesen Weg eingeschlagen zu haben, trieb sie ihr Leben lang um.
Trotz allem gelang es ihr, für eine Frau, die in den chauvinistischen 1950er Jahren aufgewachsen war, ziemlich progressiv zu sein. Sie machte ihren Abschluss in Logopädie und konzentrierte sich zuerst auf ihre Karriere.
Sie heiratete vergleichsweise spät im Leben einen jüngeren Mann und bekam mich erst mit 38 Jahren. Meine Eltern bildeten eine beeindruckende Einheit intellektueller PS, aber ihr Sohn, der sich dem Wettkampfsport verschrieben hatte – noch dazu in einer sonderbaren Nischendisziplin wie dem Radfahren –, war ihnen ein Unbekannter.
Ich saß im Gras und schaute zu, wie sie stritten, bis sie sich schließlich einigten. Da ich wusste, wie entschieden und kämpferisch meine Mutter war, konnte das eigentlich nur bedeuten, dass wir uns anschickten, unsere Sachen zu packen und nach Hause zu fahren.
Stattdessen kam mein Vater zu mir und verkündete bestimmt, dass wir bleiben würden und dass ich zum Rennen am Nachmittag antreten würde. Ich war baff und protestierte heftig.
Dad ist eine sanfte Seele, der es fernliegt, wegen irgendetwas eine unnachgiebige Haltung einzunehmen. Er besaß die verblüffende Fähigkeit, bei jedem Thema beide Seiten zu sehen. Meistens gab er dem entschiedeneren Wesen meiner Mutter und sogar mir gegenüber nach.
Aber nicht an diesem Tag.
Er nahm sich mir zur Brust. »Wenn du etwas anfängst, dann bringst du es verdammt noch mal zu Ende«, sagte er bestimmt. »Ganz egal, ob du Erster oder Letzter bist, du gibst nicht einfach so auf. Du wirst heute Nachmittag starten und du wirst dein Bestes geben.«
Ich war fassungslos.
»Ich habe viel dafür bezahlt, damit du diesen Mist hier machen kannst, also wirst du nicht einfach hinschmeißen«, sagte er verärgert. »Kommt gar nicht in die Tüte.«
Mein Dad war der stets sanftmütige Bär und gab nie wegen irgendetwas Kontra. Es war das erste Mal, dass mein Vater mich je zu etwas gezwungen hatte. Und mit dieser einen Entscheidung veränderte er mein ganzes Leben.
Später am Nachmittag ging ich widerwillig zur zweiten Etappe des Red Zinger Mini Classic an den Start. Ich ging davon aus, vernichtend geschlagen und schnell überrundet zu werden. Ich wollte nicht dort sein und ich wollte kein Rennen fahren. Aber ich tat es, zutiefst unglücklich mit mir und der Welt.
Die Startpistole wurde abgefeuert und ich hatte Schwierigkeiten, meinen Fuß in die Pedalhaken zu fummeln. Bis zum Ende der ersten kurzen Runde kämpfte ich mich zurück ins Peloton der Pubertierenden. Irgendwie war es nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte, und in solchem Tempo um die Kurven zu brettern, machte echt Spaß. In der Tat amüsierte ich mich ganz prächtig.
Obwohl ich der schlechteste Fahrer im ganzen Feld war, fand ich Gefallen an der Sache. Es war kein Vergleich damit, in der Pause Football zu spielen und es jede Sekunde zu hassen. Nein, das hier war anders; klar, ich hatte nichts drauf, aber ich fand es toll.
Am Rande des Kontrollverlusts um die Kurven zu rasen, jagte mir das Adrenalin durch den Körper und ließ mir das Herz aufgehen. Ich konzentrierte mich ganz auf das Hinterrad vor mir und gab nicht klein bei. Die Aufgabe wurde von Runde zu Runde schwerer, aber ich biss die Zähne zusammen und weigerte mich, abreißen zu lassen.
Allmählich begann ich, andere Kinder zu überholen, die aus dem Peloton herausfielen, eins nach dem anderen. Zwar sahen sie auf dem Rad viel besser aus als ich und sie waren bestimmt auch fitter, aber ich war fähig, zu leiden – mich ein bisschen mehr zu zerreißen –, um den Anschluss zu halten. 20 Minuten zuvor hatte ich nicht einmal dort sein wollen; jetzt hatte ich einen Spaß wie noch nie in meinem Leben. Und das war für mich eine neue Erfahrung.
Binnen nur weniger Runden, auf denen ich in einem anonymen Gewerbegebiet vor den Toren von Boulder herumraste, änderte ich meine Einstellung zum Sport.
Ich wollte ein Athlet sein.
Ich wollte Radrennfahrer sein.
Der Radrennsport nahm mich vollkommen in Beschlag. Er vereinte mentale, technische, taktische und physische Aspekte. Auf einer Maschine gekonnt um Kurven zu fahren, fiel mir aus irgendeinem Grund offenbar leichter, als geschickt einen Ball zu fangen. Die kreisförmige Bewegung des Pedalierens erschien meinem allzu vergeistigten Hirn sinnvoller als die angeblich »natürliche« Bewegung des Laufens. Ich war immer noch kläglich langsam und unfit, aber ich wollte unbedingt gut sein.
In jener Woche wurde ich mit jedem Tag und mit jeder Etappe immer ein kleines bisschen besser. Ich lernte, wie man eine Kurve nimmt, wie man im Windschatten fährt, wie man sich im Peloton nach vorn arbeitet. Ich wollte alles dafür tun, ein bisschen besser zu werden, obwohl ich immer noch weit davon entfernt war, irgendetwas zu gewinnen.
Zum ersten Mal in meinem Leben gab ich nicht auf, wenn es schwierig wurde. In der Schule, in anderen Sportarten und im Leben überhaupt hatte ich nur wenig natürliche Begabung für irgendetwas nachgewiesen außer vielleicht dafür, wahllose Fakten über den Amerikanischen Bürgerkrieg auswendig zu lernen.
Tief in meinem Inneren war ich eine Kämpfernatur, aber ich hatte es nie gezeigt. Ich war nicht gut in den Dingen, in denen die meisten Eltern, und die meisten Kinder, gut sein wollten. Football, Baseball, Basketball – in allem, was mit einem Ball zu tun hatte, war ich einfach schlecht.
Ich war sehr klein und noch dazu kurzsichtig, die meisten Leute gingen daher automatisch davon aus, dass ich ein guter Schüler sein müsse, aber meine Noten waren ebenfalls miserabel. Doch dann kam der Radsport, und alles wurde anders.
Gegen Ende des Red Zinger sah ich hin und wieder sogar die Spitzengruppe. Ich hatte in der Woche gelernt, dass ich viele der Kids, die körperlich stärker waren als ich, hinter mir lassen konnte, indem ich bereit war, mir mehr abzuverlangen.
Am vorletzten Tag des Rennens gab es ein weiteres Zeitfahren, aber diesmal ging es einen größeren Anstieg hinauf. Ich hielt dies für eine perfekte Gelegenheit, die Theorie auf die Probe zu stellen und zu sehen, ob ich mich im Kampf gegen die Uhr tatsächlich bis an die Grenze verausgaben könnte.
Ich ging mit einem Elan und einer Begeisterung in dieses Zeitfahren, die ich zu Beginn der Woche nicht verspürt hatte. Ich wollte sehen, wie gut ich sein konnte, wenn ich einfach diesem perfektionistischen Drang freien Lauf ließ.
Es war so befreiend, einfach nur zu versuchen, mein Bestes zu geben, ohne mich von den ewigen »Was wäre, wenn«-Gedanken lähmen zu lassen, die mich bis dahin zurückgehalten hatten: Was wäre, wenn ich nicht der Beste wäre? Was wäre, wenn ich mich blamieren würde?
Also konzentrierte ich mich auf nichts anderes als darauf, das allerletzte Quäntchen Energie aus meinem Körper herauszuholen.
Nach anderthalb Kilometern bergauf hatte ich bereits das Gefühl, in Ohnmacht zu fallen oder mir in die Hose zu machen. Mein Körper war es nicht gewohnt, derart Vollgas zu geben. Ich hatte keine Ahnung, wie ich fast fünf weitere Kilometer durchstehen sollte. Also konzentrierte ich mich immer nur auf die nächsten zwanzig Meter und dann die nächsten zwanzig und so weiter.
Ein ums andere Mal hatte ich mit einer selbstauferlegten Qual zu kämpfen, wie ich sie noch nie verspürt hatte. Nach etwa der Hälfte der Strecke erblickte ich den Fahrer, der vor mir gestartet war. Ich war drauf und dran, ihn einzuholen. Wiederum spielte ich Spiele in meinem Kopf, sagte mir, dass ich alles aus mir herausholen würde, bis ich ihn geschnappt hätte, und dann würde ich mir eine kleine Pause gönnen.
Doch sobald ich ihn eingeholt hatte, war ich wie ein Kind, das gerade seinen ersten Pringle gegessen hat. Ich war süchtig.
Es war ein Hochgenuss, dieses unschuldige Opfer zu stellen und zu überholen. Also wollte ich mehr davon – nun wollte ich die ganze Dose. Ich machte weiter, voll und ganz konzentriert darauf, vor der Ziellinie weitere Beute zu machen. Und mein Wunsch wurde erfüllt.
Als ich auf die letzten anderthalb Kilometer ging, begannen sich weitere halblebendige Körper am Horizont abzuzeichnen. Ich holte sie alle noch vor dem Ziel ein.
Ich überquerte die Ziellinie und erbrach sofort alles, was ich noch im Magen hatte, trocken würgend wie eine Katze einen riesigen Haarballen.
Dies war etwas, was ich noch nie erlebt hatte. Es mochte schrecklich klingen, aber es fühlte sich großartig an. Ich hatte mich endlich davon befreit, es gar nicht erst zu versuchen. Ich hatte mich davon befreit, vorzeitig aufzustecken.
Erneut warteten Dad und ich geduldig am Klohäuschen darauf, dass die Ergebnisse angeschlagen würden. Die Menge war längst nicht mehr so zahlreich wie zu Beginn der Woche. Die meisten Kinder waren heimgefahren, mit leeren Händen und ein wenig erschöpft nach einer Woche Radrennen.
Ich aber fühlte mich durch und durch belebt. Ich war begeistert und wünschte mir, dass das Rennen bis zum Ende des Sommers weitergehen würde. Schließlich wurde die Ergebnisliste an der Rückseite des Dixiklos aufgehängt. Ich war auf dem zehnten Platz gelandet – ich war in den Top Ten bei einem Radrennen.
Ich hatte vierzig andere Jungs hinter mir gelassen und lag nicht weit hinter den Legenden meiner Altersklasse zurück.
Eine oder zwei Minuten lang verspürte ich reine Euphorie und Stolz. Dann, während wir zurück zum Auto gingen, wandte ich mich an meinen Vater.
»Nächstes Jahr werde ich dieses Ding gewinnen«, sagte ich zu ihm. »Wirst schon sehen, Dad, ich werde es gewinnen.«
Von da an verfolgte ich einen großen Plan. Den Plan, einen Waschlappen in einen Athleten zu verwandeln – einen Loser in einen Gewinner.
1986 gab es in den USA nicht viele Mentoren oder Trainer für Kids, die Radrennfahrer werden wollten. In Colorado gab es vielleicht hier und da ein paar Typen, die man um Rat fragen konnte, aber niemanden, der mich durch brillantes Coaching vom niedlichen Loser in einen Gewinner verwandeln würde. Das war etwas, was ich auf mich allein gestellt zuwege bringen müsste.
Das Einzige, was ich mitbrachte, war eine natürliche Begabung fürs Lesen. Sofern mich das Thema interessierte, konnte ich stundenlang lesen und alles aufsaugen wie ein Schwamm.
Lesen war für mich immer eine Flucht gewesen. Es half mir, all dem zu entfliehen: meinen Schwierigkeiten, Freundschaften zu schließen, dem ganzen Ärger in der Schule und der Einsamkeit, ein Einzelkind zu sein. Natürlich fiel das meiste, was wir in der Schule zu lesen bekamen, nicht in die Kategorie »interessant«, weshalb ich meinen Leseeifer nur selten in der Schule unter Beweis stellte.
Aber für mein neues Projekt, nämlich zu ermitteln, wie man für Radrennen trainiert, war ich bereit, Hunderttausende von Wörtern zu lesen. Ich suchte die örtliche Bibliothek und viele Buchläden auf und versuchte, mir die beste Literatur über das Training und den Radsport im Allgemeinen zu beschaffen.
Der erste amerikanische Gewinner der Tour de France, Greg LeMond, hatte ein Buch veröffentlicht, ebenso der polnische Trainer der US-Olympiamannschaft von 1984, Eddie Borysewicz, und auch die Memoiren des fünfmaligen Tour-Siegers Bernard Hinault waren in einer Übersetzung erhältlich. Mein Lieblingsbuch war Tudor Bompas Standardwerk über die Periodisierung des Trainings. Aber ich verschlang alles, was ich in die Finger bekam.
Und so lag ich also im Haus meiner Eltern auf der Couch und las unaufhörlich.
Ich lernte, wie ich die Sitzposition auf dem Rad richtig einstellte, wie ich die passenden Übersetzungen wählte, wie man zu einer Ausreißergruppe aufschloss, wie man während eines Rennens aß, wie viel man trank, wie man Kurven fuhr und wie man bremste. Ich las über Krafttraining, Intervalltraining und Ausdauertraining, darüber, wie man das Training periodisierte, und – damals ein revolutionäres Konzept – über Schwellentraining.
Binnen zwei Monaten, nachdem ich in meinem ersten Rennen auf dem letzten Platz gelandet war, lernte ich auf eigene Faust mehr als in den sechs Jahren davor in der Schule. Ich war bereit, mein Ziel in Angriff zu nehmen, das Red Zinger Mini Classic 1987 zu gewinnen und zu einer Legende in der Szene der 13-jährigen Radrennfahrer von Colorado zu werden.
Ich begann mein Training am ersten Schultag 1986. Ich ging davon aus, eine Menge Zeit zu brauchen, nur um überhaupt das Fitnessniveau aufzubauen, das die meisten Kids bereits dadurch erlangt hatten, dass sie sich generell aktiver in »normalen« Sportarten betätigten, als ich es bis dahin getan hatte. Anschließend könnte ich damit anfangen, härter und länger zu trainieren.
Im Rahmen meiner eifrigen Studien hatte ich gelernt, dass ich wohl überwiegend langsam kontrahierende Muskelfasern besaß und dass ich, um die explosive Kraft zu entwickeln, die nötig war, um tatsächlich Radrennen zu gewinnen, meine Muskelkraft steigern müsste, was ebenfalls viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Noch bevor der Sommer zu Ende war, trainierte ich bereits für den nächsten Sommer.
Meine Trainingsfahrten waren zunächst kurz und noch nicht sehr anspruchsvoll. Mein Fokus lag erst einmal darauf, im Keller meiner Eltern mit einem gebrauchten Hantelset, das mein Vater für mich gekauft hatte, Muskelmasse aufzubauen. In der Betonhöhle unter unserem Haus standen Kniebeugen, Beinstrecker und Beinbeuger auf dem Programm.
Jeden Tag machte ich mich gleich nach der Schule zu einer Ausfahrt mit dem Rad auf, ganz gleich bei welchem Wetter: Hitze, Kälte, Regen, Schnee. Die Wochenenden, die sich vorher darum drehten, mit Freunden abzuhängen und sehr erfolglos Mädchen nachzusteigen, wurden zu zwei Tagen in der Woche, an denen ich den ganzen Tag Rad fahren konnte.
Jedes Wochenende erkundete ich Straßen, die weiter und weiter vom Haus meiner Eltern entfernt waren. Das Gefühl von Freiheit war immens, denn ich reiste zu Orten, die keiner meiner Freunde je erreichen würde, ohne seine Eltern zu bitten, ihn mit dem Auto hinzufahren.
Ich stieß tiefer in die unscheinbaren Vororte vor, drang immer weiter vor in Richtung der Stadtgrenzen, in Richtung der Berge und darüber hinaus, in eine ganz neue Welt. Ich war drei, vier, fünf Stunden unterwegs, trat unermüdlich in die Pedale, erkundete die Gegend.
Meine Eltern wussten nie genau, wo ich war und ob ich sicher wäre, aber sie akzeptierten, dass ich meiner Obsession ihren Lauf lassen musste, damit ich erwachsen werden konnte. Und so brach ich also jeden Tag aufs Neue auf, auf der Suche nach meinem Traum, nach meinem Ziel, nach mir selbst. Ich liebte diese langen Fahrten, auf denen ich stundenlang davon träumen konnte, eines Tages zu gewinnen.
Aber es ging mir längst um mehr als bloß ums Gewinnen. Ich fing an, davon zu träumen, Radprofi zu werden. Im Rahmen meiner Lesestunden begann ich, immer mehr über die mystische Welt des europäischen Profiradsports zu erfahren. Und ich liebte es. Ich liebte die Helden, die Romantik, die Mühen, die Opfer, den Schmerz, den Ruhm und die Ehre.
Ich war davon verzaubert und stöberte nach allem, was ich über diese Welt der Legenden in die Finger kriegen konnte. Zusätzlich zu den Büchern trieb ich ein paar alte VHS-Kassetten auf, A Sunday in Hell zum Beispiel und ein paar dürftig aufgezeichnete CBS-Zusammenfassungen der Tour de France. Diese Videokassetten wurden zu meinem wertvollsten Besitz und ich schaute sie mir immer wieder an.
Dort wo ich aufwuchs, im Amerika der Vorstädte, war der europäische Profiradsport in den 1980er Jahren eine vollkommen unbekannte Welt, die niemanden interessierte. Meinen Freunden und meiner Familie erschien meine Obsession folglich ziemlich verrückt. Ich arbeitete unglaublich hart und verbrachte sämtliche meiner Stunden damit, von einer Karriere zu träumen, von der meine Eltern nicht einmal glaubten, dass sie überhaupt existierte.
Meine Freunde amüsierten sich über die dünnen Beinchen, die aus meinen Elastan-Shorts staken. Und wenn ich vom Training zurückkam und davon berichtete, wie weit ich mit dem Rad gefahren war, schenkten sie mir schlichtweg keinen Glauben. Sie lachten nur und widmeten sich wieder ihrem Football-Match. Ich war nichts weiter als ein seltsames, nerdiges kleines Kind. Sie dachten, ich hätte wohl den Verstand verloren und mir in den Kopf gesetzt, mir meine Andersartigkeit aus den Gliedern zu fahren. Der Traum, den ich verfolgte, war ein einsamer.
Aber in Wahrheit war ich auch vorher schon einsam gewesen.
Ich hatte in der Schule nie Freunde gefunden, zu denen ich eine echte Beziehung aufbaute. Da ich weder ein begabter Schüler noch besonders sportlich war, erwarb ich sehr wenig Respekt. Ich war der kleinste Junge in der siebten Klasse und ich wurde herumgeschubst, gehänselt und in etliche Schränke und Mülleimer gestopft.
Ich freute mich kein bisschen auf die Schule. Somit war die Einsamkeit auf dem Rad eine willkommene Abwechslung. Auf offener Straße beurteilte mich niemand wegen meiner Noten und niemand bewertete mich danach, ob ich einen Ball fangen konnte. Niemanden scherte es, dass ich nicht im Junior-Achievement-Programm war. Nein, auf der Straße zählte einzig und allein, wie schnell ich einen Anstieg hinauffahren konnte.
Durch meine Lektüre eignete ich mir viel Fachwissen über Training und Wettkampf an, doch was mir fehlte, war jegliches Know-how, wie man sich für den Radsport kleidete. Nun war das nicht so wichtig, wenn man im milden Indian Summer von Colorado trainierte, aber als im November die kalten Gebirgswinde zu wehen begannen, wurde mein Trainingsplan allmählich etwas ungemütlich.
Als die Kälte einsetzte, hielten mich meine papierdünnen Shorts überhaupt nicht mehr warm. Im gut gemeinten Versuch, Abhilfe zu schaffen, kaufte meine Mutter mir eine bollerige Jogginghose. Ich versuchte, meine Radshorts über die grobe graue Wolle zu ziehen, aber das klappte nicht. Nach der Hälfte jeder Fahrt fühlte ich mich, als würde ich auf einer nassen Windel sitzen, während die Beine der Jogginghose sich ständig in der Kette verhedderten. Zudem sah ich absolut lächerlich aus. Ich musste wie ein richtiger Radrennfahrer aussehen, auch wenn ich nur trainierte. Die Jogginghose musste weg.
Der Winter hielt Einzug in Colorado. An bitterkalten Tagen kam ich mit lilablauen Knien heim, die Hände schmerzten vom eisigen Wind. Meine Zehen waren taub, meine Finger ließen sich nicht mehr bewegen und meine Weichteile schrumpelten zusammen, um sich vor der harschen Realität zu verbergen.
Schließlich, bevor ich aufgrund von Erfrierungen bleibende Nervenschäden davontragen würde, nahmen meine Eltern mich mit in das Geschäft, wo wir auch mein Rad gekauft hatten. Wir hofften, dort eine Art superthermale Spezialkleidung zu bekommen, die mich vor dem Kältetod bewahrte.
Der Laden lag versteckt in einer austauschbaren Ladenzeile neben einer Reinigung und einem Chinarestaurant. Mir erschien er wie eine Blume in der Wüste. Er trug den hübschen Namen »A Bike Place« und gehörte einer leidenschaftlich dem Radsport verfallenen – und bisweilen verstörend manischen – italienischen Familie namens Yantorno.
Als meine Mum mit mir hineinging, um Winterklamotten zu kaufen, war das vermutlich das erste Mal, dass ihnen ein 13-Jähriger unterkam, der sich danach erkundigte, wie man bei Temperaturen unter null trainierte. Ungeachtet seiner barschen, ruppigen Art konnte man das Funkeln in den Augen von Frankie Yantorno erkennen, dem ältesten Sohn der Familie, als ich meine wahnwitzige Begeisterung für den Radsport zum Ausdruck brachte. Er sah einen Jungen, der vollkommen vernarrt war ins Radfahren, genau wie er.
Doch Frank konnte nie offen zugeben, dass er sich auch nur ansatzweise etwas aus Rennrädern oder Radsport machte.
»Warum zum Teufel willst du bei dem Scheißwetter fahren?«, sagte er, auf den Schneesturm deutend, der draußen tobte, und meiner Mutter die Schamesröte ins Gesicht treibend.
»Weil ich trainieren muss«, sagte ich. »Man muss trainieren, um zu gewinnen – oder?«
»Na, in der bescheuerten Jogginghose wirst du jedenfalls einen Scheiß gewinnen, Junge«, blaffte er. »Gottverdammt … okay, warte ein paar Minuten…«
Damit verschwand er im Hinterzimmer und schlug die Tür hinter sich zu.
Während er weg war, begann ich ein wenig den Laden zu erkunden. Es war wie im Himmel. Ich war verzaubert von den handbemalten Verstärkungen und Muffen der Colnago-Rahmen, den glänzenden Campagnolo-Kurbeln, dem Geruch von Gummi und Kettenöl, dazu die gedämpften italienischen Wortgefechte, die aus dem Hinterzimmer zu hören waren. Der Laden war mein Tor zur romantischen und glamourösen Welt des europäischen Radsports. Ich liebte diesen Ort und ich wollte Franks Schüler werden.
Schließlich kam Frank mit einem Stapel Kleidungsstücke wieder heraus. »Das hier wird dir im Leben nicht passen, Junge, aber immerhin besser als die hässliche Jogginghose – oder dir weiterhin den Schwanz abzufrieren.«
Verlegen probierte ich all die neuen Teile an. Es waren sehr exotische, mit italienischen Markennamen versehene Handschuhe, Tights und Armlinge.
Frankie hatte recht: Die Teile passten überhaupt nicht. Sie hingen ziemlich schlabbrig an mir herunter und rutschten von meinem dürren Gerippe. Aber das war mir egal – sie kamen aus Italien und dufteten förmlich nach europäischem Abenteuer.
Widerstrebend hatten sich meine Eltern von dem Gedanken verabschiedet, dass ich mir vielleicht doch einen Hund oder irgendetwas auch nur ein bisschen Normaleres unter dem Weihnachtsbaum wünschte. Ich hatte ihnen klipp und klar mitgeteilt, dass alles, was ich mir zu Weihnachten wünschte, ein wenig Kleidung war, die mich auf dem Rad warm halten würde. Zögernd reichte Mum dem grantigen Mann im Radgeschäft ihre Kreditkarte.
Bevor wir gingen, fragte ich Frankie, ob ich wiederkommen und mit ihm über den Radsport in Italien reden und vielleicht den einen oder anderen Tipp bekommen könne.
»Ich weiß einen Scheiß über Radsport oder Räder, aber vielleicht kann ich dir das eine oder andere beibringen, Junge. Jetzt hau ab und fahr dein Rad in diesem Schneesturm, du Idiot.«
In dem Moment wusste ich, dass Frankie mein neuer bester Freund werden würde.
Ich tat wie mir geheißen. Gewappnet mit italienischer Kleidung, die wetterbedingte Ausreden hinfällig machte, trainierte ich in Schneestürmen. Sobald Weihnachten vorüber war, war es an der Zeit, die harte Arbeit zu intensivieren, die nötig war, um zu gewinnen. Durch den Laden der Yantornos fing ich außerdem an, ein paar neue Freunde kennenzulernen, und einige von ihnen waren Jungs, die schon Rennen gefahren waren.
Frankie, den ich bald Onkel Frank nennen würde, merkte an, dass der einzige andere Mensch, der verrückt genug wäre, in Colorado im Januar zu trainieren, sein früherer Schwager Bart Sheldrake war. Bart war der Ex von Franks Schwester und brachte irgendwie drei Jobs unter einen Hut, zog ein Kind auf und trainierte nebenbei als einer der Top-Amateure in Colorado für richtige Rennen.
Bart hatte an den Olympia-Ausscheidungen für 1984 teilgenommen und ging in der Kategorie 1 an den Start, der höchsten Rennklasse für Amateure in den USA. Hin und wieder kam er kleinlaut in den Laden, um sein zweijähriges Kind nach der Schule bei Franks Schwester abzuholen. Frank meinte, wir sollten uns kennenlernen, also bestellte er mich eines Tages, als Bart wieder einmal Elterndienst schob, in den Laden.
Und so schlängelte ich mich durch den Schulschluss-Verkehr und begab mich zum Laden, um Bart kennenzulernen. Ich hatte tausend Fragen, wie es war, ein echter Radrennfahrer zu sein. Er sah aus wie die Radsportler, die ich in den Zeitschriften gesehen hatte: hager im Gesicht, groß, schlank und wettergegerbt.
Er wirkte nervös und im Gespräch irgendwie unbeholfen, mit seinem drolligen nasalen Lachen. Widerstrebend erklärte er sich bereit, sich von mir fast den ganzen Nachmittag über seine Erfahrungen als Radsportler ausfragen zu lassen. Noch wichtiger aber war, dass er sich bereiterklärte, gemeinsam mit mir eine Trainingsfahrt zu unternehmen.
Wenn ich mich ihm auf seiner Ausfahrt am Sonntag anschließen wollte, so machte er allerdings unmissverständlich klar, würde er kein Jammern dulden, er würde nicht auf mich warten, mir nicht helfen, sollte ich einen Platten haben, und keine Gnade walten lassen hinsichtlich des Tempos. Ich stimmte mit einem Lächeln im Gesicht zu und zählte die Minuten bis zum Sonntag, wenn ich die Chance bekäme, mit einem echten Radrennfahrer zu trainieren.
Meine Mutter geriet in Panik, als der Sonntagmorgen kam. Ich würde mich mit einem Mann, den sie nicht kannte und vor dem sie sich, wäre sie ihm begegnet, gewiss gefürchtet hätte, auf eine fast hundert Kilometer lange Radtour begeben. Warum sollte ein erwachsener Mann mit Kind so viel Zeit damit verbringen, am Wochenende bei eisiger Kälte Rad zu fahren?
Bart musste zeitig mit dem Training fertig sein, und so trafen wir uns schon um neun am Laden. Das war der frühestmögliche Zeitpunkt, um aufzubrechen, ohne auf zu viele noch vereiste Stellen auf der Straße zu treffen. Mit vor Kälte erstarrtem Gesicht gab Bart mir letzte Anweisungen.
»Hör zu, ich muss rechtzeitig zurück sein, um meinem Kind das Mittagessen zu machen, und ich werde hundert Kilometer runterreißen. Das muss ich in drei Stunden schaffen«, sagte er. »Falls du mithalten kannst, super. Falls nicht, dein Pech.«
Das Tempo, das Bart vorlegte, war mörderisch. Es gab keinen Moment, in dem ich nicht litt, nur um sein Hinterrad zu halten. Von dieser Ausfahrt hing indes eine Menge für mich ab.
Es war meine Chance, seinen Respekt zu verdienen und auch den von Frankie. Vor allem aber war es meine Chance, zu weiteren richtigen Trainingsfahrten eingeladen zu werden und von einem echten Radrennfahrer zu lernen. Ich durfte mich nicht abhängen lassen.
Mein schmächtiger kleiner Körper krümmte sich im Sattel, meine Schultern wackelten, meine Hände zerrten am Lenker und meine Beine flehten mich an, aufzuhören. Aber ich ließ Bart nicht davonziehen. Ich glaube, er war ein bisschen genervt, dass dieser zwölfjährige Hänfling es schaffte, an seinem Hinterrad zu bleiben.
Obwohl wir etwas später am Morgen losgefahren waren, waren die Straßen noch vereist und nass. Während wir weiter durch die Kälte strampelten, bildete sich auf meinen Schaltzügen eine Eiskruste, die allmählich alles festfror. Bart erging es ebenso. Während der letzten Stunde der Fahrt würde es keine Gangwechsel mehr geben.
Ich steckte schön in einer Übersetzung von 53 x 17 fest. Quälend langsam würgte ich die Pedale herum, aber Bart (der das offenbar gewohnt war) ließ sich nicht beirren und trat einfach stoisch weiter.
»Du musst halt die Arschbacken zusammenkneifen und damit klarkommen«, knurrte er.
Das war Barts Lebensmotto: Mehr Schmerz bedeutete mehr Spaß.
Schließlich brach ich ein, unterkühlt und unterzuckert, ungefähr 15 Kilometer von zu Hause entfernt. Wie er angekündigt hatte, wartete Bart nicht, aber während ich langsam ausrollte, hörte ich ihn brüllen:
»Gut gemacht, Junge! Wir sehen uns nächsten Sonntag!«
Ich wusste, dass ich mir ein klein wenig seines Respekts verdient hatte.
Die letzten 15 Kilometer kroch ich eher, als dass ich fuhr. Am liebsten hätte ich angehalten und mich in einer schmutzigen Schneewehe schlafen gelegt, betend, dass mich irgendjemand vor Einbruch der Dunkelheit finden würde. Aber ich würgte weiter die Pedale herum, quälend langsam und mit abgehacktem Tritt. Ich hatte kein Geld, um zu Hause anzurufen oder mir eine heiße Schokolade zu kaufen. Ich hatte lediglich einen funktionstüchtigen Gang. Und mir fiel Eis vom Kinn herab. Ich war so hungrig, so durchgefroren und mit meinen Kräften und Nerven so dermaßen am Ende, aber es gab keine andere Möglichkeit, nach Hause zu kommen, als einfach weiterzumachen. Das würde mir eine wertvolle Lektion sein. Manchmal gibt es keine bessere Option. Man muss einfach weitermachen.
Die Miene meiner Mutter, als ich durch die Tür schlurfte, war unbezahlbar. Man konnte sehen, wie Ärger, Enttäuschung, Stolz und mütterliche Instinkte in ihrem Kopf miteinander rangen. Sie wollte mich füttern, mich umarmen, mich in eine heiße Badewanne stecken und gleichzeitig anbrüllen, was für ein Idiot ich sei – alles in einem Atemzug.
Baden war normalerweise nicht unbedingt mein Fall. So eine Sitzung in der Wanne kam mir immer maßlos, langatmig und öde vor. Aber nichts auf der Welt kann es mit einem heißen Bad nach einem langen, kalten Tag auf dem Rad aufnehmen. Dieser Kontrast, seinen Körper erst bei Kälte und Nässe zu schinden, bis er fast zerreißt, und ihn dann in den warmen Schoß einer heißen Badewanne gleiten zu lassen, ist eine wahrlich krasse Erfahrung.