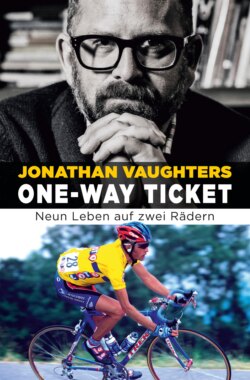Читать книгу One-Way Ticket - Jonathan Vaughters - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 3
Der orange Volvo Kombi
Der Sieg in Buckeye machte Lust auf mehr. Ich begann, Rennen in entlegenen Ecken von Colorado und in anderen Bundesstaaten ins Auge zu fassen, und machte mir sogar Gedanken darüber, wie man sich für die US-Meisterschaften qualifizieren könnte.
Ich bin sicher, meine Eltern waren auf der einen Seite ganz froh, dass ihr Herumtreiber von Sohn endlich eine Beschäftigung gefunden hatte, der er sich mit ganzem Herzen verschrieb, andererseits waren sie aber sicher auch ein bisschen besorgt angesichts der Ausmaße meiner Obsession. Unterdessen war es mit der Wirtschaft in Colorado bergab gegangen und meine Eltern hatten ein paar finanzielle Schwierigkeiten, was eine zusätzliche Belastung bedeutete.
Sie machten sich eher Gedanken, wie sie die Hypothek bedienen und Essen auf den Tisch bringen sollten, als darum, ihren Sohn durch die Gegend zu kutschieren, damit er Radrennen bestreiten konnte. Meine Pläne für diese weit verstreuten Rennen schienen viel zu abwegig, um auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, abgesehen davon, dass sie viel zu weit entfernt waren. Und dennoch unterstützten meine Eltern meine Tagträumereien und halfen mir dabei, günstige Möglichkeiten zu finden, zu diesen Veranstaltungen zu gelangen.
Das bedeutete mir enorm viel. Ich sehnte mich danach, als Radrennfahrer ein höheres Niveau zu erreichen, wollte meinen Eltern aber nicht die finanzielle Last dieser Obsession aufbürden. Gleichzeitig musste ich mich zumindest bei ein paar Rennen auf regionaler Ebene blicken lassen, um vielleicht für ein wenig Aufsehen zu sorgen. Ich musste die Aufmerksamkeit von lokalen Teams, nationalen Auswahltrainern und vielleicht dem einen oder anderen Sponsor erregen. Falls ich mich gut schlug, könnte ich ein wenig Preisgeld gewinnen, was allemal besser wäre als ein Ferienjob, und so vielleicht die Fahrtkosten zum nächsten Rennen aus eigener Tasche bezahlen.
Auch dann würde ich meine Eltern natürlich überreden müssen, mich zu diesen Rennen zu fahren. Ich wusste, dass Dad Zeit genug hatte, mich hinzubringen, denn seine Kanzlei litt unter der am Boden liegenden Konjunktur. Also beschloss ich, ihm vorzuschlagen, mich zu einigen Rennen zu fahren. Das bescherte dem knallorangen 1974er Volvo Kombi meines Vaters seinen großen Auftritt.
Der Volvo hatte schon weit über 300.000 Kilometer auf dem Buckel und stank nach beißendem Pfeifenqualm und verschüttetem Kaffee. Es war das Auto, in dem ich zur Schule gefahren worden war, seit ich ein kleiner Junge gewesen war.
Seine Höchstgeschwindigkeit lag unter dem Tempolimit und er verbrannte so viel Öl, dass man bei jedem Tankstopp nachfüllen musste. Die zerrissenen Sitze waren mit Schafsfell bezogen und übersät von der Asche aus der Pfeife meines Dads.
Die Gegenwart und der Geruch meines Vaters, wie er im Volvo an einem bitterkalten Januarmorgen in Colorado bei offenem Fenster eine Pfeife raucht, ist eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen. Nun würde dieser gute alte Freund auf Rädern mich zu den Schlachtfeldern des Radrennsports in Colorado bringen.
Aber dem orangen Volvo stand noch mehr bevor. Er würde mehr sein als nur mein Beförderungsmittel zu den Wettkämpfen – er würde sich zu einem Mehrzweck-Radsport-Begleitfahrzeug mausern. Seine Bestimmung war auch, mir im Training als Schrittmacher zu dienen.
Motorpacing bedeutet, hinter einem Auto oder Motorrad zu fahren und den Windschatten des Fahrzeugs dazu zu nutzen, um mit viel höheren Geschwindigkeiten zu trainieren, als es normalerweise möglich wäre. Soweit ich es beurteilen konnte, war Training mit einem solchen motorisierten Schrittmacher der Königsweg dahin, ein großer Fahrer zu werden.
Ich hatte darüber in Eddie Borysewicz’ Trainingsratgeber gelesen, aber noch wichtiger: Ich hatte es in Filmen gesehen. Wie jeder Radsportnarr in den 1980ern hatte ich Breaking Away und American Flyers gesehen. Diese beiden Filme, die von amerikanischen Kids handeln, die sich dem Radrennsport verschreiben, verkörperten all meine Träume und Erfahrungen.
Ich sah mich selbst, so wie die Kids in Breaking Away, als einen »Cutter« aus einer armen Familie von der falschen Seite der Gleise, der auf die feine Cherry Creek High School geht. Ich hielt mich für Dave Stoller, den Helden aus Breaking Away, einen Außenseiter, der seinen Weg im Leben geht, indem er Rad fährt und vom großen Abenteuer in Europa träumt. Um wie Dave zu werden, musste ich lernen, hinter einem motorisierten Schrittmacher zu fahren.
Bei meinen ersten Motorpacing-Experimenten versuchte ich, mich hinter die Stoßstangen langsamer, nichtsahnender und zumeist älterer Autofahrer zu klemmen. Dies erwies sich als recht riskant. Allzu oft ließ der Anblick eines Bengels, der sich mit hochrotem Kopf in seinem Rückspiegel abstrampelte, den Fahrer in Panik geraten und in die Eisen gehen, und ich landete unsanft auf dem Kofferraum.
Nach ein paar solcher Episoden sah ich ein, dass es wohl sinnvoller wäre, einen Fahrer zu finden, der wusste, was vor sich ging, statt ihn in Angst und Schrecken zu versetzen. Das schien für alle Beteiligten das Beste zu sein. Also fragte ich meinen Vater, ob er bereit wäre, den Schrittmacher für mich zu geben.
Seine Antwort war sehr typisch: Er sagte weder ja noch nein, sondern stellte stattdessen allerlei Fragen, was genau ich mit dem seltsamen Anliegen, mit meinem Rad direkt hinter einem Kombi zu fahren, bezweckte. Aber bald erklärte er sich bereit.
Ich glaube, er sah die Sache als Chance, die Bindung zwischen Vater und Sohn zu festigen. Die meisten Väter spielten mit ihren Kindern Ball, halfen ihnen bei den Hausaufgaben oder gingen mit ihnen Angeln. Dad und ich unternahmen nie etwas gemeinsam – wir waren unterschiedliche Charaktere und generell herrschte das Gefühl einer gewissen Distanz zwischen uns beiden. Aber unsere Motorpacing-Einheiten nach Schulschluss überwanden unsere Differenzen und wurden zu etwas, das uns beide verband.
Unerwartet erwies er sich als perfekter Schrittmacher. Mein Vater ist der wahrscheinlich langsamste Autofahrer, der mir je begegnet ist, und er neigt nicht dazu, plötzliche Richtungswechsel vorzunehmen, weder im Straßenverkehr noch in sonstigen Lebensbereichen. Er ist die personifizierte Bedächtigkeit.
Er gebraucht nur selten die Bremse, weil er, bei allem, was er tut, nie schnell genug unterwegs ist, um sie benutzen zu müssen. Während diese Gleichmut das genaue Gegenteil meiner überspannten Impulsivität ist, erwies sie sich für die Rolle des Schrittmachers als absolut perfekter Charakterzug. Auch der orange Volvo war wie geschaffen für diese Aufgabe.
Er war ein behäbiges, schwerfälliges Ungetüm, das seine besten Tage lange hinter sich hatte. Der überstrapazierte Motor lieferte so gut wie keine Beschleunigung und auch die Bremsen funktionierten mehr schlecht als recht. Das alles war einfach perfekt.
Jeden Mittwoch traf ich mich mit Dad am Chatfield Reservoir. Chatfield war ein State Park und es herrschte dort sehr wenig Verkehr. Die Straßen waren weitgehend flach, es gab nur wenige Kurven und kaum Schlaglöcher. Das waren genau die richtigen Bedingungen, um die Kunst des Stoßstangenlutschens zu erlernen.
Wir fingen damit an, dass ich, bei 40 km/h an der Stoßstange klebend, einfach hinter Dads Kombi herfuhr. Wir mussten uns zunächst an die verschiedenen Signale und Zeichen gewöhnen, die nötig waren, um das Ganze zu einer für uns beide sicheren Angelegenheit zu machen. Recht schnell entwickelten wir ein Gefühl für die subtilen Bewegungen und Gesten, mit denen wir uns gegenseitig anzeigten, was Sache war. Allmählich wurde es zu unserer gemeinsamen Sprache.
Dad und ich redeten im täglichen Leben nicht viel miteinander, aber in unseren Schrittmacher-Einheiten in Chatfield verstanden wir uns fast blind. Es dauerte nicht lange, bis wir über Anstiege, Kurven und sonstigen Verkehr in gleicher Weise dachten. Ein kurzes Nicken und ein rascher Seitenblick genügten, um uns vollkommen zu verstehen. Über die verstohlenen Winke, die wir im Rückspiegel wechselten, funktionierte die Verständigung zwischen uns besser als je zuvor.
Seltsamerweise glaube ich, dass wir uns beide auf unsere gemeinsamen Ausfahrten am Mittwochnachmittag freuten. Ich kann nur vermuten, was die Park Ranger dachten, wenn sie uns sahen: meinen alten Herrn, der eben noch vor Gericht einen Fall verhandelt hatte, im Tweed-Dreiteiler und mit einer Pfeife im Mund am Steuer einer alten Mühle, hintendran sein halbwüchsiger Sohn, der auf einem Rad sitzend an seiner Stoßstange klebte.
Unsere Einheiten wurden immer intensiver und komplexer. Ich ergänzte sie um Intervalle, in denen ich versuchte, an dem orangen Ungetüm vorbeizusprinten. Bald sausten wir locker mit 60 km/h und mehr dahin, was streng genommen illegal war und jenseits des Tempolimits lag. Hin und wieder mussten wir im Park einen Truck samt Anhänger oder ein Wohnmobil überholen.
Das sorgte für einige Aufregung. Dad wechselte, seinen am Auspuff klebenden Jungen im Schlepptau, auf die Gegenfahrbahn und begann zu überholen. Die Blicke und das Kopfschütteln, das wir ernteten, wenn wir an irgendeinem alten Angler in seinem Ford Pick-up vorbeikrochen, waren unbezahlbar. Mir entging nicht, wie stolz Dad war. Sein Sohn war auf einem verdammten Fahrrad schneller als ein Ford 150.
Das ist bis heute das einzige Mal, dass ich meinen Vater das Tempolimit überschreiten sah. Obwohl ich die berauschende Mischung aus karzinogenem Öl und Pfeifenrauch inhalierte, die aus dem Volvo waberte, machte sich das Training bezahlt. Ich fing an, häufiger größere Rennen zu gewinnen.
Wie sich zeigte, war ich trotz meiner geringen Körpergröße gar nicht so übel im Zeitfahren, egal ob auf hügeliger oder flacher Strecke. Diese Disziplin übte einen besonderen Reiz auf mich aus, denn dabei ging es nur darum, wie viel Schmerz man aushalten konnte. Im Zeitfahren gab es keinen Hasen, den man hetzte, keinen Konkurrenten neben einem, keine externe Motivation, keinen visuellen Stimulus. Es ging nur um einen selbst, sein Rad und die Straße.
Es gab nicht die jähen Beschleunigungen wie beim Sprinten oder die raschen taktischen Entscheidungen der Straßenrennen. Es ging nur um den reinen Einsatz. Das Vermögen, sich ausschließlich auf eine Sache zu konzentrieren und alles andere auszublenden, war eine spezifische Fähigkeit, die nichts mit den Qualitäten zu tun hatte, die nötig waren, um mitten in einem Peloton zu fahren.
Nachdem ich meinen Vater dazu gebracht hatte, mich zu einigen Rennen zu fahren, und vor neu gewonnenem Selbstvertrauen nur so strotzte, meldete ich mich für Colorados Zeitfahr-Staatsmeisterschaften 1988 an. Wie sich herausstellte, verkörperten diese Meisterschaften perfekt das Einsamkeits-Ethos des Zeitfahrens. Sie wurden in einer Stadt namens Strasburg ausgetragen, in der dünnbesiedelten Ebene ganz im Osten von Colorado.
Strasburg, eine landwirtschaftlich geprägte Stadt, die wie ausgestorben wirkte, war ein Musterbeispiel trostloser Ödnis, nur der Wind und der Staub leisteten einem Gesellschaft. Dem Ort haftete ein Hauch von Endstation an, was daran liegen mag, dass dort der letzte Gleisnagel eingeschlagen wurde, der die Transcontinental Railroad vollendete.
Aber es gab einen guten Grund, sich für einen derart gottverlassenen Ort zu entscheiden: In den 1980er Jahren gab es in Colorado nicht viel Geld für Radrennen, die Veranstalter konnten es sich daher nicht leisten, die Straßen abzuriegeln. Stattdessen versuchten sie, Straßen ausfindig zu machen, auf denen eh möglichst wenig Verkehr herrschte, und Orte, in denen kaum jemand lebte. Mit Strasburg war ihnen das gelungen.
An einem Samstag gleich zu Beginn der Schulferien saßen mein Vater und ich also um kurz vor vier in der Früh in der Küche, aßen ein paar aufgeweichte Cornflakes, füllten eine kleine Coleman-Thermoskanne mit Wasser – per Edding mit »Für die Taubenjagd« beschriftet – und luden dann das Rad hinten in den Volvo.
Nach einem Stottern, einem Bocken und ein paar Fehlzündungen machten wir uns auf den Weg, um zu versuchen, Staatsmeister von Colorado zu werden. Das war kein geringes Unterfangen, denn in den 1980er Jahren war Colorado so etwas wie die Hochburg der US-Radsportszene. In Colorado gewann man nicht im Vorübergehen, und wie ein anderer von Frankies Schützlingen, Clark Sheehan, gezeigt hatte, konnte man sich als Staatsmeister von Colorado durchaus auch Chancen auf den Gewinn der US-Meisterschaft ausrechnen. Während es in puncto Preisgeld um absolut gar nichts ging, stand umso mehr Prestige auf dem Spiel.
Meine Startzeit war um Punkt sieben Uhr. Weil der Volvo einen etwas holprigen Morgen gehabt hatte, trafen wir etwas später, als ich gehofft hatte, aber noch rechtzeitig auf dem Parkplatz ein. Ich begann mich aufzuwärmen und Dad ging los, um meine Startnummern zu holen. Es war entsetzlich kalt, wie immer in Colorado am frühen Morgen.
Ich streifte die ganze Winterkleidung über, die ich bei A Bike Place gekauft hatte und die allmählich, mit Verspätung, zu passen begann. Nervös beobachtete ich, wie sich auf der anderen Seite des Parkplatzes der berüchtigte Wunderknabe Bobby Julich in seiner rotgrünen Teamkleidung von 7-Eleven warmfuhr.
Bobby war eine Altersklasse über mir und ein viel besserer Fahrer als ich, aber hin und wieder gelang es mir, ihn im Zeitfahren zu schlagen. Ich war so besessen von dem Gedanken, zu gewinnen, dass ich kaum auf die Zeit achtete. Dad hatte meine Startnummer angeheftet, ich trug meinen hautengen regenbogenfarbenen Zeitfahranzug schon drunter und begab mich auf eine letzte Aufwärmrunde. Dad geriet ein wenig in Unruhe darüber, dass ich den unmittelbaren Startbereich verließ, aber ich tat dies als die übersteigerte Angst eines ahnungslosen Erwachsenen ab. Ich musste mich ja schließlich warmfahren, oder?
Als ich wieder im Startbereich eintraf, hörte ich den Rennleiter fieberhaft irgendeine Nummer ausrufen, die sich unverzüglich an den Start begeben solle. Mit einem Mal wurde mir klar, dass es meine Nummer war, die er da brüllte.
Dad hatte die gehetzte, entnervte Miene, die nur ein extrem gut organisierter Mann haben kann, der es mit einem extrem verpeilten Sohn zu tun hat. Ich begab mich so schnell es ging an den Start, gerade als der Countdown für mich heruntergezählt wurde.
»…5…4…«
Ich versuchte immer noch, mir meine Überhose von den Beinen zu zerren und mich meiner Jacke zu entledigen, während meine Chancen, Staatsmeister zu werden, mit jeder Sekunde, die verging, schwanden und im kalten Coloradowind davonwehten.
»…3…«
Ich bat Dean Crandall, den bärbeißigen und strengen Rennleiter, um eine spätere Startzeit – um einen erneuten Versuch sozusagen.
»…2…«
Er sah mich und Dad an. »Nein, das wird dir eine Lehre sein, Junge.«
»…1…!«
Ich sprang aufs Rad und fuhr los, wenn auch entmutigt. Die Sache schien aussichtslos zu sein. Was war ich doch für ein Idiot. Weil ich überheblich gewesen war und mich geweigert hatte, auf meinen alten Herrn zu hören, hatte ich meine Chancen auf die Staatsmeisterschaft vergeigt.
Demotiviert spulte ich die ersten anderthalb Kilometer des Zeitfahrens ab, aber dann, als ich mein letztes Stück Überbekleidung an den Straßenrand warf, wurde mir etwas sehr Wichtiges klar: Ich mochte vielleicht nicht gewinnen, aber wenn ich einfach aufgeben würde, könnte ich auch die Qualifikation für die US-Meisterschaften abschreiben.
Ich geriet in Panik. Einen Moment lang erwog ich, einen Sturz in den Graben zu simulieren, sodass ich nach Hause könnte. Aber dann setzte die Logik ein. Ich hatte wegen meiner verpassten Startzeit nur grob eine Minute verloren. Falls ich eine überragende Fahrt hinlegte, würde ich vielleicht Fünfter werden und doch noch zu den US-Meisterschaften fahren. Und das reichte. Ich begann, mich reinzuhängen, um meine Chance auf die Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen zu wahren.
Wir hatten Rückenwind bis zur Wendemarke bei halber Strecke, einem Verkehrskegel auf dem Mittelstreifen, und mein Hintermann, der Fahrer, der 60 Sekunden nach mir gestartet war, hatte mich bis dahin überholt. Sobald wir aber in den Wind wendeten, schnappte ich ihn mir wieder.
Danach begann ich wirklich, den Kampf anzunehmen, und nach ein paar Minuten im Gegenwind fand ich meinen Frieden in der Stille und im Schmerz. Ich dachte nicht mehr daran, dass ich der Idiot war, der seine Startzeit verpasst hatte. Ich dachte nicht mehr daran, dass ich keine Chance mehr haben würde, Bobby Julich zu schlagen. Ich konzentrierte mich nur darauf, die Pedale drehen zu lassen, und auf meinen dampflokartigen Atem. Meine Panik war verflogen.
Ich überholte einen weiteren Fahrer. Und noch einen. Und dann noch einen.
Anderthalb Kilometer vor dem Ziel befand ich mich in einem solchen Zustand des Leidens, dass ich das Gefühl hatte, mir jeden Moment in die Hose zu machen. Speichel troff mir aus dem Mund, weil ich es mir nicht erlauben konnte, ihn lange genug zu schließen, um zu schlucken. Ich brauchte den Sauerstoff. Aber ich nahm den Zustand einfach hin und gab weiter Gas.
Bis zu diesem Tag wusste ich nicht, was »trockenes Würgen« bedeutet. Aber als ich über die Linie fuhr, lernte ich es. Ich begann sofort krampfartig zu würgen und versuchte, mich zu übergeben. Es war laut. Echt laut.
Die anderen Eltern schauten angesichts der Geräusche und der Krämpfe angewidert und verwundert zu. Aber ihre Verwunderung rührte auch daher, wie sehr ich mich verausgabt hatte, wie weit ich gegangen war. Ich taumelte vom Rad und saß nur da und versuchte, den nicht vorhandenen Inhalt meines Magens auszuspeien. Ich war froh, dass meine Mutter nicht da war und mich in einem solchen Zustand sah.
Ich bin sicher, sie hätte etwas gesagt wie: »Sich dermaßen zu verausgaben, ach, Junge, das ist bestimmt nicht gut für dein Herz…«
Dad fand mich.
»Sieht so aus, als hättest du das Beste aus der Situation gemacht.« Er lachte. »Hoffe, du hast heute was gelernt.«
Mein Vater war bei diesen Veranstaltungen ein akribischer Zeitnehmer. Nur mit einer alten Armbanduhr zum Aufziehen mit Sekundenzeiger bewaffnet, kannte er die Zeiten aller anderen Teilnehmer. An diesem Tag hielt er sich mit Informationen allerdings zurück. Es entstand eine Pause, aber schließlich erkundigte ich mich beschämt.
»Was meinst du, habe ich mich für die US-Meisterschaften qualifiziert?«
Er sah mich an, beinahe verärgert.
»Nein«, sagte er. »Ich glaube, du hast gewonnen.«
Auf der Heimfahrt schlief ich auf dem nach Tabak riechenden Schafsfellüberzug des orangen Volvo Kombis ein, so wie ich es früher jeden Tag auf dem Weg zur Schule getan hatte. Ich war vollkommen fix und fertig. Aber hin und wieder, wenn ich ein Auge öffnete, schaute ich herab und betrachtete die Goldmedaille, die um meinen Hals baumelte. Ich konnte es kaum erwarten, sie Mum zu präsentieren. Dad und ich waren uns allerdings einig, dass wir das mit dem trockenen Würgen besser für uns behalten sollten.
Ich begann, für die US-Radmeisterschaften 1988 zu trainieren. Bis dahin standen natürlich noch ein paar andere Rennen auf dem Programm, zu dem der Volvo uns kutschieren durfte. Das wichtigste Rennen, das ich zur Vorbereitung bestreiten wollte, war das einwöchige Casper Classic in Wyoming. Es war eine heiße, windige Angelegenheit in einer Stadt, die vom Rest der Welt seit langem vergessen worden war. Aber es würde ein hartes Rennen sein und mich für die Meisterschaften wappnen.
Ich gewann das Zeitfahren zum Auftakt und übernahm die Gesamtführung. Dann aber erhielt ich auf einem langen und windigen Abschnitt eine harsche Lektion, was eine Windstaffel war und wie man nicht darin fahren sollte.
Ich stürzte. Schwer.
Ich war rasch wieder auf den Beinen und im Sattel, aber als ich mir den Weg zurück nach vorn bahnte, spürte ich einen heftigen Schmerz im Unterarm. Es beeinträchtigte mich den Rest der Etappe, dennoch gelang es mir, mit dem Hauptfeld ins Ziel zu kommen.
Anschließend fuhren wir ins örtliche Krankenhaus, um den Arm röntgen zu lassen. Ich hatte eine Fraktur erlitten, direkt an der Wachstumsfuge oberhalb des Handgelenks. Als der Doktor einen enormen Gipsverband um meinen Arm legte, sagte er, dass ich vier Wochen lang kein Rad fahren dürfe.
Ich konnte es nicht fassen. Vier Wochen?
Ein Monat ohne Rad würde meine Chancen, bei den nationalen Meisterschaften etwas zu reißen, zunichtemachen. Ich wollte es nicht wahrhaben. Könnte ich nicht einfach mit Gips fahren? Die Antwort lautete, dass ich das zwar könnte, aber falls ich wieder stürzte und mir den Arm erneut bräche, könnte es das Wachstum beeinträchtigen. Außerdem würde es mehrere Wochen lang höllisch wehtun.
Meine Eltern wussten, dass ich niedergeschlagen war, und versuchten, mich zu trösten.
»Nun, es gibt immer ein nächstes Jahr«, sagte Mum.
Aber als wir wieder ins Auto stiegen, dachte ich nur: »Das ist doch Bockmist.«
Wir waren etwa auf halbem Weg vom Krankenhaus nach Hause, als ich mich zu Wort meldete.
»Ich fahre morgen«, verkündete ich.
Meine Eltern versuchten zu protestieren, aber ich war wild entschlossen. »Wenn ihr mich morgen nicht zum Rennen fahrt, fahre ich halt mit dem Rad hin«, sagte ich störrisch. »Ich fahre. Mir egal, ob am Ende ein Arm kürzer ist als der andere. Ich werde hier fahren. Und ich werde bei den US-Meisterschaften fahren.«
Meine armen Eltern…
Und so ging ich also an den Start und ich litt wie ein Schwein in der Sommersonne.
Mit diesem massiven 80er-Jahre-Gipsverband, der scheinbar aus Zement war, war ich kaum in der Lage, den Lenker zu halten. Tatsächlich schaffte ich es nicht einmal, ohne fremde Hilfe vom Rad zu steigen. Mein Arm war in der Hitze so geschwollen, dass er von innen gegen den Gips drückte, und wegen der Nachwirkungen des Sturzes tat mir der ganze Körper weh. Aber ich würde nicht aufgeben, solange ich die Gesamtführung innehatte. Das kam überhaupt nicht in die Tüte.
Ich hatte zahllose Geschichten über Profis in Europa gelesen, die schreckliche Verletzungen und Krankheiten ertrugen und sich mit Durchfall, gebrochenen Schlüsselbeinen, Infektionen und Fieber durchs Rennen kämpften. Sie gaben nie auf. Es war ihr Job, und die Tatsache, dass sie so hart im Nehmen waren, befähigte sie zu diesem Job.
Das war auch mein Traum: mich als zäh genug zu erweisen, alles zu ertragen. Ich würde nicht aufgeben; ich würde wie sie sein, diese hartgesottenen, nicht kleinzukriegenden europäischen Profis. Ich war keiner dieser verhätschelten amerikanischen Weichlinge, deren Eltern sich bei jeder Änderung der Windrichtung ins Hemd machten.
Klar, da ich keine Attacken mitgehen konnte, büßte ich natürlich meine Führung ein, aber ich wahrte meinen Stolz und auch meine Hoffnungen auf die Meisterschaften. Man sah die anderen Eltern ihre Köpfe schütteln, wenn ich mit meinem riesigen blauen Gipsverband um den Arm vorbeifuhr. Sie würden ihre Kinder niemals in einem solchen Zustand Rad fahren lassen.
Tss-tss, also so was…
Aber ich hatte meinen Eltern keine große Wahl gelassen, also schauten sie nervös zu und zählten die Runden, bis es vorbei war und wir nach Hause konnten.
Ich schaffte es, immerhin noch Fünfter zu werden, aber noch wichtiger, ich wahrte meine Hoffnung, bei den US-Meisterschaften anzutreten, und bewies meinen Eltern, wie viel mir an diesem Traum gelegen war. Auf der Heimfahrt war die Stimmung zugegebenermaßen ein bisschen gedämpft, denn sie waren beide verstimmt darüber, dass ich gestartet war. Aber ich merkte auch, dass sie stolz auf mich waren. Ich hatte echten Schneid bewiesen und vielleicht überwog das die Risiken, die ich eingegangen war, um das Rennen zu beenden. Ich hatte gezeigt, dass ich nicht aufgeben würde, und das war ihnen ein großer Trost.
Der Verband wurde eine Woche vor den Meisterschaften abgenommen. Der Doktor war erstaunt, wie schnell mein Arm verheilt war. So etwas hätte er noch nicht gesehen, sagte er, als er den Gips aufschnitt, der mich ausgebremst hatte. Bar jeglicher Verletzungssorgen machte sich die komplette Familie, einschließlich des Hunds, auf den Weg nach Pennsylvania zu den US-Radmeisterschaften 1988.
Allerdings waren wir gezwungen, den getreuen orangen Volvo zurückzulassen, denn wir wussten, dass wir in Ermangelung einer Klimaanlage alle eingehen würden. Dad behauptete zwar immer, der Volvo habe eine »4 x 130«-Klimaanlage – sollte heißen, eine Klimaanlage mit vier offenen Fenstern bei 130 km/h –, aber uns war klar, dass der Volvo keine 130 Sachen machte, und auf einer Fahrt durch das Landesinnere der USA mitten im August war das nicht unerheblich. Also ließen wir meinen alten Freund zurück und machten uns im blauen Oldsmobile Kombi auf die lange Fahrt quer durchs Land, damit ich mich mit den besten Radrennfahrern der Nation messen konnte.
In der amerikanischen Radsportszene Ende der 1980er Jahre verbreiteten sich Neuigkeiten in Windeseile. Mir war bereits die Kunde von einem Jungen aus New York – aus Brooklyn oder Queens oder so – zu Ohren gekommen, der dort in der Altersklasse der 14- und 15-Jährigen alles gewonnen hatte. Wie es hieß, war er 2,40 Meter groß und trug einen Bart, der so dicht war, wie man es bei einem Jungen seines Alters noch nie erlebt hatte. Angeblich war er unschlagbar.
Jeder Fahrer von der Ostküste, der es wagte, in den Westen zu kommen, hatte Geschichten von der Unbesiegbarkeit dieses Jungen auf Lager. Jeder, der gegen ihn gefahren war, hatte Angst vor ihm. Viele der Geschichten stammten von Bobby Julich, der mich davor warnte, mir meinen Sieg bei den Staatsmeisterschaften zu Kopfe steigen zu lassen. Bobby meinte, dieser haarige Gigant aus New York würde mich bei der US-Zeitfahrmeisterschaft in Grund und Boden fahren.
Das machte die Konfrontation zu einem Kampf David gegen Goliath. Diesmal setzten die meisten Leute auf Goliath.
Beim Aufwärmen für das Zeitfahren erhaschte ich endlich einen Blick auf Goliath. Sein Name war George Hincapie. Er sah prächtig aus in seinem strahlend weißen GS-Mengoni-Rennanzug und auf seiner herrlichen, mit funkelnden Komponenten und Dual-Scheibenrädern von Campagnolo ausgestatteten Zeitfahrmaschine.
Auch er selbst sah gut aus, wie eine Teenagerversion von Lancelot, der soeben von Camelot herbeigeritten war. Abgesehen natürlich vom dem öligen, ondulierten Nackenspoiler, der unter seinem Helm hervorspross. Das sah doch eher nach New Jersey aus als nach Camelot.
Ich sagte Dad, dass George der Typ wäre, dessen Zeit er mit seiner Casio stoppen sollte.
Dad nickte nervös, verunsichert von dem Chaos, das bei diesen Meisterschaften verglichen mit der Radsportszene daheim in Colorado herrschte. Anstelle der morgendlichen Kälte, die wir in Colorado gewohnt waren, war es ein heißer und stickiger Pennsylvania-Nachmittag voller Fliegen und Mücken. Wir befanden uns auf Hincapies Territorium und ich hatte ein wenig Bammel. Aber immerhin verpasste ich diesmal nicht meine Startzeit.
In den Minuten vor dem Start hatte ich sowieso immer das Gefühl, mich am Rande einer Panikattacke zu befinden, an diesem Tag aber war ich so nervös wie noch nie zuvor. Doch irgendwie überstand ich es und nutzte die ganze aufgestaute Nervosität, um schnell zu fahren. Schließlich hatten mich meine Eltern den ganzen weiten Weg hierhergebracht.
Durch die dicke und feuchte Luft zu pflügen, war etwas ganz anderes als daheim in der Höhe von Colorado. Auf Meereshöhe zu fahren, war eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich trat so hart in die Pedale, wie meine kleinen Beine es zuließen, schien aber nicht besonders schnell voranzukommen. Ich triefte vor Schweiß, atmete aber nicht sehr tief. Ich hatte das Gefühl, wegen der Hitze und Feuchtigkeit ohnmächtig zu werden, aber ich würde ganz bestimmt nicht trocken würgen.
Ich fuhr völlig ausgepowert von der Anstrengung über die Ziellinie, und meine Mutter beharrte darauf, dass ich viel zu rot im Gesicht wäre, und übergoss mich mit Eiswasser. Natürlich wollte sie mich auch füttern. Meine Mutter versuchte ständig, mich zu füttern. Ich wollte aber nichts essen: Ich wollte wissen, wie ich mich im Vergleich mit der Legende aus Long Island geschlagen hatte. Dad sagte, er wüsste es nicht. Er wusste lediglich, dass wir nur wenige Sekunden auseinanderlägen, aber er konnte nicht sagen, wer die Nase vorn hätte.
Also warteten wir voller Ungeduld darauf, dass die Ergebnisse verkündet wurden. Als es endlich so weit war, hatten weder George noch ich gewonnen. Stattdessen belegten wir den zweiten und dritten Platz hinter einem Jungen aus Indiana. Das schien undenkbar, völlig ausgeschlossen, aber da stand es schwarz auf weiß.
Die Siegerehrung fand etwa eine Stunde später statt und ich traf endlich auf meinen Erzrivalen – und den Jungen aus Indiana. George war ausgesprochen schüchtern und höflich. Er erzählte mir, wie viel er über diesen legendären Jungen aus Colorado gehört hätte, den niemand schlagen könne. Er hatte gehört, ich wöge nur 80 Pfund und hätte eine Lunge, die doppelt so groß wäre wie die einer Giraffe. George sagte, er habe sich vor mir gefürchtet und dass jeder aus Colorado, mit dem er sich unterhalten hatte, gesagt habe, er hätte keine Chance gegen mich. Es war lustig, sich gegenseitig von diesen Heldengeschichten zu erzählen, die wir übereinander gehört hatten, über die ganze Angst, die sich in uns aufgestaut hatte.
Und nun standen wir auf einem Parkplatz in Reading, Pennsylvania, und bekamen Silber und Bronze, geschlagen von einem Burschen aus Indiana, von dem noch nie jemand gehört hatte.