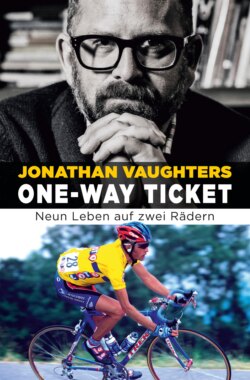Читать книгу One-Way Ticket - Jonathan Vaughters - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 4
Die goldene Generation
Sie alle – Lance Armstrong, Bobby Julich, George Hincapie, Chann McRae – machten später Karriere als einige der besten Radrennfahrer ihrer Generation. Sie waren die Fahrer, die den Profiradsport in den folgenden drei Jahrzehnten prägen würden, nicht nur in den USA, sondern auf der ganzen Welt, im Guten wie im Schlechten. Aber damals waren sie nur Kids, die gerne Rennrad fuhren, genau wie ich.
Bobby reiste im rostigen Wohnmobil seines Vaters zu den Wettkämpfen, in Begleitung von Bob Senior, der die immer gleichen ultrakurzen und noch dazu neongrünen Laufshorts trug. Lance kam in einem weißen Camaro IROC-Z T-Top, mit seiner Mutter auf dem Beifahrersitz und seinem auseinandergebauten Rad hinten auf dem Rücksitz.
Es gab noch andere Typen, die sich später einen Namen machten: »Fast« Freddie Rodriguez, Kevin Livingston und Jeff Evanshine, um nur einige zu nennen. Wir waren ein Haufen gestörter Außenseiter, die durch den Nischensport Radfahren zusammengebracht wurden.
Wir alle träumten davon, Rennen in Europa zu fahren und dem Tour-de-France-Sieger Greg LeMond nachzueifern. Und wir waren ehrgeizig, wobei der Begriff »ehrgeizig« eigentlich nicht im Ansatz beschreibt, wie wir drauf waren. Unsere Generation, geboren zwischen 1971 und 1973, begnügte sich nicht damit, nur gut Rad zu fahren – wir hielten uns dafür bestimmt, den Radsport zu dominieren. Das Problem war natürlich, dass wir gegenseitig auch zu den größten Stolpersteinen für die anderen auf dem Weg nach oben wurden.
USA Cycling, unser nationaler Verband, lud die allerbesten Fahrer des Landes zu diversen Trainingslagern im Olympiastützpunkt in Colorado Springs ein. Dort würden wir nicht nur Rennen gegeneinander bestreiten, sondern mussten auch tagein, tagaus miteinander auskommen. Wir lagen in jeder wachen Minute im Wettstreit miteinander; sieben Tage in der Woche hatten wir rund um die Uhr nichts anderes im Sinn, als uns gegenseitig auszustechen.
Die berüchtigtsten dieser Trainingslager waren diejenigen im Dezember, bei denen wir Crosstraining unternahmen, das uns helfen sollte, uns für die kommende Saison zu rüsten. Jeder Geländemarsch, jede Stretching-Einheit, jedes Workout im Kraftraum wurde zu einem Käfigmatch. Keiner wollte klein beigeben, um nichts in der Welt. Einmal unternahmen wir eine sechsstündige Klettertour den Pikes Peak hinauf, nur um am nächsten Tag einen Dreierpack aus Laufen, Gewichtheben und Cyclocross zu absolvieren.
Nach einer Woche Trainingslager waren Blasen und Sehnenentzündungen gang und gebe. Schmerzmittel wurden heimlich herumgereicht. Absurde Mengen Kaffee zu trinken, wurde zum Standard, nur um den nächsten Tag zu überstehen, ohne zu weinen.
Die Trainer, größtenteils aus Osteuropa stammend, fanden das alles ziemlich amüsant. Die beste Methode, die stärksten Fahrer zu ermitteln, bestand ihrer Ansicht nach darin, alle Kandidaten mit gewaltigen Trainingsbelastungen zu vernichten und dann zu schauen, wer nach zwei Wochen noch stehen konnte. Und wir machten natürlich alles nur noch schlimmer, indem wir jede Einheit zu einem Wettkampf auf Gedeih und Verderb machten.
Es gab ein paar Aspekte jedes Trainingslagers, die nützlich waren, zum Beispiel die VO2max-Messungen, die Bluttests und die Unterstützung beim richtigen Set-up unserer Räder. Zwangsläufig uferte auch das zu einem Wettstreit aus.
Einer der Trainer beschloss, uns eine kleine Wette anzubieten. Einen Preis für die höchste VO2max konnte er nicht ausloben, denn dieses Maß war weitgehend genetisch bedingt, also teilte er uns stattdessen mit, dass er denjenigen von uns mit den besten Blutlaktatwerten – wer also den meisten Schmerz aushalten konnte – auf seine Kosten in den Stripclub »Puss in Boots« im nahe gelegenen Colorado Springs einladen würde.
Am letzten Tag des Trainingslagers kam einer der Verwaltungsangestellten aus dem Hauptgebäude, um George und mich zu holen. Wir erhielten gesonderte Termine für eine Besprechung beim Arzt des Stützpunkts. Wir hatten keine Ahnung, worum es ging, aber wir hatten beide Bammel, dass uns irgendwelcher Ärger ins Haus stand.
Zu Beginn der Besprechung händigte mir der Arzt die Resultate eines kürzlichen Bluttests aus, der während des Trainingslagers vorgenommen worden war.
»Schau dir bitte einmal den Abschnitt des Tests an, der mit ›Hämatokrit und Hämoglobin‹ überschrieben ist«, sagte er.
Ich überflog das Blatt auf der Suche nach diesen Begriffen.
»Oh nein, ich habe Krebs«, war das Erste, was mir durch den Kopf ging.
Die Bluttests im Olympiastützpunkt hatten bestimmt ergeben, dass in meinem Körper der Krebs wucherte. Meine arme Mutter!
»Wir denken, dass diese Werte ungewöhnlich hoch sind, und wir müssen dir ein paar sehr direkte Fragen stellen«, erläuterte er mir.
»Okay«, antwortete ich kleinlaut.
Dann sagte der Arzt: »Hast du zu irgendeinem Zeitpunkt eine Bluttransfusion erhalten, um deine Leistung in diesem Trainingslager zu steigern?«
Ich hatte echt keine Ahnung, was er mich da fragte, wenngleich ich mich vage erinnerte, dass es bei den Olympischen Spielen 1984 irgendeinen Skandal gegeben hatte, bei dem es um Blut ging. Ich bat ihn zu erklären, was eine Bluttransfusion war, und lachte nervös.
Der Arzt klärte mich auf.
»Nein – so was habe ich nicht gemacht«, sagte ich. »Warum sollte ich das tun…?«
Ich bin ziemlich sicher, dass die Unterredung mit George genauso ablief. Letztlich waren die Ärzte sehr nett zu uns und erklärten, sie hätten uns diese harten Fragen stellen müssen, der wahrscheinliche Grund für die hohen Werte seien aber wohl unsere Gene. George war kolumbianischer Abstammung und ich lebte in der Höhe in Denver, was womöglich etwas damit zu tun hatte.
Mein Vater hatte nach einem kleinen Schlaganfall als Kind viele Jahre lang Blutverdünner nehmen müssen, vielleicht hatte auch er also hohe Hämatokrit- und Hämoglobinwerte. Ich wusste nicht so recht, was ich von all dem halten sollte. Auch George nicht, aber wir waren froh, diese unangenehme Unterredung hinter uns zu haben.
Die Nominierung für die Europareisen, die das Team USA unternehmen würde, wurde nach den Trainingslagern vorgenommen und leitete auch den Auswahlprozess für den WM-Kader ein. Die Junioren-Nationalmannschaft unternahm jedes Jahr drei oder vier Tourneen durch Europa, und alle balgten sich darum, einen Platz für diese Reisen zu ergattern.
Mein erster Europa-Trip war ein Monat in der Bretagne in Frankreich, damals die Hochburg des französischen Radsports. Die Reise war mein erstes echtes Abenteuer außerhalb der USA und meine erste Kostprobe vom richtigen europäischen Straßenrennsport.
Das Abenteuer begann auf dem Flug über den Atlantik, auf dem einer meiner Teamkollegen ein paar Whiskyfläschchen aus dem Getränkewagen stibitzte, wann immer dieser vorbeikam. Als wir in Paris eintrafen, war er sturzbesoffen. Wir mussten ihn irgendwie durch die Passkontrolle lotsen und beteten nur, dass er sich im Flughafen mit niemandem anlegen würde.
Endlich schleiften wir ihn hinaus zu unserer Mitfahrgelegenheit. Der Soigneur und der Mechaniker, die geschickt wurden, uns abzuholen, verstauten unsere Räder hinten im Sprinter und legten unseren betrunkenen Kollegen dann oben auf den Radtaschen ab. Es war eine lange Fahrt in die Bretagne, und als wir ankamen, mussten wir die Kotze von den Taschen waschen.
Das Bauernhaus, in dem wir untergebracht waren, sah von außen ganz reizend aus, entpuppte sich drinnen aber als kalt und feucht. Es war im Grunde fast wie Camping, jeder bekam eine Matte und einen Schlafsack, die wir auf den Boden legten. Das Dach war undicht und es gab kaum Warmwasser, was bald zu einem echten Problem wurde. Nach dem Training am ersten Tag stellten wir fest, dass das warme Wasser höchstens für einen oder zwei von uns reichte.
Da wir zutiefst darwinistische Kreaturen waren, wurden die letzten Kilometer jeder Trainingsfahrt fortan zu einer Wettfahrt bis zum Haus, zu einem Rennen um Warmwasser. Anfangs war die Sache eher ein Spaß, aber bald wurde es zu einem echten Krieg. Unterdessen war unser Trainer genervt, dass wir Vollgas gaben, wenn wir eigentlich locker ausrollen sollten. Also einigten wir uns auf eine Duschrotation, um zu gewährleisten, dass jeder zumindest einmal in drei Tagen in den Genuss einer heißen Dusche käme.
Doch nach nur wenigen Tagen scherte Jeff Evanshine aus. Gegen Ende des Trainings legte er einen Sprint ein und wetzte unter die Dusche, die ganze Zeit wie ein Irrer lachend. Beim ersten Mal war das noch ganz witzig. Beim zweiten Mal nicht mehr so ganz.
Als er es zum dritten Mal machte, nach einer ganz besonders langen, kalten und regnerischen Trainingseinheit, warteten wir geduldig, bis er sich komplett entkleidet hatte und bereit war, seine warme Dusche zu genießen. Dann packten wir ihn uns und warfen ihn hinaus auf den Hof.
Evanshine war so gebaut wie ich: eine magere kleine Ratte, um die 1,75 Meter groß und 55 Kilo schwer. Aber, mein lieber Mann, als es darum ging, nicht hinaus in die Kälte geworfen zu werden, wehrte er sich wie eine tollwütige Bestie. Er strampelte, heulte und kämpfte wie ein haarloser Tiger. Es war beeindruckend, wie stark er war. Schließlich bugsierten wir ihn zur Tür hinaus und schlossen von innen ab.
Egal wie laut und kläglich er darum bettelte, wieder hineingelassen zu werden, wir blieben hart und ließen ihn draußen in der Kälte, in einem dieser eiskalten Regengüsse, die typisch sind für die Bretagne. Aber er hatte einen guten Kampf geliefert, sodass wir ihm zumindest den Respekt erwiesen, ihn nicht die ganze Nacht auszusperren.
Wir waren nicht bloß Radfahrer, wir waren Radrennfahrer, und zwar ziemlich skrupellose.
In den Rennen, die wir bestritten, gingen wir miteinander nicht weniger unbarmherzig um wie mit der Konkurrenz. Wir wetteiferten gegenseitig darum, wem es als Erstem gelang, eine Attacke zu setzen, denn dann wäre der Rest der Mannschaft gezwungen, sich aus der Verfolgung herauszuhalten. Das war wohl kaum eine Taktik, wie sie ein Profiteam angewendet hätte, aber es funktionierte. Wir verloren nur selten, und oftmals dominierten wir total, selbst wenn das Feld stark und international besetzt war. Die USA waren eine Macht, die man auf dem Zettel haben musste. Greg LeMond gewann die Tour de France und wir gewannen sämtliche Juniorenrennen in Frankreich.
Es gab allerdings ein paar Fahrer, die wir nicht schlagen zu können schienen. Sie waren die damaligen Legenden im französischen Junioren-Radsport: Philippe Gaumont (der später bei Cofidis fuhr und Berühmtheit als Doping-Whistleblower erlangte) und Erwann Menthéour.
Gaumont war ein Ungetüm von einem Kerl, mit vorspringender Stirn und einem Bartwuchs, der noch dichter war als der von Hincapie. Und er fuhr von Sieg zu Sieg. Er konnte sprinten, er konnte klettern und er konnte als Ausreißer bestehen. Es gab kein Terrain, das ihm nicht gelegen hätte.
Als wir uns einmal nach einem Rennen, in dem uns Gaumont nach allen Regeln der Kunst um die Ohren gefahren war, auf den Weg zurück zu unserem Bauernhaus machten, schlossen sich uns ein paar französische Fahrer an, um noch ein paar zusätzliche Trainingskilometer zu absolvieren. Ich versuchte, am Ende der Gruppe mit einem von ihnen ins Gespräch zu kommen. Es bestand vornehmlich aus Gesten und Grunzlauten, aber als ich den Namen »Gaumont« fallen ließ, wussten wir beide, wer gemeint war. Wir waren an diesem Tag beide von diesem Untier zerpflückt worden.
Dann zeigte der Franzose auf seinen Arm, auf die Innenseite des Ellenbogens, wo sich die Venen abzeichneten. Er drückte seinen Daumen hinein und mimte einen Heroinsüchtigen, der sich eine Spritze setzt.
Dabei sagte er noch, zur Verdeutlichung: »Gaumont!«
Ich brauchte einen Moment, bis ich begriff, dass er Gaumont des Dopings bezichtigte. Ich schüttelte den Kopf.
»Noooon«, antwortete ich ungläubig.
Der Franzose blickte mir in die Augen.
»Mais oui!«, sagte er.
Am Abend, bei einer schönen Mahlzeit aus Rinderzunge und grünen Bohnen, kamen wir auf die Dopinggerüchte im Peloton der Profis zu sprechen. Wir behaupteten alle, genau zu wissen, dass unser jeweiliger Lieblingsfahrer sauber wäre und dass wir in puncto Doping keinerlei Toleranz besäßen. Wir waren uns einig, dass Doper schändliche Betrüger wären und Amerikaner so etwas gewiss niemals tun würden.
Diese verdammten Franzosen und Italiener kannten keine Skrupel, aber wir, als Amerikaner, waren moralisch überlegen und würden niemals auf solche unlauteren Mittel zurückgreifen. So wie ja auch Greg LeMond die Tour sauber gewonnen hatte, riefen wir unisono.
Schließlich schaltete sich unser dänischer Coach ein, der älter und erfahrener war als wir.
»In Italien glauben alle, die italienischen Fahrer wären sauber und nur die Franzosen würden dopen. In Frankreich glauben alle, die französischen Fahrer wären sauber und nur die Amerikaner würden dopen.«
Dann begann er Geschichten zu erzählen von Fahrern, die das Team wechselten und plötzlich entweder schneller oder langsamer wurden. Ich fragte, warum einer meiner Helden in seiner neuen Mannschaft nicht mehr so schnell wäre wie in seiner alten.
Er kicherte.
»Vielleicht ist das eher ein gutes Problem für ihn … gut für seine Gesundheit jedenfalls…«
Ich weigerte mich zu glauben, dass meine Helden auch nur in Betracht gezogen hätten, zu dopen.
»Vielleicht hast du recht«, zuckte er die Achseln, »aber geh nicht einfach davon aus, dass jemand, nur weil er Amerikaner ist, nicht versucht wäre, zu dopen.«
Wir saßen schweigend da und hörten zu, wie er sich darüber ausließ, dass Junioren auf der ganzen Welt exakt die gleiche Unterhaltung führten. Er sagte, dass sie alle sich wünschten, dass ihre Helden sauber wären. Uns war nie in den Sinn gekommen, dass unsere Ansichten von kulturellen Vorbehalten gefärbt sein mochten. Und auch nicht, dass jemand, nur weil er eine andere Sprache sprach oder eine andere Kultur pflegte, nicht auch die gleiche moralische Sicht der Dinge haben könnte wie wir.
»Jeder gute Fahrer wünscht sich, dass alle unter den gleichen Bedingungen antreten«, sagte er. »Denn ihr glaubt alle, dass ihr gewinnen werdet, solange keiner betrügt, weil ihr es für ausgeschlossen haltet, dass jemand besser sein könnte als ihr. Und daran ist nichts verkehrt, so ticken Champions nun mal.«
Nach unserer Rückkehr aus Europa schickten wir uns an, uns gegenseitig auf heimischem Boden auszustechen. Dies bedeutete natürlich, auf Juniorenrennen zu verzichten und bei den Profirennen zu starten, für die wir zugelassen waren, und das als 17-Jährige. Wollten wir Greg LeMond und Andrew Hampsten nacheifern, müssten wir uns, bevor wir 18 würden, auf lokaler Ebene gegen Kategorie-1-Fahrer und unterklassige Profis behaupten.
Ich reiste zu diesen Veranstaltungen mit meinem neuen Freund Colby Pearce. Er war ein Jahr älter als ich und besaß ein zuverlässiges japanisches Auto, das genug Platz bot für Räder und Gepäck. Es hatte sogar einen Fahrradträger. Darüber hinaus verband uns eine Vorliebe für düstere alternative Musik und schwarzgekleidete Gruftimädchen.
Colby war das genaue Gegenteil der anderen Radrennfahrer, die ich kannte. Er las Nietzsche, hasste jeglichen anderen Sport, ebenso wie dieses ganze Bruderschaftsgetue, toupierte Mähnen und in weiten Teilen auch das Leben als solches. Er war ohne Zweifel der ideale Reisegefährte.
Wir wurden beste Freunde und reisten durch die gesamten USA auf der Suche nach Rennen mit üppigen Preisgeldern, wo wir glaubten, zehn Jahre ältere Fahrer schlagen zu können. Wenn die Sache gut liefe, wussten wir, dass wir genug Spritgeld hätten, um zum nächsten Rennen zu gelangen.
Unser erstes Abenteuer begann mit einer Fahrt von Denver nach Oklahoma City. Anschließend fuhren wir, mit ein paar brandneuen Scheinen der US-Notenbank in der Tasche, zu einem fünftägigen Etappenrennen nach Bisbee in Arizona. All diese Freiheit und Entdeckungslust ging natürlich zulasten anderer Dinge: Die Schule kam ebenso zu kurz wie Partybesuche und das Kennenlernen der ersten großen Liebe im Algebra-Unterricht.
Wir schliefen in den Hotelzimmern anderer Leute auf dem Boden, waren stundenlang mit dem Auto unterwegs und fuhren dann Rad. Wir hatten keine Handys und keinen Kontakt nach Hause. Wir waren auf uns allein gestellt – zwei Teenager in einem weißen Honda mit zwei Fahrrädern auf dem Dach, auf einem ununterbrochenen Roadtrip, einer kontinuierlichen Fahrt in die Freiheit. Colby und ich wurden unzertrennliche, Duran Duran hörende Brüder der Straße.
Colby war ein interessanter Mensch, aber es mangelte ihm an innerer Ruhe. Er hatte früh seine Mutter an den Krebs verloren und dann wenige Jahre später seinen Vater an einen Herzinfarkt. Er war ein eiserner Atheist und argumentierte stets, dass kein Gott es zulassen würde, dass ein kleines Kind in so jungen Jahren solchen Schmerz und solchen Verlust erlitt.
Wann immer ein Rennen nicht gut lief oder er einen Defekt hatte, ereiferte sich Colby gegen Gott und brüllte in den Himmel: »Warum hasst du mich?!«
Bei einem dieser Wutausbrüche schleuderte Colby ein altes Campagnolo-Tretlagerwerkzeug in die Luft. Wir verloren es gegen die Sonne aus den Augen und glaubten, diesmal habe er vielleicht tatsächlich Gott höchstselbst getroffen. Bis mir das Werkzeug plötzlich auf den Fuß fiel. Mein Gesicht lief rot an und mein Fuß noch röter.
»Was soll der Scheiß, du Idiot?«, fragte ich.
Colby saß betroffen da.
Er entschuldigte sich sofort.
»Mein Fuß glaubt nicht, dass du Atheist bist, könnten wir das mit dem Gott-Anschreien also vielleicht auf ein Minimum reduzieren?«, tobte ich.
Nach dem Zwischenfall mit dem Werkzeug verlegten wir uns darauf, uns weniger in philosophischen Betrachtungen zu ergehen und mehr Depeche Mode und The Cure zu hören. Egal, welche Differenzen zwischen uns es auch geben mochte, wir waren uns einig über die richtige Art zu reisen und wurden Meister darin, Strafzettel zu kassieren und in leere Flaschen zu pinkeln, wenn wir keine Zeit zu verlieren hatten, um zum nächsten Rennen zu kommen.
Der letzte Halt unserer vierwöchigen Abenteuertour war ein Etappenrennen in Mammoth Lakes in Kalifornien. Gerüchten zufolge war die sowjetische Nationalmannschaft am Start und wir waren beide ängstlich und aufgeregt.
»Die Russen kommen…!«
Es war wie in der Szene in Breaking Away, als das Cinzano-Team aufkreuzt, um das Bloomington 100 zu bestreiten.
Die Stars der sowjetischen Mannschaft waren Wladislaw Bobrik und Jewgeni Bersin, die später beide sehr erfolgreich Karriere in Europa machten. Aber schon damals waren sie Legenden in unserer Welt, denn sie hatten den Amateursport in Europa in den letzten Jahren dominiert. Sie schienen dazu bestimmt zu sein, herausragende Profis zu werden, sofern ihre damals noch kommunistische Regierung ihnen gestatten würde, ein derart kapitalistisches Unterfangen zu verfolgen.
Begierig darauf, zu beweisen, dass wir es mit der russischen Großmacht aufnehmen könnten, unternahmen wir die 16-stündige Fahrt nach Mammoth Lakes. Wir hatten beide mit der Welt ein Hühnchen zu rupfen und wollten ihr zeigen, was wir draufhatten. Dies wäre eine gute Gelegenheit, allen zu beweisen, dass auch wir verdammt schnell waren.
Eine Menge Profis hatten für die Rundfahrt gemeldet, um mit den Sowjets die Klingen zu kreuzen. Uns standen fünf Tage und einige mehr als 150 Kilometer lange Etappen über Gebirgspässe und durch die Wüste bevor – es wäre das bei weitem härteste Rennen, das wir je bestritten hatten.
Die erste Etappe war ein Bergzeitfahren zur Skistation von Mammoth Lakes. Ich hatte keine Ahnung, was ich von mir oder der Konkurrenz zu erwarten hätte. Es war einfach eine Ehre, als 17-jähriger Träumer zu einem so prestigeträchtigen Rennen eingeladen zu werden.
Ich wusste, dass ich ein guter Kletterer war, und ich wusste, dass ich die richtige Einstellung fürs Zeitfahren mitbrachte, aber ich war noch nie gegen so starke Konkurrenz angetreten. Ich war zu nervös und aufgeregt, um viel zu frühstücken. Als wir uns zum Startbereich begaben, sah ich viele meiner Helden beim Aufwärmen. Da waren Alexi Grewal, Bobrik, Jeff Pierce, der bei der Tour de France die Etappe auf den Champs-Élysées gewonnen hatte, und viele mehr.
Als ich auf die Strecke ging, nahm ich mir nicht mehr vor, als nicht überholt zu werden – ich verspürte also keinen großen Druck. Dennoch verlangte ich mir so viel ab, dass ich im Ziel wieder in meine alte Gewohnheit des trockenen Würgens verfiel. Diesmal waren allerdings keine Mum und kein Dad da, um mich zu trösten, als ich in die Ecke kotzte.
Zwischen zwei Würgeattacken hörte ich den Rennsprecher rufen.
»Neue Bestzeit! Ein Fahrer, von dem ich noch nie gehört habe, aber trotzdem eine neue Bestzeit von Jonathan Vaughters.«
Ich war baff. Zwei Rennoffizielle baten mich, im Zielbereich zu bleiben, nur für den Fall, dass ich gewänne. Klar. Nur für den Fall, dass ich gewänne… Am Ende wurde ich Zweiter hinter Bobrik. Aber ich schlug mich die ganze Woche wacker gegen die Russen, durch die Berge, bei hohen Temperaturen und im Gegenwind. Keiner meiner Altersgenossen konnte glauben, was ich da anstellte, und ich konnte es ebenso wenig.
Schlussendlich war ich bei diesem Rennen derjenige, der alle anderen Fahrer aus der »goldenen Generation« des US-Radsports in den Schatten stellte. Das Ergebnis kam bald den Trainern des Nationalteams zu Ohren, die mir einen festen Platz im Kader für die Junioren-WM 1991 in Aussicht stellten.
Die WM fand in jenem Jahr erstmals in Colorado Springs statt. Der Kurs war eine bergige Schleife rund um den Garden of the Gods in über 2.000 Metern Höhe. Das perfekte Terrain für einen Fahrer, der die Höhe gewohnt war. Ich wollte unbedingt gewinnen. Ich wollte der erste Amerikaner seit Greg LeMond sein, der Junioren-Weltmeister wurde.
Im Vorfeld der WM absolvierten wir mehrere Trainingslager im Olympiastützpunkt (den wir mittlerweile, ziemlich treffend, »die Absteige« getauft hatten). Im Rahmen dieser Camps trafen wir hin und wieder auf den Jahrgang direkt über uns, der zu den Senioren aufgestiegen war, darunter auch Lance.
Es war wieder fast wie in der Highschool, die älteren Jungs wie Lance und Bobby machten einen auf cool und wollten mit uns Grünschnäbeln nichts zu tun haben. Natürlich liefen wir uns hin und wieder bei kleineren Rennen in Colorado über den Weg, was uns die Gelegenheit gab, den Jungs, die ein paar Jahre älter waren als wir, zu zeigen, dass wir ihnen sehr wohl das Wasser reichen konnten.
Bei einem dieser Trainingslager machte sich einmal ein Großteil der Fahrer auf, um sich am Mount Evans miteinander zu messen. Sowohl die Junioren- als auch die Senioren-Auswahl der US-Nationalmannschaft waren dabei, inklusive Armstrong. Es waren nur 45 Kilometer, aber die Luft wurde immer dünner, je höher man kam.
Unter den Senioren im Team USA herrschte ein vielleicht noch verbissenerer Konkurrenzkampf als bei den Junioren, denn sie buhlten um einen Platz im Olympiateam für 1992. Für sie zählte jedes Rennen oder zumindest jedes, bei dem die Trainer zugegen waren.
Die drei besten US-Fahrer waren dabei: Lance, Bobby und Darren Baker. Für uns Junioren war das die perfekte Gelegenheit, den Laden ein wenig aufzumischen, damit wir bei unserer Rückkehr zum Stützpunkt nicht in Mülltonnen gestopft und in Spinde eingeschlossen würden.
Ich wurde Fünfter, knapp hinter den älteren und etablierten Profis von Coors Light und Subaru-Montgomery. Lance, der in jenem Jahr das Etappenrennen Settimana Bergamasca in Norditalien gewonnen hatte, wurde Sechster. Das war ein schöner Achtungserfolg für mich.
Ein anderer Fahrer, ein Außenseiter namens Chad Gerlach, war ebenfalls im Trainingslager. Chad besaß immer den Schneid, es mit Lance aufzunehmen. Er war der einsame Wolf, der ständig versuchte, das Alphamännchen zu töten. Dies war für ihn die perfekte Gelegenheit, Lance ein wenig zu ärgern. Als wir vor den Betonbunkern abhingen, in denen wir schliefen, nahm er ihn aufs Korn.
»Tja, Lance, wie auch immer dieses Rennen heißt, das du in Italien gewonnen hast – Settimana Bergdorf Goodman oder weiß der Geier –, so schwer kann das ja nicht gewesen sein«, sinnierte Chad. »Ich meine – du wurdest gerade von einem 55 Kilo leichten Junior nassgemacht. Das tut schon weh, oder?«
So ging es tagelang weiter. Man sah, wie sich in Lance die Wut immer mehr aufstaute. Klar, wären die Rollen vertauscht gewesen, hätte Lance genauso den Hals aufgemacht. Eines Tages dann war Chad aus dem Camp verschwunden. Wie es hieß, hatte er es zu weit getrieben und Lance hatte ihn in den Schwitzkasten genommen und zu Boden gerungen. Angeblich war Chad sogar mit dem Kopf voran durch eine Gipswand gekracht.
Uns war klar, dass die Trainer etwas unternehmen müssten, und wir gingen davon aus, dass Lance entsprechend den Richtlinien im Olympiastützpunkt nach Hause geschickt würde. Worte waren das eine, aber Gewalt war dann doch eine andere Liga.
Als wir hörten, dass stattdessen Gerlach heimgeschickt wurde und nicht Lance, waren wir alle fassungslos. Die Botschaft der Trainer war allerdings ziemlich klar: Legt euch nicht mit dem Goldjungen aus Texas an. Für ihn galten die Regeln offenbar nicht.
Es waren nur noch wenige Wochen bis zur Junioren-WM und die Stimmung in der Absteige war angespannt. Die endgültige Kadernominierung stand bevor, sowohl für das Straßenrennen als auch das Mannschaftszeitfahren, alle waren nervös und gereizt. Der Kampf um die begehrten Plätze war in vollem Gange und die Samthandschuhe waren abgelegt worden.
Der Kader für die Weltmeisterschaften war zweigeteilt: auf der einen Seite das Team für das Mannschaftszeitfahren, auf der anderen Seite das Team für das Straßenrennen. Ich ging davon aus, ein sicherer Kandidat für das Straßenrennen zu sein, rechnete mir aber auch gute Chancen für das Mannschaftszeitfahren aus.
Auch Colby bewarb sich um einen Platz im Zeitfahrteam, also taten wir uns zusammen, um beim Paarzeitfahren zu starten, das USA Cycling ausrichtete, um zu ermitteln, wer für die WM nominiert würde.
Colby und ich waren überzeugt davon, dass wir es verdienten, nominiert zu werden, und dachten auch, dass wir das mit einem zweiten Platz im Paarzeitfahren ziemlich überzeugend nachgewiesen hätten. Dieses Rennen war aber nur ein Vorläufer des Vierer-Mannschaftszeitfahrens, mit dem die Trainer entschieden, wer mit wem fahren würde.
Eigentlich schien die Sache klar: Sie würden Colby und mich doch gewiss mit dem anderen stärksten Paar zusammenpacken, und das wäre dann der Straßenvierer für die Weltmeisterschaften. Als aber die Teams A, B und C für das letzte Ausscheidungsrennen verkündet wurden, fanden wir uns in Team B wieder.
Ich war stocksauer. Jeder wusste, dass die Trainer das abschließende Vierer-Mannschaftzeitfahren nutzen würden, um eine Auswahl zu finalisieren, die im Grunde bereits getroffen war. Sie hatten mich und Colby mit zwei anderen Kerlen zusammengetan, die uns keine große Hilfe wären, und verurteilten uns damit zum Scheitern. Es war kompletter Bockmist und ziemlich typisch für die Art und Weise, wie die Trainer beim US-Verband damals agierten. Sie hatten ihre Lieblinge und wir rangierten nicht besonders weit oben auf dieser Liste.
Also unterhielt ich mich mit Colby. Ich sagte, dass wir den fadenscheinigen Auswahlprozess boykottieren sollten und das ganze verfluchte Rennen gleich mit. Colby hatte ein wenig mehr Manschetten davor, sämtlichen Verbandstrainern ans Bein zu pinkeln, und meinte, er würde sich damit auf lange Sicht vermutlich keinen Gefallen tun – und er hatte recht. Aber nach ein paar weiteren selbstgerechten Predigten meinerseits sah ich das Feuer in Colbys Augen leuchten, ein Feuer, das Gott und alle Autoritäten verachtete. Er stimmte dem Boykott zu.
Mir war bewusst, dass ich mit einem Boykott meinen Platz für das Straßenrennen aufs Spiel setzte und dass die Trainer mir dies als Verrat auslegen würden. Aber ich war überzeugt davon, dass es wichtiger wäre, anderen Jungs zu zeigen, dass sie sich ein derart abgekartetes, einseitiges Nominierungssystem nicht bieten lassen dürften.
»Setze ein Zeichen, verdammt. Steh auf für das, was richtig ist, verdammt. Dies ist Amerika!«
Außerdem war es echt ein super Gefühl, ein Rebell zu sein. Ich kam mir vor wie mein größter Held der damaligen Zeit: Alexi Grewal, der Olympiasieger von 1984.
Ich liebte Alexi. Er spuckte auf Kameras und riss sich, wenn er Rennen gewann, das Trikot vom Leib, um dem Sponsor keine Publicity zu geben, wenn er das Gefühl hatte, von seinem Team schlecht behandelt worden zu sein. Er zeigte es »denen da oben«. Er machte es auf seine Weise, komme, was da wolle. Er war alles andere als ein Goldjunge. Alle Trainer und Manager hassten ihn, und er verachtete jede Form von Autorität. Ich wollte so sein wie er und das genaue Gegenteil von Lance.
Wie sich allerdings herausstellte, ließen sich osteuropäische Trainer von aufmüpfigen, eigensinnigen amerikanischen Teenagern nicht so leicht beeindrucken. Es war lustig, das Chaos zu beobachten, das wir anrichteten, es hatte aber seinen Preis. Ich wurde in das Büro der Cheftrainer zitiert, die mir unmissverständlich klarmachten, dass sie wussten, dass dieser Unfug auf meinem Mist gewachsen war, und dass ich, wenn ich zu irgendeiner Trainingsfahrt oder Teambesprechung auch nur zwei Sekunden zu spät käme, sofort aus der Mannschaft für die WM fliegen würde.
Mit meiner James-Dean-Rebellen-Nummer war es rasch vorbei. Ich entschuldigte mich und zog schmollend, mit eingezogenem Schwanz und gesenktem Kopf von dannen. Den Rest des Trainingslagers spurte ich ohne zu murren, stand kerzengerade, sagte artig »Ja, bitte« und »Danke«.
Das Team für das Mannschaftszeitfahren, bestehend aus George Hincapie, Fred Rodriguez, Chris Wherry und Matt Johnson, kam auch ohne mich prima zurecht und wurde Zweiter, womit sie die erste Medaille für das Team USA bei Junioren-Weltmeisterschaften seit mehreren Jahren holten. Die Trainer achteten darauf, dass ich auch ganz sicher wüsste, wie gut sich der Straßenvierer ohne mich geschlagen hatte. Ich hielt ausnahmsweise den Mund und wartete auf den Tag des Straßenrennens.
Ich muckte nicht mehr auf und wartete auf meine Chance, Weltmeister zu werden. Ich hatte mich im Vorfeld ein wenig neben der Spur gefühlt, vielleicht weil ich mit einer Erkältung zu kämpfen hatte, aber ich war zu nervös, um mir groß Gedanken darüber zu machen. Ich stand am Start, vor Aufregung zitternd.
Als ich mich umschaute, sah ich, dass es vielen genauso ging – Jungs aus aller Welt, denen die Düse ging. Es war ein angespannter Morgen. Im letzten Moment war die Startzeit verlegt worden, denn das ägyptische Team war eben erst, in alten Achtzigerjahre-Taxis, vom Flughafen eingetroffen.
Wir sahen zu, wie ihre Räder am Start zusammengebaut wurden. Diese Jungs, die gerade einen 20-stündigen Flug hinter sich hatten, sollten in fünf Minuten bei der WM an den Start gehen.
»Die halten vielleicht zwei Runden durch«, sagte ich zu mir selbst.
Die Startpistole ertönte und sofort war ich in Schwierigkeiten. Das Rennen war schnell und gefährlich. Bei einer WM waren hibbelige Junioren bereit, alles zu riskieren, denn ein erfolgreicher Auftritt auf dieser Bühne galt als erster Schritt auf dem Weg zum Profivertrag.
In den ersten Runden gab es zahlreiche Stürze. Ich ging den meisten davon aus dem Weg, wurde aber immer wieder aufgehalten und hatte Mühe, in Tritt zu kommen. Das US-Team galt als eines der stärksten im Rennen und wir wiederum wussten, von welchen Teams und Fahrern die größte Gefahr für uns ausging, allen voran von unserem alten Rivalen Philippe Gaumont.
Dennoch, wir fuhren ausnahmsweise auf heimischem Boden, im eigenen Land, und wir wussten, dass wir gewinnen könnten. Das Problem war nur, dass jeder von uns derjenige sein wollte, der den Sieg davontragen würde. Es war die klassische Zwickmühle des Radsports. Es ist ein Mannschaftssport, in dem am Ende nur einer den Ruhm erntet.
Wir alle wollten den Ruhm ernten. Aber einer wollte ihn ein bisschen mehr als die anderen und er hatte an diesem Tag keine Mühe, in die Gänge zu kommen: Jeff Evanshine.
Er kämpfte noch verbissener um den Anschluss an die Spitze, als er in der Bretagne darum gerungen hatte, nicht im eiskalten Regen ausgesetzt zu werden. Und als alles vorbei war, war es der dürre kleine Jeff, der den Sieg davontrug. Der unbeliebteste Bursche im Team, der Kerl, der in Frankreich das ganze warme Wasser für sich haben wollte.
Jeff nahm seine Rache dafür, im Regen stehen gelassen worden zu sein. Jetzt waren wir diejenigen, die im Regen standen und mit leeren Händen zusahen, wie er strahlend auf dem Podium stand, die regenbogenfarbenen Ringe des Junioren-Weltmeisters um die Brust, genau wie Greg LeMond.