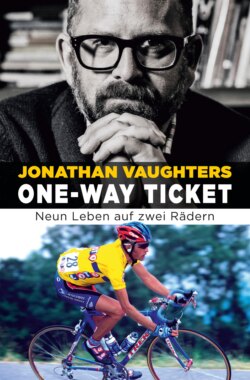Читать книгу One-Way Ticket - Jonathan Vaughters - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 2
Flucht nach vorn in Buckeye
Ich fuhr jeden Morgen mit dem Rad zur Schule. Wenn ich mich nachmittags auf den Rückweg machte, höre ich das johlende Gelächter der Kinder, die in Schulbusse drängten oder zum Football-Training gingen und die mich wegen meiner komischen Radshorts und des pottartigen Helms aufzogen. Es tat weh, das zu hören, und es tat weh, zu wissen, dass ich nicht dazugehörte, aber ich sagte mir, dass ich auf dem Weg war, mit einem viel cooleren Typen abzuhängen als mit den Kids von der Cherry Creek High. Sein Name war Frankie, ein Künstler, der die ganze Welt gesehen und sich seinen Lebensunterhalt als Radkurier in New York City verdient hatte.
Im Laden unterhielt mich Frankie mit Geschichten über große Radrennfahrer mit fantastischen und wunderlichen Namen wie Fons de Wolf. Er dozierte mit unerschütterlicher Überzeugung darüber, dass jegliche in Japan hergestellte Radkomponente absoluter Schrott wäre und dass das einzig wahre Fahrrad ein italienischer Stahlrahmen sei, der mit Campagnolo ausgestattet war.
Er verpasste mir einen italienischen Spitznamen, Gianni, und gab einige recht rabiate und voreingenommene Ansichten zum Besten.
»Shitmano zu fahren ist, wie mit Kondom zu ficken, Gianni. Es ist sicher, es funktioniert, aber es ist einfach Scheiße«, sagte er über den japanischen Komponenten-Giganten.
Der Laden wurde für mich zu einer Zuflucht. Es war ein Ort, den ich liebte und wo ich das Gefühl hatte, respektiert und verstanden zu werden. Über viele meiner leidvollen Teenagerjahre wurde er zu einem zweiten Zuhause.
Ein paar Tage nach meiner ersten Trainingsfahrt mit Bart fuhr ich zum Laden, um Frankie von meinem sonntäglichen Abenteuer zu erzählen und mein Rad, das eine einzige, von Eis und Salz zerfressene Sauerei war, wieder einwandfrei zum Laufen zu bringen.
»Wie ich höre, hat Bart dir den Hintern versohlt, Junge«, sagte Frankie zur Begrüßung.
Dann warf er einen Blick auf meine angeschlagene Maschine.
»Dieses Rad sieht aus wie ein einziges verfluchtes Desaster, du Idiot. Du musst auf deinen Scheiß Acht geben – Herrgott!«
Während Frankie mein Rad mit tätschelnder Fürsorge wieder flottmachte, saß ich im Hinterzimmer, an dessen Tür »Nur für Personal« stand, und lauschte seinen Geschichten über das Leben, den Radsport und das Dasein als Erwachsener. Es bereitete ihm eine diebische Freude, mich »Gianni« zu nennen. Hin und wieder, nach einer besonders strapaziösen Ausfahrt mit Bart, bekam ich ein Gianni-morto! zu hören: »Gianni-tot!«. Viele Jahre lang würde Frank sorgfältig »Gianni« auf das Oberrohr all meiner Räder pinseln.
Auch Franks Schwestern Dominique und Monica – deren Spitznamen Tiny und Priss lauteten – waren oft im Laden. Wie es hieß, war Priss, die Exfrau von Bart, einmal eine ziemlich gute Rennfahrerin gewesen.
Anfangs schienen sie von mir etwas irritiert zu sein, dieser halben Portion, die Frank ständig auf den Füßen herumstand, aber nach einer Weile fanden sie mich ganz süß. Für mich war diese ganze Erfahrung einfach nur erstaunlich: Ich hing mit einer Familie Erwachsener ab, die alles über Räder wussten. Das war so viel besser, als meine Zeit mit einer Horde Pennäler zu verbringen, die nichts als Football und Make-up im Kopf hatten.
Regelmäßig gerieten die Yantornos in aufsehenerregende Streitereien. Kettenblätter wurden auf Köpfe geschleudert, fantasievolle italienische Verwünschungen kamen ins Spiel und Franks Hund Ducco, ein recht angriffslustiger Chow-Chow, geriet in helle Aufregung und zerrte an der Kette, mit der er angebunden war und die öfter mal riss.
Jeden Monat kam ein neuer Katalog von Victoria’s Secret mit der Post. Ich wusste immer ungefähr, wann er eintreffen würde, und radelte wie der Teufel zum Laden, um einen Blick zu erhaschen. Wenn ich ankam, saßen Priss und Tiny im Büro und blätterten kichernd im Katalog. Sie taten so, als wäre es belangloses Zeug. Schließlich zogen sie mich ins Büro wie einen kleinen Bruder.
»Okay, Gianni, du kannst einen Blick hineinwerfen«, sagten sie. »Du musst solche Sachen ja mal gesehen haben, wenn du irgendwann eine Freundin haben willst.«
In der Highschool war ich weit, weit davon entfernt, eine Freundin zu haben. Nur wenige Cheerleader interessierten sich für Typen, die einen halben Kopf kleiner waren als sie, in Elastan-Shorts steckten und einen Kübel auf dem Kopf trugen. Aber Tiny und Priss bescheinigten mir Potenzial für die Zukunft und versicherten mir, dass ich eines Tages in meine enormen Ohren hineinwachsen und jemanden sehr glücklich machen würde. Sie wurden zu meinen großen Schwestern.
Ich öffnete mit leuchtenden, großen Augen den Katalog. Meine Fantasie ging mit mir durch. Ich fühlte mein Blut in Wallung geraten, wie es nur Jungs passiert, die in der Pubertät sind. Mit einem Mal wurde mir klar, dass von gleichaltrigen Kindern gehänselt zu werden nicht das einzige Problem war, wenn man eng anliegende Radhosen trug.
Ich hoffte, niemand würde es bemerken. Aber natürlich merkten sie es jedes Mal.
»Hey, Gianni, schöner Ständer!«, brüllte Frankie.
Priss und Tiny verteidigten mich.
»Fick dich, Frankie, du bist nur neidisch, weil du keinen hochkriegst!«
Sofort gab es wieder Zoff. Priss und Frankie gingen aufeinander los, und wieder flogen Kettenpeitschen, italienische Verwünschungen und Regina-Schraubkränze durch die Werkstatt. So plätscherte also Nachmittag um Nachmittag in wunderbaren Stunden dahin, während ich im Laden herumhing. Ich fand es großartig.
Unterdessen ging mein Training prächtig voran. Ich konnte die Verbesserungen von Woche zu Woche spüren. Ich wurde stärker und stärker und manchmal hatte ich das Gefühl, dass meine Beine irgendwann kräftig genug sein würden, um meine bollerigen Shorts auszufüllen.
Als ich mein Training intensivierte, entdeckte ich irgendwann ein klaffendes Defizit in meinen Fähigkeiten als Radsportler – meine Sprintqualitäten. Ich besaß absolut null Beschleunigung im Vergleich mit anderen Fahrern. In meinen ersten Rennen war mir diese Schwäche nicht aufgefallen, aber nun, da ich immer fitter wurde, machte es sich echt bemerkbar.
Sobald es darum ging, mit maximaler Power in die Pedale zu hämmern, stieß ich an meine Grenzen. Im Nachhinein hätte mich das nicht überraschen sollen, denn ich war gebaut wie ein Spargel mit Armen. Meine Knie waren deutlich breiter als jeder andere Teil meiner Schenkel und meine Beine sahen aus wie zwei Zahnstocher, die von einer Olive zusammengehalten wurden.
Ich begann mit Sprinttraining. Zweimal die Woche sprintete ich mir einen Wolf, um einen Tick mehr aus meinen Zahnstocherbeinen herauszuholen. Schön war das nicht. Anfangs konnte mich jeder schlagen. Jeder. Aber ich machte unbeirrt weiter, auch wenn es wie ein aussichtsloses Unterfangen aussah. Lange Sprints, kurze Sprints, Sprints bergauf und bergab, Sprints mit Rückenwind und Gegenwind. Jeden Dienstag und Samstag sprintete ich. Wieder und wieder.
Ich war mittlerweile geradezu besessen vom Training, aber eine andere Sache, mit der ich mich in der Vorbereitung auf das Red Zinger Mini Classic 1987 obsessiv beschäftigte, war das Material. Ich merkte schnell, dass der Radsport wie geschaffen war für Nerds. Ich verbrachte Stunden damit, Kataloge voller Messerspeichen und ausgebohrter Kettenblätter zu wälzen. Ich sparte, was ich konnte, um mir etwas zu kaufen, das mich ein klein wenig schneller machen würde.
Besessen war ich inzwischen auch vom Gewicht. Sehr zu Franks Leidwesen kaufte ich mir einen Alurahmen von Vitus. Frank meinte, er wäre völlig krumm und, da er von Franzosen gebaut worden war, zweifellos Schrott.
Ich bekam schnell mit, dass die Yantornos die Franzosen für so ziemlich alle Probleme auf der Welt verantwortlich machten.
Sie konnten keine Rahmen bauen, nicht kochen, keine Flugzeuge fliegen oder Autos bauen. Sie rochen schlecht und waren eingebildet. Vor allem aber waren sie der Feind jeder italienischen Radsport-Familie, die etwas auf sich hielt. Schlimmer noch, ich hatte den Ehrenkodex gebrochen, indem ich mir einen von Franzosen gebauten Rahmen zugelegt hatte.
Frankie kam allmählich auf Touren.
»Gianni, das Teil sieht aus, als hätte einer in die Muffen geschissen. Der Kleber quillt nur so raus. Ich fasse diesen Scheißrahmen nicht an, er hat wahrscheinlich Herpes.«
Schließlich konnte ich Frank doch überreden, mein superleichtes, kleines 50cm-Vitus aufzubauen. Er warnte mich, der Rahmen wäre zu weich und würde brechen, aber er dürfte meine Kräfte eindeutig überschätzt haben. Ich wies darauf hin, dass auch Sean Kelly ein Vitus fuhr. Frankie wollte trotzdem nichts davon hören.
»Gianni, Profis können alles Mögliche fahren und sind trotzdem schnell. Bernard Thévenet hat die Tour de France auf einem Rad gewonnen, das fürs Zeitungsaustragen gebaut wurde. Dein Vitus ist trotzdem kacke. Und das Gleiche gilt für das von Sean Kelly…«
Kacke hin oder her, ich liebte mein blaues Vitus.
Es fühlte sich leicht an unter meinen Beinen und schnell an den Anstiegen, und ich bezweifle, dass ich es mehr verbog als die Käse und Baguette mampfenden Franzosen, die es entworfen hatten. Ich wog nach wie vor nicht viel mehr als 45 Kilo und es zeichnete sich ab, dass das Klettern zu meiner Waffe im Rennen werden würde. Mittlerweile konnte ich bei den brutalen Wochenend-Einheiten mit Bart sogar dann mithalten, wenn es richtig steil wurde. Ich schien zwar immer viel mehr zu leiden als er, aber irgendwie gelang es mir, mich nicht abhängen zu lassen.
Bald begann es mit dem Einzug des Frühlings etwas wärmer zu werden und die Rennen des Sommers rückten allmählich näher. Wenn die Post kam, hielt ich fast ebenso gespannt nach Anmeldeunterlagen für Rennen Ausschau wie nach verirrten Victoria’s-Secret-Katalogen.
Die Rennen, die ich im letzten Jahr nur widerwillig zu Ende gefahren war, wurden nun zu einer Obsession. Ich zählte die Tage bis zum Start. Ich war aufgeregt und konnte kaum erwarten, dass es endlich losging, denn meine Solo-Trainingsrunden und die gemeinsamen Ausfahrten mit Bart am Wochenende wurden allmählich ein bisschen eintönig. Im Vorjahr war ich dem Kitzel des Wettkampfs verfallen. Immer nur zu trainieren, war, wie sich herausstellte, auf die Dauer etwas banal, zäh und bisweilen langweilig. Ich brauchte dringend Abwechslung.
Zum Glück gab es eine Stufe zwischen Training und dem eigentlichen Wettkampf. Sobald die Sommerzeit anfing, nahm Bart mich zu einer improvisierten Abendveranstaltung mit, dem Meridian Ride. Jeden Dienstag- und Donnerstagabend trafen sich um die 60 bis 70 Rennradfahrer aus Denver in einem Gewerbegebiet namens Meridian im Süden der Stadt, um eine Stunde lang Vollgas zu geben und so zu tun, als würden sie ein Rennen fahren. Der Meridian war und ist eine Institution in Colorados Radsportszene.
Der Meridian war allerdings Insidern vorbehalten. Man musste jemanden kennen, der wiederum jemanden kannte, der wusste, wann man sich einzufinden hatte. Es war eine Art Fight Club für Rennradfahrer. Nichts war offiziell: Es war geheim, es war illegal, es spielte sich mitten im Straßenverkehr ab und man sprach nicht darüber – mit niemandem.
Bart war der König dieses Fight Clubs auf zwei Rädern. Er war seit vielen Jahren unbesiegt und die Geschichten seiner Heldentaten verbreiteten sich in Colorados Radsportszene wie die Legende von Paul Bunyan. Sobald Bart glaubte, ich wäre bereit, vom Fight Club zu erfahren, lud er mich ein, es einmal zu probieren.
Ich fühlte mich geehrt, war aber auch tierisch nervös, jedoch würde mich keine noch so große Furcht dazu bringen, eine Einladung in den Underground auszuschlagen. Der Meridian wurde zu meiner Lieblingsbeschäftigung nach Schulschluss.
Absolut gar nichts am Fight Club war eine gute Idee. Die Bandbreite an Können und Begabung war enorm. Von Triathleten bis hin zu Bahnradsportlern war alles dabei: Männer, Frauen, Mädchen, Jungs, solche, die noch nie in einem Peloton gefahren waren, und solche, die es niemals hätten tun dürfen, bis hin zu Kategorie-1-Fahrern wie Bart. Jeder und jede war willkommen – sofern man cool genug war, davon zu wissen, natürlich.
Es gab keinen Papierkram, keinerlei Bürokratie. Es gab keine offizielle Distanz, keinen Start und kein Ziel, und es gab selbstverständlich keine abgeriegelten Straßen und keine Polizeieskorte. Man fand sich um sechs Uhr ein und los ging’s. Wir rasten über rote Ampeln, schlängelten uns durch den Verkehr und taten alles, was in unserer Macht stand, um jemandem eine Freifahrt im Krankenwagen zu verschaffen. Es war schnell, es war gefährlich und es war richtig geil.
Der Meridian war außerdem ein hervorragender Lehrmeister. Radrennfahren ist ein Sport, den man durch Wettkämpfe, durch Erfahrung, durch Versuch und Irrtum erlernt. Es gibt Dinge, die man nicht durch Coaching oder Anleitung erlernen kann. Die Art und Weise, wie sich ein Peloton in die Länge zieht und wieder sammelt, der fließende Tanz, der sich eingangs und ausgangs jeder Kurve abspielt. Der Fight Club mochte ein Traum für Anwälte und der Alptraum jeder Mutter sein, in jedem Fall aber war er ein sagenhafter Lehrmeister. Er lehrte mich, mich im Feld zu bewegen. Er lehrte mich, wie man das richtige Timing für eine Attacke fand, wie man ein Hinterrad hielt, wie man Fahrt aufnahm und wie man Stürze vermied – zumindest die meisten.
Wenn ich dienstags und donnerstags nach dem Meridian Ride nach Hause kam, zum zünftigen Abendessen meiner Mutter, fühlte ich mich jedes Mal wie ein blutverschmierter Krieger. Bei Hamburgern und Krautsalat erzählte ich meinen Eltern, dass ich immer besser lernte, mich in der Schlacht zu behaupten.
Ich sehnte das Ende des Schuljahrs herbei. Die Sommerferien konnten gar nicht schnell genug kommen. Ich konnte sie kaum erwarten, denn inzwischen waren meine Klassenkameraden auf den Trichter gekommen, dass ich der Typ war – der Typ, den sie überall in Elastan-Shorts herumfahren sahen. Im Mittleren Westen des Jahres 1987 war das gesellschaftlich schlichtweg nicht akzeptabel.
Ich gewöhnte mich daran, aus vorbeifahrenden Autos von Highschool-Kids, die gerade den Führerschein bekommen hatten, mit halbgefüllten Milchshake-Bechern beworfen zu werden. Und ebenso gewöhnte ich mich an die üblichen Beschimpfungen. »Schwuchtel« oder »Tunte« waren an der Tagesordnung. Inzwischen tat mir das nicht mehr weh; es machte mich einfach nur wütend. Eines Tages würde ich berühmt sein und diese Penner würden meinen Namen kennen.
Ich war nicht stark genug, mich physisch zur Wehr zu setzen, aber innerlich brannte ich darauf, es diesen Hohlköpfen heimzuzahlen. Irgendwie, irgendwann, würden sie es bereuen, mir diesen Scheiß anzutun. Und sollte es zehn Jahre dauern, dann wäre es halt so. Klein zu sein und schikaniert zu werden, weckte in mir ein starkes Bedürfnis nach Erfolg, um all die Leute Lügen zu strafen, und es schürte auch Wut. Eine Wut, die auf meinem Weg zum Radrennfahrer eine entscheidende Rolle spielte.
Es war an der Zeit, ein richtiges Rennen zu bestreiten. Ich hatte eine Anmeldung abgeschickt, die Teilnahmegebühr bezahlt, das T-Shirt und die Startnummern erhalten und sämtliche Haftungsausschlüsse unterschrieben. Frankie half mir, mein kostbares Rad auf Herz und Nieren zu prüfen, als wäre es das Christuskind in der Krippe. Sorgsam zeigte er mir, wie man die Kugellager wieder befüllte, die Züge wechselte, die Laufräder zentrierte und alles andere richtig einstellte. Als ich den Laden verließ, gab er mir ein paar warme und aufmunternde Worte mit auf den Weg für mein erstes Rennen.
»Ich will schwer hoffen, dass du dein verkacktes Froschfresser-Rad besser fährst, als du es warten kannst!«
Ich war bereit und ich war nervös. Auch meine Eltern waren bereit – bereit dafür, dass ich über diese komische Obsession endlich hinwegkommen würde. Wir verstauten eine Kühltasche mit Trinkflaschen, eine große Ration Fig Newtons, unseren Bedlington-Terrier und mein blaues Vitus im Kombi der Familie. Meine Mutter sorgte sich, ob ich genug gefrühstückt hätte, und mein Vater sorgte sich, ob wir rechtzeitig loskämen. Bald darauf rumpelte der strahlend blaue Oldsmobile nordwärts meiner Bestimmung entgegen.
Mein erstes Rennen war das Straßenrennen von Buckeye. Buckeye liegt mitten im Nirgendwo, Colorado, Schnarchnasenland in Reinkultur, nicht weit von Fort Collins. Wie jedes Rennen in Colorado ging auch dieses früh am Morgen los.
Mit den Jahren lernte ich, dass man kein richtiger Radsportler ist, solange man nicht vor Sonnenaufgang aufstehen muss. Wir parkten unser blaues Ungetüm auf einem Acker, luden mein Rad aus und machten uns daran, die Startnummern zu befestigen. Ich fand das alles extrem aufregend. Anders als im Vorjahr, als ich nur widerwillig mitgemacht hatte, war ich diesmal bis in die Haarspitzen motiviert. Ich brannte darauf, mich zu bewähren.
Der Geruch von Furcht lag in der morgendlichen Kälte. Die anderen Eltern huschten mit Walkie-Talkies umher, die Rennvorbereitungen ihrer Söhne koordinierend und gleichzeitig versuchend, jüngere Geschwister in dem ganzen Chaos nicht zu verlieren. Die Horde elterlicher Helfer hatte viel zu tun. Trinkflaschen wurden gefüllt, Helme wurden geschlossen und Schuhe mit Cleats unter den Sohlen wurden über Füße gestülpt.
Ich sah die Legenden des Vorjahrs und auch Chris Wherry, den Obermotz von allen. Nach dem heutigen Tag würden sie alle meinen Namen kennen, da war ich mir ganz sicher, dachte ich jedenfalls, obwohl ich nach wie vor nicht wusste, ob ich wirklich etwas taugte. Als ich das letzte Mal gegen diese Jungs angetreten war, hatte ich es jedenfalls nicht getan. Die Zweifel aus dem Vorjahr stiegen wieder in mir auf und ich hatte Schwierigkeiten, sie zu unterdrücken.
Das Rennen bestand aus einer Runde auf einer weitgehend flachen, 30 Kilometer langen Schleife an einem strahlend hellen, windstillen Sommermorgen. Stumm und zitternd vor Nervosität stand ich an der Startlinie. Der Knall der Startpistole hallte über die kahlen Felder und ich hatte Mühe, den freien Schuh ins Pedal einzuklicken. Ich hatte das wieder und wieder geübt, aber wegen meines Lampenfiebers stellte ich mich umständlich und ungeschickt an. Schon jetzt lag ich ein Stück hinter der Konkurrenz zurück, aber ich bahnte mir rasch den Weg zurück an die Spitze.
Sofort gingen die Attacken los.
Alle gingen bei jedem Antritt mit und so ging es im Feld hin und her, während immer wieder halbwüchsige Krieger versuchten, sich aus der Meute zu lösen. Über dem Geräusch der Räder war ein permanentes Schreien und Rufen zu vernehmen und die gebrüllten Warnungen vor den Attacken der anderen. Das Tempo war immer noch ziemlich hoch für die meisten 13-Jährigen und die Anstrengungen forderten allmählich ihren Tribut, sodass das Peloton Fahrer um Fahrer dezimiert wurde.
Auf den letzten acht Kilometern der Buckeye-Schleife gab es ein paar kleinere Hügel, die zum Ziel hin allmählich anstiegen. Ich beschloss, auf diesen Abschnitt zu warten, bevor ich meine Chance ergriff. Das Warten kam mir endlos vor. Ich wollte diesen Jungs unbedingt zeigen, was ich draufhatte. Aber ich wusste auch, dass ich mich in Geduld üben müsste. Ich wartete, ein Bogenschütze mit gespannter Sehne, der auf den perfekten Moment für den Schuss wartet.
Wir bogen rechts ab auf das letzte Stück und direkt hinein in den längsten Anstieg des weitgehend flachen Rennens. In einer kurzen Ruhepause, in der das Peloton vor dem Anstieg kollektiv Atem holte, startete ich meine Attacke. Da ich für die meisten anderen Kids ein unbeschriebenes Blatt war, wurde mir nicht sofort nachgesetzt. Binnen weniger Sekunden hatte ich einen kleinen Vorsprung herausgefahren. In diesem Moment geschah es, dass in mir ein tiefer, urwüchsiger Instinkt einsetzte.
Ich wurde gejagt und das Adrenalin der Angst flutete durch meinen Körper. Es war, als ginge es um mein Leben. Ich fühlte mich wie in einer Szene aus der BBC-Serie Planet Erde, ein einsames Gnu, das von einer Meute hungriger Schakale gehetzt wird. Aber dieses kleine, 45 Kilogramm leichte Gnu würde sich als eine echte Herausforderung für diese hochmütigen Schakale erweisen. Ich hatte mich noch nie so gefühlt, nicht im Rennen im Vorjahr und auch nicht im Training mit Bart.
Dieses Gefühl war etwas gänzlich Neues, etwas Wildes und Intensives. Es war eine Angst, wie ich sie nie zuvor verspürt hatte. Angst zu verlieren, Angst zu scheitern, Angst geschnappt zu werden.
Ich verspürte den Drang, in den Straßengraben zu fahren und einen Sturz vorzutäuschen, um mich nicht mit den Folgen eines Scheiterns auseinandersetzen zu müssen, aber auch den Drang, noch mehr aus mir herauszuholen und mich nicht von der Meute erwischen zu lassen. Es verlangte mir alles ab, mich nicht lähmen zu lassen von dem Wunsch, mich vor dem Ergebnis zu drücken, und mir stattdessen selbst einzuschärfen, dass ich alles daran setzen musste, die Flucht nach vorn zu ergreifen.
Ich rettete meinen Vorsprung über die Kuppe des Hügels. In weiter Ferne sah ich die Banner im Zielbereich. Jetzt glaubte ich allmählich daran, es schaffen zu können.
Ich wollte, dass meine Mutter mich als Ersten ins Ziel kommen sah.
Ich wollte, dass Frankie später im Laden von meinem Sieg erfahren würde.
Ich wollte Chris Wherry zeigen, dass ich stärker war als er.
Und ich wollte all den Deppen von der Schule beweisen, dass ich mehr war, dass ich etwas Besseres war, als sie begriffen. Ich war das Gnu, das würdig war, die Herde anzuführen. Ich wollte gewinnen.
Ich nahm den Kopf so weit runter wie möglich und trat weiter Richtung Ziel, nur einmal unter meinem Arm zurückblickend, ob die anderen mich einholen würden.
»Lass sie nicht. Lass sie nicht. Lass. Sie. Nicht«, sagte ich mir, wieder und wieder.
Mein Verlangen danach, zu gewinnen, hatte inzwischen mehr mit der Angst davor zu tun, eingeholt zu werden, als mit der Freude darüber, zum Sieg zu fahren. Ich war besessen davon, es den Leuten zu zeigen. Besessen davon, alles Negative zu überwinden. Meine Hände krallten sich in den Lenker, während ich gegen den Wunsch ankämpfte, nur ein klein wenig langsamer zu fahren.
Ich keuchte wie ein Güterzug und meine Beine waren wie aus Gummi, aber von meinen Trainingsfahrten mit Bart wusste ich: Wenn es etwas gab, worauf ich mich bei meinem schmächtigen kleinen Körper verlassen konnte, so war es die Fähigkeit, eine enorme Menge Schmerz zu ertragen und zu bewältigen. Und das tat ich auch.
Statt zu versuchen, den Schmerz, den ich verspürte, zu ignorieren oder zu minimieren, tauchte ich in ihn ein, umarmte ihn, konzentrierte meine Gedanken auf ihn – fast, als wäre ich süchtig nach ihm. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, das Heft in der Hand zu halten. Als mein Körper mich wieder und wieder aufforderte, mich zurückzunehmen und es langsamer angehen zu lassen, stellte ich mir ein gigantisches rotes Schild vor, auf dem NEIN stand.
NEIN dazu, das Tempo etwas zu drosseln. NEIN dazu, aufzustecken, NEIN dazu, mich einholen zu lassen, NEIN zum Scheitern.
Ich konnte zwar kein Mädchen dazu überreden, mit mir zum Schulball zu gehen, noch konnte ich meine Abschlussprüfung in Algebra bestehen, aber ich konnte meinen Körper dazu zwingen, dem Schmerz auf eine Weise zu widerstehen, wie es andere Menschen nicht konnten, nur damit ich auf dem Rad ein bisschen schneller war.
Das Feld formierte sich zu einer späten Verfolgungsjagd, aber es war zu spät. Lieber wäre ich gestorben, als mich noch einholen zu lassen, und genauso fuhr ich. Als ich mich dem Ziel näherte, schaute ich mich ein einziges Mal um. Und ich sah, dass niemand hinter mir war. Ich hätte schon viel früher den Sieg bejubeln können, aber aus Angst gab ich weiter Vollgas, bis ich die Ziellinie unter mir sah. Dann endlich riss ich einen Arm in die Höhe.
Das Gefühl der Erleichterung war intensiv und strömte durch mich hindurch, als wäre ich in eine warme Wolldecke gehüllt worden, nachdem man mich aus stürmischer See gerettet hatte. Ich hätte überschwängliche Freude verspüren sollen, so zumindest heißt es immer. Aber ich empfand im Moment des Sieges keinen triumphalen Stolz oder dergleichen.
Ich war einfach nur froh, niemanden enttäuscht zu haben. Nicht Frankie, nicht meine Mutter und auch nicht Bart. Und zu guter Letzt hatte ich gewonnen.