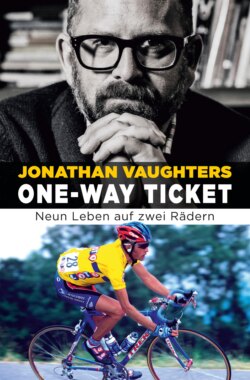Читать книгу One-Way Ticket - Jonathan Vaughters - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеKapitel 5
Das große Abenteuer
Es war nicht leicht, sich nach dem Höhepunkt der Junioren-WM wieder im schnöden Alltag einzufinden. Es war ein heißer und fauler August in Colorado und während meine Freunde sich darauf vorbereiteten, aufs College zu gehen, machte ich Nickerchen auf der Couch und versuchte, die Realität auszublenden, die vor mir lag.
In vier kurzen Jahren hatte ich mich von einem letzten Platz in meinem allerersten Rennen bis zur Teilnahme an einer Weltmeisterschaft nach oben gekämpft. Ich hatte mich als einer der besten Junioren der Welt bewährt und glaubte, dass mir eine große Karriere bevorstünde. Aber die große Frage lautete nun: Was käme als Nächstes?
Meine Eltern machten sich Sorgen, dass ich die Perspektive, aufs College zu gehen, nicht besonders ernst nahm. Ich war lustlos und absolvierte nur um etwas Beschäftigung zu haben, ein paar Trainingseinheiten und Rennen, jedoch ohne recht zu wissen, welches der nächste Schritt sein würde.
Ich würde nicht mehr in der Juniorenklasse antreten können und müsste mich in Zukunft bei Seniorenrennen mit erfahrenen Profis messen – nicht weil ich das so wollte, sondern weil mir keine andere Wahl bliebe, wollte ich weiter Wettkämpfe bestreiten.
Könnte ich mir weiter Mums Kombi borgen? Müsste ich mir einen Job suchen? Gäbe es ein Seniorenteam, das mich fördern und sogar sponsern würde?
Oder würde ich wie die Horden anderer 24-jähriger Möchtegernprofis enden, die im Keller ihrer Eltern lebten, eifersüchtig auf diejenigen, die einen Profivertrag ergattert hatten, und immer noch davon träumend, eines Tages groß rauszukommen?
In meiner endlosen Freizeit entschied ich, dass es vielleicht nicht schaden könnte, ein paar Kurse am örtlichen Community College zu belegen. Da ich zudem ein paar Dollar als Taschengeld verdienen müsste, wäre es auch keine schlechte Idee, ein paar gut dotierte Rennen auf lokaler Ebene zu bestreiten. Zum Glück dachte Colby ganz genauso.
Wie zwei Glücksritter auf Schatzsuche zogen wir los zu einigen Lokalrennen, um ein wenig leicht verdientes Preisgeld abzugreifen. Das Etappenrennen von Steamboat Springs war die erste dieser Veranstaltungen. In der Überzeugung, auf die Schnelle ein paar hundert Dollar kassieren zu können, meldeten wir uns für das Rennen für Kategorie-1-Amateure und Profis an.
Auf der Fahrt dorthin lag Colby mir pausenlos wegen eines Mädchens in den Ohren, mit dem er Schluss machen wollte, aber er hatte nicht den Mumm, es ihr zu sagen. Das war typisch Colby. Er war ein Meister darin, Mädels herumzukriegen, denn sobald sie hörten, dass er früh seine Eltern verloren hatte, wollten sie ihn bemuttern und ließen sich mit ihm ein. Er spielte diese Karte häufig und das überaus geschickt.
»Pass auf, wir machen eine Wette«, sagte ich zu ihm. »Falls ich das Rennen gewinne, musst du sofort mit ihr Schluss machen.«
Darüber lachte er nur.
»Alter, du wirst im Leben nicht als Junior das Kategorie-1-Rennen gegen Profis gewinnen – keine Chance. Es sind viel zu viele gute Fahrer am Start.«
Wir besiegelten die Sache per Handschlag und kamen überein, dass er, falls ich gewinnen sollte, an der ersten Telefonzelle halten und es ihr sagen würde.
Keiner von uns beiden brachte viel Energie oder Lust auf für ein kleines Rennen in Steamboat Springs am Ende der Saison. Aber die Wette entfachte meinen Kampfgeist.
Drei Tage lang stritten wir in den Colorado Rockies mit den besten, im Keller ihrer Eltern lebenden Möchtegernprofis von Boulder um den Sieg. Es war nicht leicht, denn seit der Junioren-WM hatte ich nicht besonders ernsthaft trainiert, aber ich warf alles in die Waagschale, was ich an Kräften mobilisieren konnte. Als das Rennen vorbei war, hatte ich 5.000 Dollar in bar, einen Titanrahmen von Moots und vor allem die Wette gegen Colby gewonnen.
Anschließend stand ich neben Colby auf dem Parkplatz des Rabbit Ears Motel an einer Telefonzelle und wartete, dass er den vereinbarten Anruf hinter sich brachte. Er protestierte und meinte, dass er sie eigentlich doch ganz gern habe und gar nicht Schluss machen wolle. Ich sagte, das sei schon in Ordnung, dann solle er sie gleich anrufen und fragen, ob sie ihn heiraten will.
Schließlich, nach langem Hin und Her, rief er sie an und telefonierte zwei Stunden lang mit ihr. Da er endlos um das Thema herumdruckste, lief ich herum auf der Suche nach weiteren Münzen für den Fernsprecher. Schließlich ließ er die Bombe platzen.
Es war alles passé: unsere Unschuld, unser letztes Juniorenrennen, unsere Saison und nun auch seine Beziehung. Auf der Fahrt zurück nach Hause hörten wir The Cure in Endlosschleife.
Da die Rennsaison für dieses Jahr vorbei war, begann ich widerstrebend, Kurse am berüchtigten Metro State College zu besuchen. Aufs Metro ging man nur, wenn die Noten nicht gut genug waren, um irgendwo anders unterzukommen.
Ich hatte mich für einen Studiengang irgendwo zwischen Philosophie und Kunst entschieden, denn beides würde meinem Training nicht allzu sehr in die Quere kommen, sollte ich für das nächste Jahr tatsächlich ein Team finden. Ich weiß nicht warum, aber ich machte mir keine allzu großen Gedanken darüber, ob sich etwas ergeben würde oder nicht, ich vertraute einfach darauf, dass Radfahren meine Bestimmung wäre und ein gutes Team schon irgendwie auf mich aufmerksam werden würde.
Um meine Eltern zu beschwichtigen, bürdete ich mir ein zermürbendes Seminarprogramm auf, das daraus bestand, Aristoteles zu erörtern und impressionistische Bilder zu malen. Offiziell ging ich ja aufs College, also konnten sie nicht klagen. Trotz meines harten akademischen Stundenplans trainierte ich jeden Tag, zwar ohne besonderen Fokus, aber ich betrachtete es irgendwie als meinen Job.
Da ich mit Radfahren mehr Preisgeld zusammengespart hatte, als die meisten meiner Freunde damit verdienten, Pizza auszuliefern, hielt ich mich für berechtigt, es als meinen Job anzusehen. Ich wollte es auf jeden Fall zu meinem Beruf machen, aber irgendjemand – ein Team, ein Sponsor – würde nachhelfen müssen.
Das führte dazu, dass ich viel Zeit damit verbrachte, neben dem Telefon zu warten. Manchmal den ganzen Tag. An manchen Tagen kam es mir vor, als wartete ich darauf, dass das Mädchen, mit dem ich zum Schülerball wollte, endlich zurückrufen würde. Falls sich kein Team und auch niemand sonst finden würde, der mich sponserte, würde es schwer sein, im Radsport Fuß zu fassen, das war mir klar.
Ich war bereits als bester Kategorie-1-Allrounder in Colorado ausgezeichnet worden, auf regionaler Ebene gab es für mich also nicht mehr viel zu holen. Mit dem Nationalteam würde ich ein paar Rennen in Europa und Südamerika bestreiten, aber das würde mich finanziell nicht weit bringen und meine Möglichkeiten einschränken, mich auf nationaler Ebene zu zeigen.
Ich wohnte noch zu Hause, in meinem Kinderzimmer, und fraß mich auf Kosten meiner Eltern durch. Das war genau das, was ich unbedingt vermeiden wollte. Ich hatte so viele talentierte junge Fahrer erlebt, denen es nicht ganz vergönnt war, in Juniorenrennen die großen Teams auf sich aufmerksam zu machen, und die sich dann irgendwie durchschlagen mussten, um weiter Rennen fahren zu können.
Dazu gehörte meistens, bei den Eltern zu wohnen, um Spritgeld zu betteln, irgendeinen Teilzeitjob anzunehmen, nebenbei noch zu versuchen, so viel wie möglich zu trainieren, und bei all dem schlussendlich wie ein Loser dazustehen im Vergleich mit Freunden, die aufs College gingen. Ich schaute auf die Fahrer herab, denen es so ergangen war, aber nun war ich drauf und dran, selbst einer von ihnen zu werden.
Stattdessen wollte ich wie Lance oder Bobby Julich sein. Nachdem er dem Juniorenbereich entwachsen war, kam Lance sofort bei einer großen Mannschaft namens Subaru-Montgomery unter und erhielt einen Batzen Geld. Er lebte nicht mehr bei den Eltern, sondern hatte seine eigene Wohnung, sein eigenes Einkommen und seinen eigenen Camaro. Das war das Leben, von dem ich träumte.
Ich schickte Bewerbungen los, versuchte offene Gefallen einzufordern, tat, was immer ich tun konnte, um jemanden auf mich aufmerksam zu machen und dazu zu bringen, mich anzurufen. Dann endlich war es so weit.
Als der Anruf kam, ging meine Mutter unten ans Telefon und rief die Treppe hinauf. Ich nahm ab und vernahm eine merkwürdig knurrige, kratzige Stimme.
»Hallo, Jonathan, hier spricht Warren Gibson.«
Warren Gibson hatte ein paar Jahre vorher das Team Plymouth-Reebok geleitet und war gut mit Greg LeMond befreundet. Er war in der Radsportwelt als nonchalanter, aber zuverlässiger Macher bekannt. Er hatte Paul Willerton geholfen, in LeMonds Z-Team unterzukommen, es konnte also nicht schaden, ihn auf seiner Seite zu haben.
Er erklärte, dass er mich beim Rennen in Mammoth Lakes gesehen habe und beeindruckt gewesen sei von meiner Fähigkeit, den Russen die Stirn zu bieten. Er stellte für die Saison 1992 ein neues Team auf die Beine und wollte, dass ich Teil davon wäre.
Er klärte mich über mein Gehalt auf (1.500 Dollar im Monat!), legte dar, welche Rennen das Team bestreiten würde, und erläuterte dann sogar, wie er gedachte, mich in Greg LeMonds Mannschaft in Europa unterzubringen. Ich war so aufgeregt, dass ich beinahe gequiekt hätte. Das war’s. Dies war meine Chance, aus dem Keller meiner Eltern herauszukommen.
Das Team würde von Saturn gesponsert – einem Ableger des Automobilkonzerns General Motors – und um Bob Mionske, den Viertplatzierten der Olympischen Spiele von 1988, herum aufgebaut.
Nominell als Amateurteam antretend – unsere Gehälter wären offiziell »Rückerstattungen von Lebenshaltungskosten« –, wäre es unser Ziel, so viele Fahrer wie möglich zu den Olympischen Spielen 1992 zu bringen, allen voran Bob. Nachdem ich eine Stunde lang Warrens nicht gerade besänftigender Stimme gelauscht hatte, lief ich die Treppe hinunter und erklärte meinen Eltern aufgeregt, dass ich fortan keine Verwendung mehr für sie hätte.
Sie freuten sich, dass ich Geld verdienen würde, waren aber nicht begeistert darüber, dass ich im Frühjahr nicht aufs College gehen würde. Aber es führte kein Weg daran vorbei: Dies war mein erster Schritt, um ein echter Radprofi zu werden.
Gleich nach Neujahr erhielt ich mit der Post den Scheck von Saturn mit meiner Unterschriftsprämie und zog los, um mir für 2.000 Dollar einen rostigen Porsche Baujahr 1971 zu kaufen. Es war nicht leicht, mein Rad in einem Porsche unterzubringen, aber das war mir egal. Ich brauchte ein Auto, das meine Persönlichkeit zum Ausdruck brachte, und ohne Zweifel tat ein kaum funktionstüchtiger, rostiger oranger Porsche genau das.
Als ich im Trainingslager in Los Gatos, Kalifornien, eintraf, sah ich einen korpulenten, walrossartigen Mann mit Schnauzer und blankem Kahlkopf mühsam in Richtung meines Autos hopsen, als ich auf den Parkplatz bog. Das war Warren.
Er begrüßte mich so, wie ein Vater einen Sohn begrüßt, der nach vielen Jahren aus dem Krieg heimkehrt. Er packte mich, drückte mich, nannte mich immer wieder »Kleiner« und führte mich durch das beste Motel, das Los Gatos zu bieten hatte. Meine Güte, der Bursche war echt aufgeregt, sein eigenes Radsportteam zu haben, und sein überbordender Enthusiasmus war ansteckend.
Die Leute nannten ihn »Gibbo« – oder auch »Walross«, allerdings nur hinter seinem Rücken – und Gibbo war wie ein Kind mit einem sehr großen, sehr neuen Spielzeug. Ich konnte kaum glauben, mit welchen Unmengen an Geld und Krempel um sich geschmissen wurde, um einen solchen Laden am Laufen zu halten. Es gab Gratis-Polohemden, die mit dem Teamnamen bestickt waren, und Teamfahrzeuge, die mit Sponsorenlogos zugepflastert waren. Jeder Fahrer erhielt Gratis-Radbekleidung und dazu einen Helm. Für einen 18-Jährigen war es das Radsport-Nirwana. Ich war gewohnt, die Spritkosten aus eigener Tasche zu zahlen und bei Leuten auf der Couch zu schlafen. Nun übernachtete ich in Hotels und musste mir keine Gedanken um Anmeldegebühren machen. Noch dazu wurde ich jeden Monat bezahlt! Dieses Team war echt nobel.
Abends gingen wir zum Steakessen ins Chart House, wir absolvierten Fotosessions für das Sunset-Magazin, wir wurden für Autoreklame gefilmt. Wir hielten uns für die Rockstars der kalifornischen Radsportszene. Bald erschien dann auch der echte Rockstar, Bob Mionske, im Camp. Für uns war das wie die Wiederkunft Christi.
Bob war der Grund, warum das Team existierte, denn er fuhr zu den Olympischen Spielen und die Leute trauten ihm sogar eine Medaille zu. Saturn jedenfalls glaubte fest daran, dass er Edelmetall holen würde. Dieser Glaube war seinem vierten Platz bei den Spielen 1988 in Seoul geschuldet. Das Resultat hatte ihm außerdem einen ziemlich witzigen Spitznamen beschert.
Bob liebte es, sich in der Sonne zu bräunen. Er konnte die Bräunungsstreifen, wie sie typisch sind für Radrennfahrer, nicht leiden und legte sich deshalb stundenlang in die Sonne. Viele Jahre lang war er unter seinen Kollegen als »Bronze Bob« bekannt. Nach seinem vierten Platz bei den Spielen von Seoul, wo er beinahe Bronze geholt hätte, wurde daraus »Beinahe Bronze Bob«.
Er selbst war davon nicht so begeistert.
Ich lernte außerdem meine neuen Teamkollegen und Mitbewohner in der Los Gatos Lodge kennen. Andrew Miller war College-Absolvent mit einem Abschluss in Informatik oder Maschinenbau oder etwas in der Art. Er las viele Bücher, beschäftigte sich nur aus Spaß an der Freud mit Mathematik und erzählte gern Geschichten darüber, wie er mal am College im Chemielabor mit dem Laser Borblechplatten geschnitten hatte.
Der andere war Dave McCook. Daves Lieblingsbeschäftigung war es, durch das Fenster des Fitnessstudios Frauen beim Aerobic oder Yoga anzustarren. Das machte er stundenlang, wobei er mit dem Finger auf die Damen wies, die er besonders attraktiv fand.
Trotz unserer unterschiedlichen Interessen genossen wir es, gemeinsam zu trainieren und zu Wettkämpfen in Nordkalifornien zu fahren. Und wir kochten zusammen, hauptsächlich mit meinem Schongarer. Das Ding war ein Wunder: Man warf einen Haufen Lebensmittel hinein und wenn wir von einer langen Fahrt zurückkehrten, waren sie zu einer Art essbarer Pampe verkocht, die wir zu Abend aßen.
Leider reisten wir einmal zu einem einwöchigen Rennen nach Oregon und vergaßen, dass wir einen Topf Pintobohnen aufgesetzt hatten, als wir unseren Palast in Los Gatos verließen. Zum Glück zog das Zimmermädchen nach ein paar Tagen den Stecker raus. Daher erwartete uns bei unserer Rückkehr kein kurzschlussbedingtes Flammenmeer, sondern nur ein lauwarmer, urzeitlicher Schlamm, der immer noch im Topf vor sich hin gor.
Wir fuhren in jenem Jahr zu Rennen im ganzen Land, auch zu größeren Events, bei denen wir uns mit namhaften Profiteams maßen. Aber das große Ziel für das Team Saturn blieben die US-Olympia-Ausscheidungen. Gibbo bläute uns ein, wie wichtig diese Rennen für das Team und den Sponsor waren. »Beinahe Bronze Bob« in die Olympiamannschaft zu bekommen, war unser absolutes Minimalziel, und Gibbo wollte außerdem einen zweiten Saturn-Fahrer zu den Spielen 1992 in Barcelona bringen.
Das war sehr ambitioniert, denn es waren dort überhaupt nur drei amerikanische Fahrer zugelassen. Lance war bereits ein sicherer Kandidat, somit waren es eigentlich nur zwei Plätze. Gibbo aber pochte auf dieses Ziel mit einem Nachdruck, wie er mir noch nicht untergekommen war. Vom großväterlichen, warmherzigen Mentor war nichts mehr zu sehen, an seine Stelle war ein unter Hochdruck stehender Geschäftsmann getreten.
Die Olympia-Ausscheidungen waren eine ziemlich simple Geschichte. Es würde zwei Eintagesrennen geben, beide von ungefähr gleicher Distanz und Beschaffenheit wie das Olympische Straßenrennen. Die beiden Rennen lagen ein paar Tage auseinander und wer aus beiden die meisten Punkte holte, würde automatisch einen Platz im Olympiakader für 1992 erhalten.
Im ersten Rennen wurde außerdem der Landesmeister ermittelt und weil wir zahlenmäßig überlegen waren, dominierte das Team Saturn das Rennen. Chann McRae gewann schließlich dank einer überragenden Teamstrategie, mit der die im Vorfeld als Favoriten gehandelten Lance Armstrong und Darren Baker isoliert wurden und nicht reagieren konnten. Allerdings hätte ich beinahe alles vermasselt, indem ich zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt attackierte und Lance’ Zorn entfesselte.
Meine Teamkollegen waren ziemlich genervt von mir, und das zu Recht. Es war eine echt dumme Aktion von mir, aber es waren die Zeiten vor dem Teamfunk, und Informationen waren im Rennen schwer zu bekommen.
Dies ist nach wie vor einer der wichtigsten Gründe, warum ich die Verwendung von Funk im Rennen befürworte: Es hilft, dumme Aktionen im Rennen zu verhindern und Entscheidungen auf Basis verlässlicher Informationen zu treffen. Wie auch immer, trotz meiner Dummheit gewannen wir das Rennen und hatten eine perfekte Ausgangslage, um zwei Fahrer in die Olympiamannschaft zu bringen.
Ich war entschlossen, meinen Fehler im zweiten Ausscheidungsrennen wieder gutzumachen, und fand mich bald mit meinem Teamkollegen John Lieswyn in der Spitzengruppe wieder. John war etwas älter als der Rest der Saturn-Mannschaft und hatte nur Außenseiterchancen auf einen Platz im Olympiakader. Sein Spitzname lautete »Twister«, seit er es in einem früheren Rennen im Jahr fertiggebracht hatte, sich die Eier zu verdrehen, woraufhin er eilends in die Notaufnahme gebracht werden musste, um sie zu entwirren.
Seitdem benutzte er eine zusätzliche Polsterung in seinen Radhosen. Ich mochte Twister sehr. Er war ein Eigenbrötler und ein Rebell. Ich hielt das für sehr cool.
Bei den Trainern stand er nicht so hoch im Kurs, aber er war ein schwarzes Schaf, das in der Lage war, ein paar verdammt große Rennen zu gewinnen. Sobald wir uns zusammen mit ein paar Mitstreitern vom Feld abgesetzt hatten, machte ich vorne im Wind das Tempo, um ihm den Goldjungen vom Leibe zu halten. Und es funktionierte.
Eine Runde vor Schluss auf dem schweren Kurs hatten wir weiter einen Vorsprung auf das Peloton. In der letzten Runde konterte ich dann für Twister so viele Attacken, wie ich konnte, bevor ich, erschöpft von der ganzen Verfolgungs- und Nachführarbeit, schließlich wenige Kilometer vor dem Ziel abreißen lassen musste.
Obwohl ich aus der Spitzengruppe zurückgefallen war, winkte mir immer noch ein gutes Resultat in dem vielleicht prestigeträchtigsten Eintagesrennen für Amateure in den USA. Das wäre etwas, auf das ich ziemlich stolz sein könnte und das sich in meinen Bewerbungsunterlagen gut machen würde.
Doch während ich Richtung Ziel rollte, fing ich an zu rechnen und mir wurde klar, dass ich, sollte ich mich vor ihm platzieren, Beinahe Bronze Bob ein paar wertvolle Punkte stehlen würde, die er brauchte, um sich einen automatischen Platz in der Olympiamannschaft zu sichern. Ich wusste, dass Bob fast sicher den Sprint der Verfolger gewinnen würde.
Daher, und im Wissen, welch miserabler Teamkollege ich im vorigen Rennen gewesen war, beschloss ich zu warten, bis Bob mich passiert hätte. Ich nahm die Beine hoch und blieb sogar fast stehen. Meine aussichtsreiche Position im Rennen war damit natürlich dahin.
Ich weiß nicht, welches letztendlich die genauen Auswahlkriterien und der finale Punktestand waren, jedenfalls schaffte es Bob in die Olympiamannschaft, Twister und Chann schafften es fast, und auf mich war niemand mehr sauer. Gibbo kam nach dem Rennen zu mir und umarmte mich für meine uneigennützige Tat. Er meinte, solche Selbstlosigkeit sei im Radsport selten, aber nun, da ich mich dem Team gegenüber so loyal gezeigt hätte, würde das Team sich gewiss revanchieren.
In diesen zwei Tagen verstand ich zum ersten Mal wirklich, wie sich im Radsport die Beziehung zwischen Sponsor, Teamleitung und Fahrern gestaltete. Gibbo war in den Wochen vor der Olympia-Ausscheidung unglaublich gestresst und er übertrug viel von diesem Druck direkt auf die Fahrer und Betreuer.
Ich bin sicher, dass Saturns Marketingabteilung regelmäßig anrief und fragte: »Wie schaut es denn aus mit den Startplätzen für Olympia?«
Er spürte diese Bürde und gab den Druck wiederum ans Team weiter. Nachdem wir umgesetzt hatten, was von uns erwartet wurde, fiel der Druck von ihm ab und wandelte sich sofort in Freude oder zumindest Erleichterung. Im Hinblick darauf, wie sich kommerzieller Druck auf den Sport und die Athleten auswirkt, war das ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Zukunft für mich bereithalten sollte.
Für den Moment freute ich mich für die Mannschaft, aber es fiel mir schwer zu vergessen, wie sich diese beiden Rennen zu Drucksituationen gewandelt hatten, in denen es nur noch darum ging, den Sponsor bei Laune zu halten. Das Geld kam an erster Stelle, der sportliche Wettkampf erst danach.
Leider waren meine Tage im Team gezählt. Gibbo plante, mit dem Team im folgenden Jahr in den Profibereich zu wechseln, und befand, dass ich noch nicht bereit wäre für diesen Schritt. Er rief mich Ende August an und teilte mir mit, dass ich keinen neuen Vertrag erhalten werde und so bald wie möglich mein Rad zurückgeben müsse.
Ich diskutierte noch lang und breit mit ihm, verwies auf die Zahl der tollen Resultate, die ich in der zweiten Jahreshälfte erzielt hatte, aber er gab nicht nach. Er brauchte reifere Fahrer und ich hatte mich zu sehr als ein noch unfertiges Projekt erwiesen, um schon für den Profibereich in Frage zu kommen. Viele Jahre später verstand ich, dass er recht hatte, aber in dem Moment hasste ich den Kerl.
Ich schickte das Rad, das ich seit einem Monat nicht geputzt hatte, in Einzelteile zerlegt zurück. Schon erstaunlich, wie man im Radsport innerhalb nur eines Jahres dazu kommt, jemanden, den man zuvor geliebt und wie einen Helden verehrt hat, abgrundtief zu hassen. Das gilt insbesondere für Teammanager. Es gibt Helden und Schurken und nichts dazwischen.
Was war aus all den schönen Reden über Loyalität geworden, die ich nach den Olympia-Ausscheidungen zu hören bekommen hatte? Es würde mir eine bleibende Lektion sein: Im Radsport zählte nicht, was gestern war.
***
Und so saß ich nun wieder daheim auf der Couch meiner Eltern.
Wie sauer ich auch sein mochte, dass Saturn mich fallengelassen hatte, Tatsache war, dass ich erneut ohne Mannschaft für das nächste Jahr dastand. In der Hoffnung, meinem Leben so etwas wie eine Richtung zu geben, schrieb ich mich für weitere Kunst- und Philosophie-Kurse ein, während ich gleichzeitig verzweifelt hoffte, dass sich ein Team bei mir melden würde.
Schließlich erhielt ich einen Anruf, in dem es um ein Rennen in Südamerika ging. Es war ein etwas merkwürdiges Gespräch mit jemandem vom US-Radsportverband, das auf mich eher wirkte, als ginge es darum, mich in eine Falle zu locken, als mich von der Teilnahme an einem Rennen zu überzeugen.
»Hast du im Oktober schon was vor…?«, fragte er ausweichend.
Sofern es mir gelänge, in Caracas irgendeinen Typen ausfindig zu machen, der dort unten für eine Art Erdölkartell arbeitete, könnte ich mich offenbar einer Mannschaft anschließen, die in Venezuela den US-Radsport vertrat. Wer könnte dazu schon nein sagen?
Die Vuelta a Venezuela war eine vierzehntägige Jagd durch den Dschungel und über die Andengipfel in Venezuela. Ich wurde seitens der US-National-mannschaft gebeten, am Rennen teilzunehmen, aber es war streng genommen keine Reise, die vom US-Verband durchgeführt wurde. Es war eigentlich eher so, als würde die Einladung in der Hoffnung ausgesprochen, einen Haufen geisteskranker Söldner zum Mitmachen zu überreden.
Dies reizte mich ungemein – ein komplett planloses Abenteuer in Südamerika war eine gute Ausrede, mein Studium ein weiteres Jahr aufzuschieben. Ähnlich wie eine wieder aufgewärmte Beziehung war es genau das, was ich brauchte, um mich von der bitteren Zurückweisung durch Gibbo zu erholen.
Als wir in Venezuela eintrafen, wurden ich und Colby, der beschlossen hatte, mich zu begleiten, von einem geschäftstüchtigen Taxifahrer begrüßt. Dem Burschen gelang es, uns davon zu überzeugen, dass unser Hotel sehr schwer zu finden war und wir ihm 100 US-Dollar pro Nase zahlen müssten, um unseren Bestimmungsort zu erreichen. Nach einigen Verhandlungen willigten wir ein und gaben dem Mann sein Geld dafür, dass er uns sechs Kilometer auf einer sehr geraden Straße zu unserem Hotel fuhr. Die Sache ließ sich prächtig an.
Kurz nach unserer Taxifahrt trafen wir auf unseren venezolanischen Ölbaron und den zusammengewürfelten Haufen amerikanischer Teamkollegen, die sich in der Lobby des Hotel Ejecutivo auf die anstehenden zwei Wochen Wettkampf vorbereiteten.
Ich hatte noch nie in einem Hotel mit Plastikbezügen auf den Matratzen und blauem Teppich an der Decke und den Wänden geschlafen. Noch habe ich es seitdem wieder getan. Dem Hotel Ejecutivo haftete der üble Ruch von Mord und Prostitution an, aber andererseits funktionierte die Klimaanlage tadellos, es lag mir daher fern, mich über ein bisschen getrocknete Körperflüssigkeit in meinem Zimmer zu beklagen.
Sobald das Team registriert war und wir unsere Startnummern erhalten hatten, warf ich einen Blick auf den Etappenplan. Ich studierte die Profile gewaltiger Anstiege in den Anden und Straßenkarten, die in entlegene Winkel des Dschungels führten. Es war eine spannende und etwas beängstigende Lektüre. Das sah viel abenteuerlicher aus, als im grauen und langweiligen Europa zu fahren. Ich war total angetan von diesem Rennding in Südamerika – es gab mir das Gefühl, ein richtig cooler Draufgänger zu sein, wie Indiana Jones auf einem Fahrrad.
Der Start der ersten Etappe lag rund hundert Kilometer vom Hotel entfernt und wir wurden von einem riesigen rostigen Schulbus aus den 1960ern eingesammelt, um uns dorthin zu bringen. Vier Teams – unsere US-Auswahl, dazu die Nationalmannschaften von Deutschland, Italien und Dänemark – nannten diesen Bus während der nächsten zwei Wochen ihr Zuhause.
Jeden Tag quetschten wir unsere Räder, Taschen und Leiber in den Bus, rumpelten zum Start und nach dem Rennen wieder zurück. Es war wie die UN-Generalvollversammlung für Schulbusse, mit einem Haufen sehr blasser Passagiere aus Europa und den USA, die alle ihr erstes Abenteuer an einem Ort erlebten, der sehr weit weg von zu Hause war.
Als wir unseren Bus am Start entluden, sah ich zum ersten Mal all die Fahrer aus Südamerika. Sie wirkten abgebrüht, hager und bedrohlich. Am fiesesten sahen die Fahrer aus Kolumbien aus, die zwar klein waren, aber unerhört grimmig dreinblicken konnten.
Unser Übersetzer vom Erdölkartell erklärte, dass der große Favorit auf den Sieg Omar Pumar sei, der für die Mannschaft aus Táchira an den Start ging, einer rückständigen, gesetzlosen Provinz in den Bergen Venezuelas, direkt an der Grenze zu Kolumbien. Ich war gleichermaßen eingeschüchtert wie fasziniert von diesen Kerlen, und das in einer Weise, wie ich es von den Fahrern aus Frankreich nie gewesen war.
Aber eingeschüchtert oder nicht, ich war hergekommen, um Rennen zu fahren, denn es könnte meine letzte Chance sein, mich einem potenziellen Team oder Sponsor zu zeigen. Wer weiß, wenn ich meine Sache gut machte, könnte ich vielleicht für eine südamerikanische Mannschaft starten? Nach Táchira ziehen, Rennen fahren, Spanisch lernen. Meiner Mutter hätte diese Vorstellung bestimmt gefallen…
Das Rennen war heiß und hart – jeden Tag. Wenn wir nicht in der Äquatorsonne schmorten, stiefelten wir 40 Kilometer lange Anstiege hinauf, die auf 4.000 Meter hinaufführten. Ungeachtet der extremen Schwierigkeit des Rennens litten die ausländischen Fahrer indes am meisten unter verdauungsbedingten Problemen. Mir war noch nie explosionsartiges Erbrechen in einem Radrennen untergekommen und die Vuelta a Venezuela erwies sich auch diesbezüglich als Feuertaufe.
Wiederholt fingen Jungs ohne Vorwarnung an, ihr wohlgemeintes Frühstück auf die Straße zu speien. Zum Glück hatte ich mich für eine solche Eventualität gewappnet und meinen Rucksack mit Energieriegeln, Proteinpulvern und isotonischen Getränken vollgestopft. Ich hatte genug Pseudo-Nahrung dabei, um einige der interessanteren einheimischen Gerichte nicht kosten zu müssen.
Diese künstliche Ernährung aus Pulvern hatte allerdings einen Nebeneffekt: wahrlich atemberaubende Flatulenz. Nach zwei oder drei Tagesrationen von dem Zeug begann mein Körper, einen üblen Dunst abzusondern, so ähnlich wie das Gas, mit dem der Grüne Kobold versucht, Spiderman ins Jenseits zu befördern.
Auch unser armer Busfahrer musste jeden Tag meinen Gestank ertragen, aber immerhin brachte er mehr Verständnis für meine Lage auf als die abschätzigen Deutschen. Bald begrüßte mich der Busfahrer jeden Tag mit einem fröhlichen »Hola, huevos y cebolla!« Er hatte mir sehr rücksichtsvoll den Spitznamen »Eier und Zwiebeln« verpasst, der, nachdem er sich im Bus herumgesprochen hatte, bald von allen übernommen wurde.
Ich war der kleine Gringo, »Huevos y Cebolla«, der auf dem Rad durch den Dschungel von Südamerika fuhr – und ihn möglicherweise entlaubte.
Trotz des Gestanks schlug sich unser Team im Rennen recht achtbar. Nach der vierten Etappe übernahmen wir in Person eines Teilzeit-Schulbusfahrers aus Minnesota namens Dewey Dickey die Gesamtführung. Wir verteidigten sie wie eine preisgekrönte Melone, hielten jeden Tag Ausreißer in Schach, arbeiteten an der Spitze des Feldes, so wie wir es die Teams bei der Tour de France hatten tun sehen.
Wir kamen uns wie ziemlich tolle Hechte vor, wie wir so Tag um Tag an vorderster Front in unseren Stars-and-Stripes-Trikots auf die Attacken unserer Gegner lauerten. Wir hatten uns sogar den Respekt der Einheimischen erworben und verschiedene Teams fingen an, sich gegen uns zu verbünden, um uns von der Spitze zu verdrängen. Allerdings standen die entscheidenden Etappen des Rennens noch bevor und sie wussten, dass wir allmählich die Zeche dafür zahlten, jeden Tag an der Spitze des Feldes zu schuften.
Ich denke, sie gingen davon aus, dass sie uns spätestens dann aus den Schuhen fahren würden, sobald wir die richtigen Anstiege in den Anden erreichten. Aber bevor es so weit war, stand noch ein Zeitfahren auf dem Programm, das den Boden bereiten würde für das dramatische Finale. Ich hatte mich in den ersten Tagen der Rundfahrt nicht besonders toll gefühlt und überraschte mich selbst (und vielleicht auch meine Teamkollegen), als ich das Zeitfahren gewann und mich auf den zweiten Platz in der Gesamtwertung vorschob.
Dewey war weiter hauchdünn in Führung, aber der Lokalmatador, der berüchtigte Omar Pumar, hatte sich auf den dritten Platz vorgearbeitet.
Die letzten Etappen, auf Pumars heimischem Terrain im Hochgebirge von Táchira, waren die schwersten des Rennens. Die Kolumbianer planten im Verbund mit Pumars Team, uns Fahrern von der Nordhalbkugel eine Lektion in Schmerz zu erteilen, was sie definitiv auch taten. Da der Rest des US-Teams nach den vielen Tagen Führungsarbeit nicht mehr viel zuzusetzen hatte, waren Dewey und ich schnell isoliert, als die Straße steiler wurde.
Dennoch gelang es uns, mit Pumar und den Kolumbianern mitzuhalten, indem wir nicht direkt auf ihre scharfen Antritte reagierten und stattdessen unser Tempo fuhren. Wir schafften es bis zur vorletzten Etappe, ehe Dewey schließlich doch am letzten Anstieg platzte.
Ich hatte zunächst nicht bemerkt, dass er auf den letzten Kilometern des Schlussanstiegs aus der Gruppe herausgefallen war. Er hatte nicht gerufen oder mich aufgefordert zu warten. Aber es gab keinen Funk und wir hatten auch keinen richtigen sportlichen Leiter im Begleitwagen, vielleicht hoffte er also, seine Schwäche zu kaschieren, indem er nichts sagte.
Ich wusste nicht, was ich tun sollte.
Bliebe ich einfach bei der Spitzengruppe, würde ich die Gesamtführung übernehmen. Würde ich warten, wäre ich vielleicht in der Lage, Dickey heldenhaft zurück an die Spitze zu bringen, aber andererseits könnte alles verloren sein, wenn keiner von uns es zurück zu den Führenden schaffte.
Nicht zum ersten (und auch nicht zum letzten) Mal in meiner Zeit als Rennfahrer stellte ich Egoismus über Heldentum und blieb, statt zu warten, in der Spitzengruppe. Ich beteiligte mich pflichtgemäß nicht an den Attacken der Táchira-Mannschaft und versuchte, sie zu entmutigen, indem ich sie wissen ließ, dass ein anderer Gringo die Führung übernähme, selbst wenn sie Dickey abhängen könnten. Aber ich wartete nicht auf ihn.
Ich hatte ein schlechtes Gewissen dabei, rechtfertigte mein Verhalten aber damit, dass ich schließlich für das Team die Rundfahrt gewinnen würde. Außerdem kannten Dewey und ich uns nicht einmal, bevor wir uns in Venezuela begegneten. Er war kein richtiger Teamkollege, nur ein vorübergehender, ich schuldete ihm also nichts.
Ich überquerte die Ziellinie in der Annahme, zur Siegerehrung aufs Podium gebeten zu werden, aber seltsamerweise geschah nichts dergleichen. Stattdessen schaute ich zu, wie Pumar das Trikot des Gesamtführenden überstreifte, während ich mich ängstlich bei den Rennoffiziellen erkundigte, was es damit auf sich hätte. Ich erfuhr zunächst von niemandem etwas, und wie es aussah, hatte man willkürlich beschlossen, den kleinen Abstand zwischen Pumar und mir einfach zu seinen Gunsten auszulegen.
Schließlich teilte man mir mit, dass ich dafür, mich beim Start am Morgen nicht rechtzeitig eingeschrieben zu haben, eine 20-Sekunden-Strafe erhalten hätte, was zufälligerweise genau reichte, Pumar die Gesamtführung zu bescheren. Ich konnte es nicht fassen. Ich hatte noch nie von einer solchen Strafe gehört und ganz bestimmt hatte mir beim Einschreiben niemand mitgeteilt, dass ich zu spät dran wäre.
Unser Schulbus war kein Muster an Zuverlässigkeit, sodass wir manchmal recht spät im Startbereich eintrafen. Die Strafe war ein Witz und stand nicht mal im Regelbuch – aber was sollte ich dagegen im entlegenen Dschungel von Venezuela schon tun? Es gab niemanden, bei dem ich hätte Protest einlegen können.
Nun war meine kleine Eigensinnigkeit am letzten Anstieg doch zum Desaster geraten, zu einer miesen Nummer gegen Dickey. Weil ich nicht auf ihn gewartet hatte und mir auch noch eine Zeitstrafe einhandelte, ging nun die ganze Mannschaft leer aus.
Colby und ich beschlossen, noch ein paar Tage in Venezuela zu bleiben, um am Strand abzuhängen und ein wenig zu angeln. Wir hatten genug Preisgeld kassiert, um es uns ein paar Tage gutgehen zu lassen, und ich musste den Kopf freibekommen.
Es wurden mehr als ein paar Tage daraus und am Ende verprassten wir unser Preisgeld bis auf den letzten Cent für diverse Ausschweifungen.
Wir fuhren zum Schwertfisch-Angeln raus und gingen Tauchen, wir schlürften Piña Coladas und verteilten üppige Trinkgelder an hübsche Kellnerinnen.
Während ich am Strand saß und versuchte, die Rückkehr in die Realität möglichst lange hinauszuzögern, tat ich mein Bestes, die dramatischen Ereignisse der letzten Tage hinter mir zu lassen. Aber das alles gab mir zu denken. Bei Saturn war ich der selbstloseste aller Fahrer gewesen und in Venezuela der egoistischste, das alles innerhalb eines Jahres.
Ich konnte mir keinen rechten Reim darauf machen, was genau von mir erwartet wurde in diesem seltsamen Sport, in dem Selbstlosigkeit mit Umarmungen und Schulterklopfen belohnt wurde, Egoismus aber mit Verträgen, Erfolg, Ehrungen und Geld.
Ich war hin- und hergerissen. Ich war ehrgeizig und wollte gewinnen, erfolgreich sein und in meiner Karriere vorankommen, aber ich wollte auch von anderen in einer Weise gemocht werden, wie ich es auf der Highschool nie erlebt hatte.
Dieses Paradox ist das seltsame soziale Experiment, das im Zentrum des professionellen Radsports steht. Je nach Situation belohnt er mal Selbstlosigkeit, mal Egoismus. Ich schätze, der Schlüssel dazu, im Radsport erfolgreich zu sein, ist ein Gespür dafür, wann man uneigennützig sein sollte und wann egoistisch.
Schließlich ging uns das Geld aus und ich war gezwungen, mein venezolanisches Strand-Lotterleben aufzugeben. Auf dem Rückweg nach Colorado gingen mir weiter die Gedanken über die gegensätzlichen Resultate durch den Kopf, zu denen meine unterschiedlichen Verhaltensweisen – selbstlos bei der Olympia-Ausscheidung, egoistisch bei der Vuelta a Venezuela – geführt hatten.
Ich kehrte heim mit einem zweiten Platz in der Gesamtwertung einer sehr schweren Rundfahrt auf dem Konto. Es hätte einer der Höhepunkte meiner bisherigen Karriere als Radrennfahrer sein müssen, aber stattdessen fühlte ich mich wie ein Riesenarsch. Ein Arsch ohne Team, ein Arsch ohne Job, und ein Arsch, der sich auf der Reise nach Südamerika keine neuen Freunde gemacht hatte.