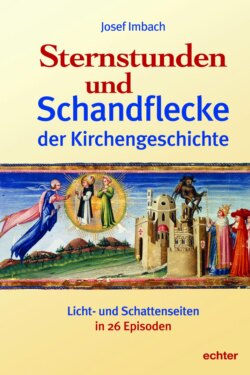Читать книгу Sternstunden und Schandflecke der Kirchengeschichte - Josef Imbach - Страница 10
ОглавлениеAbschied von der Weltoder Die Grünen sind im Kommen
Als berühmtester Vertreter des im Anschluss an die Ostkirche auch im Westen allmählich sich verbreitenden Ordenswesens gilt Martin von Tours (um 316/317–397). Geboren wurde er in Pannonien (im heutigen Ungarn) als S ohn eines römischen Offiziers. Als sein Vater nach Pavia versetzt wurde, ließ sich Martin dort unter die Taufbewerber einreihen. Im Alter von 15 Jahren trat er auf Wunsch seines Erzeugers bei einer Reiterabteilung in Gallien in den Heeresdienst; man hatte damals offenbar nichts einzuwenden gegen Kindersoldaten. Mit 18 Jahren empfing er von Hilarius, dem späteren Bischof von Poitiers, die Taufe. Noch als Soldat soll er am Stadttor einem frierenden Bettler die Hälfte seines Mantels geschenkt haben, worauf ihm, so die Legende, in der folgenden Nacht Christus erschien, bekleidet mit dem geschenkten Mantelstück. Der übrig gebliebene halbe Mantel, die capa, wie man damals sagte, wird seit jeher als kostbare Reliquie aufbewahrt, und zwar in einer eigens dafür gebauten Capella, zu deren Betreuung man einen Capellanus bestellte. Wenn Martin seinerzeit seinen Mantel nicht zerschnitten hätte, gäbe es heute weder Kapellen noch Kapläne.
Nach dem Austritt aus dem Heer lebte Martin zunächst auf der in der Nähe der ligurischen Küste gelegenen Insel Gallinara als Eremit. Anschließend zog er nach Poitiers und gründete an dem nicht weit entfernten Ort Ligugé eine Siedlung für Einsiedler, die sich bald zu einem berühmten Kloster entwickelte. Um 371 wurde Martin Bischof von Tours und errichtete auch in Marmoutier ein Kloster, das schnell zu einem in ganz Gallien bekannten geistlichen Mittelpunkt wurde. Als Bischof behielt Martin seine monastische Lebensweise bei, für deren Ausbreitung er sich gegen den Widerstand des Weltklerus weiterhin einsetzte.
Weniger bekannt aber nicht minder wirksam als Martins Initiativen sind die Impulse, die von anderen Förderern des Mönchslebens ausgingen. Erwähnt seien der nachmalige Bischof von Arles, Honoratus († 429 oder 430), der um 410 auf der Insel Lerinum (heute Lérins) bei Nizza ein Kloster gründete, dessen Mönche sich vor allem wissenschaftlich hervortaten; ferner Hieronymus (347–419), der 385, vermutlich aus Enttäuschung, dass er nach dem Tod Damasus’ I. nicht zum Bischof von Rom gewählt wurde, nach Betlehem auswanderte, wo er zusammen mit Freunden drei Frauenklöster und ein Kloster für Männer gründete, für die er auch als Berater tätig war. Unbestritten ist, dass Hieronymus die Spiritualität auch späterer Klöster nachhaltig prägte. Großen Einfluss auf die weitere Entwicklung übte auch Johannes Cassianus (360–435) aus, ein Skythe, der schon früh nach Palästina kam, sich in Betlehem und in Ägypten umsah und anschließend zehn Jahre in einer Mönchsniederlassung am Nildelta lebte, bevor er sich in der östlichen Kaiserstadt Konstantinopel in einem Kloster niederließ. Ihm verdanken wir ein Regelwerk mit dem Titel De institutis coenobiorum et de octo principalibus vitiis (Das Mönchstum und die acht Hauptlaster). Darin berichtet Cassianus vom ägyptischen Klosterleben. Eine der Hauptaufgaben eines Mönchs besteht ihm zufolge in der Bekämpfung der acht Hauptsünden (Unmäßigkeit, Unkeuschheit, Habsucht, Zorn, Traurigkeit, Überdruss, Ruhmsucht, Hochmut). Weiter lehrt Cassianus, dass die Vollkommenheit der Mönche nicht schon darin besteht, dass sie die Welt verlassen, sondern in der Übung der Tugenden. Allerdings ist es nicht nur die Meditation im Kloster, die zur Vervollkommnung führt. Dieses Ziel kann auch auf einem anderen Weg, nämlich durch das aktive Leben, das die ›Weltleute‹ führen, erreicht werden. Schon aus diesem Grund haben Mönche und Monialen keinerlei Veranlassung zur Überheblichkeit.
Von seinen Erfahrungen mit ägyptischen Mönchen berichtet Cassianus auch in den Collationes patrum, den Unterredungen mit den [Wüsten-] Vätern, eine Schrift, in der er seine Erfahrungen mit den Mönchen Ägyptens in Form von Gesprächen wiedergibt. Mit diesem Werk gelang es Cassianus, die östliche Mönchsspiritualität auch im Westen des Reiches zu verbreiten.
Große Bedeutung für die Entwicklung des Ordenswesens in den westlichen Kirchenprovinzen kam in der Folge auch der Regel des Aurelius Augustinus von Hippo (354–430) zu.
Nach dem Besuch der Grammatikschule in Madauros (dem heutigen algerischen M’Daourouch) und einem Studium der Redekunst schlug sich der gut 20-jährige Akademiker zunächst in seiner Heimatstadt Thagaste und später in Karthago als Rhetorikprofessor durch. Um 383 übersiedelte er nach Rom, worauf ihm ein Jahr danach Freunde zum Posten eines Rhetoriklehrers in Mailand verhalfen. Beeindruckt von den Predigten des dortigen Bischofs Ambrosius trennte er sich von seiner Konkubine und seinem Sohn Adeodatus und ließ sich in der Osternacht des Jahres 387 taufen. Anschließend gab er seinen Beruf auf und kehrte in seine Heimatprovinz Africa zurück. Auf einem väterlichen Landgut bei Thagaste lebte er zusammen mit gleichgesinnten Freunden in klösterlicher Zurückgezogenheit. Als er 391 während einer Reise in Hippo Regius weilte, wurde er von den Gläubigen ins Priesteramt berufen, und zum Priester geweiht. Fünf Jahre später, nach dem Tod des dortigen Bischofs, wählten sie ihn zu dessen Nachfolger. In Hippo Regius lebte Augustinus zusammen mit einer Gruppe von Presbytern in einer klosterähnlichen Gemeinschaft, bis zu seinem Tod im Jahr 430. Dort verfasste er ein paar kurze, gerade elf Punkte beinhaltende Anweisungen bezüglich des klösterlichen Zusammenlebens. Alles Wesentliche ist bereits im ersten Satz enthalten: »Vor allen Dingen soll Gott geliebt werden, sodann der Nächste; denn das sind die Hauptgebote, die uns gegeben worden sind.« Es folgen ein paar grundsätzliche, äußerst knappe Direktiven bezüglich der Gebets-, Arbeits- und Essenszeiten, wobei täglich lediglich eine Mahlzeit vorgesehen ist. Während des Essens sollen die Anwesenden der Tischlesung lauschen. Auf persönliches Eigentum müssen die Mönche verzichten; sie sollen leben wie die ersten Christen, welche der Apostelgeschichte zufolge kein Eigentum besaßen, sondern »alles gemeinsam« hatten (vgl. 4,32). Ihrem »Vater« und dem »Vorgesetzten« (d. h. dem Abt und seinem Stellvertreter) schulden die Mönche absoluten Gehorsam. Wenn die Geschäfte es erfordern, dürfen sie sich nur zu zweien aus dem Kloster entfernen. Unnötiges Geschwätz ist zu vermeiden. Wer diesen Bestimmungen hartnäckig zuwiderhandelt, verfällt »verdientermaßen der Strafdisziplin des Klosters. Wenn es sich mit seinem Alter verträgt, wird er sogar Schläge bekommen« (Nr. 10).
Vermutlich nur wenig später verfasste Augustinus eine etwas ausführlichere Regel, in welcher er konkrete, im Zusammenleben entstandene Situationen und Schwierigkeiten berücksichtigt, die entsprechend detailliert behandelt werden.
Entsprechend dem Beispiel des heiligen Augustinus entschlossen sich später viele Kleriker zu einem gemeinschaftlichen Leben ohne Privatbesitz. Die so entstandenen religiösen Verbände wurden auf zwei 1059 und 1063 in Rom stattfindenden Synoden ermahnt, eine einheitliche Regel einzuführen. Die meisten von ihnen entschieden sich für die Regel des heiligen Augustinus, die 1215 offiziell durch das Laterankonzil bestätigt wurde.
Der Übergang von der Spätantike zum Mittelalter ist fließend. Daher wäre es müßig, den Beginn der neuen Epoche an einem bestimmten Ereignis festzumachen – beispielsweise an der Absetzung des Romulus Augustulus, des letzten weströmischen Kaisers, durch Odoaker, einen Offizier germanischer Herkunft, der im Jahr 476 den Königstitel für Italien beanspruchte. Unbestritten ist, dass der mit dem allmählichen Verfall des Westreiches sich anbahnende Paradigmenwechsel in die Zeit vom 5. zum 6. Jahrhundert fällt. Dies wiederum bedeutet, dass eine Persönlichkeit wie Benedikt von Nursia der Antike zwar noch verhaftet, aber nicht mehr an sie gebunden ist. Und dass diese Persönlichkeit nicht nur die Klöster, sondern auch die Kirche in der Zeit von 550–1500 (also während des ganzen ›Mittelalters ‹) stark geprägt hat.
Die Benedikt zugeschriebene, bis heute gültige Ordensregel dürfte etwa um 540 entstanden sein. Wann Benedikt das Zeitliche segnete, steht nicht genau fest. Manche optieren für das Jahr 547, andere wiederum halten die Zeit um 560 für wahrscheinlich. Sicher ist, dass er die Zerstörung der Klosteranlage durch die Langobarden im Jahr 577 nicht mehr erlebte.
Seit 589 lebte auch in Rom auf dem Monte Celio eine von dem späteren Papst Gregor dem Großen gegründete Mönchsgemeinschaft nach der Regel des heiligen Benedikt. Ein Jahr später wurde Gregor zum Papst gewählt; es war dies das erste Mal, dass ein Mönch den Stuhl Petri bestieg.
Benedikt selber wurde von den Geschichtsforschenden mit mehreren hohen Titeln geehrt. 1964 hat Papst Paul VI. ihn zum Patron Europas ernannt. Manche sahen in ihm den »letzten Römer«, bezeichneten ihn als »Vater des Abendlandes« oder als »Vater Europas«. Man kann sich darüber streiten, ob diese Ehrenbezeichnungen historisch gesehen berechtigt sind. Einig aber sind sich so ziemlich alle, dass Benedikt als »Vater des abendländischen Mönchtums« zu gelten hat. Und dies vor allem dank seiner Klosterregel, welche weltweit noch heute beobachtet wird.
Mit dieser Regel hat Benedikt nichts grundlegend Neues geschaffen. Vielmehr hat er aus früheren Quellen geschöpft und diese für die Gemeinschaft von Montecassino adaptiert. Dabei beruft er sich ausdrücklich auf fremde und eigene Erfahrungen.
Ziel allen klösterlichen Tuns ist nach Benedikt die Verherrlichung Gottes (ut in omnibus glorificetur Deus). Hauptaufgabe ist die Pflege der Liturgie, verbunden mit Gebet und Meditation. Nicht minder gewichtet wird die körperliche Arbeit. Aus diesen Forderungen wurde später der benediktinische Wahlspruch »ora et labora – bete und arbeite« abgeleitet, der sich in der Regel selber nicht findet. Die klösterliche Gemeinschaft betrachtet Benedikt als Familie. Das Gemeinschaftsideal kommt dadurch zum Ausdruck, dass den Klosterleuten jeglicher Besitz untersagt ist. Untereinander sind sie wie Brüder oder Schwestern – sie leben ehelos. Die Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen. Soziale Unterschiede sind zu ignorieren. Damit ist der Unterschied zwischen Sklaven und Freien, aber auch zwischen ›zivilisierten‹ Römern und ›barbarischen‹ Germanen aufgehoben. An der Spitze dieser ›Familie‹ steht der Abt bzw. die Äbtissin, denen eine fast absolute Macht zugestanden wird. Gleichzeitig fällt auf, dass an keine Adresse mehr Warnungen ergehen als an die des Abtes bzw. der Äbtissin. Benedikt rechnet also sehr realistisch damit, dass die Oberen vieles falsch machen können. Allerdings ist damit das strukturelle Problem nicht gelöst – was geschieht, wenn der Abt oder die Äbtissin diese Mahnungen nicht ernst nehmen? In jedem Fall schulden die Mönche und Nonnen den Oberen uneingeschränkten Gehorsam. Wichtig ist die stabilitasloci, die Ortsgebundenheit. Diese Forderung schließt die Bereitschaft ein, für immer in dem Kloster zu bleiben, in welches man eingetreten ist. Damit soll dem in der Regel gleich zu Beginn beklagten Umherschweifen der Mönche Einhalt geboten werden. Bedenken äußert Benedikt gegenüber einer übertriebenen Askese, die leicht zum Stolz und zur Verachtung anderer verleitet. Für ihn ist jedes Kloster ein Haus der Hoffnung, an dem die Mönche und Nonnen lebenslang weiterbauen.
Wenn hier entsprechend der inzwischen üblichen Terminologie gelegentlich vom Benediktinerorden die Rede ist, trifft dieser Begriff nur bedingt zu. Eigentlich müssten wir vom Benediktinertum sprechen. Denn genauso wenig wie Augustinus dachte Benedikt daran, einen Orden zu gründen. Seine Regel hat er lediglich für ›seine‹ Mönche im Kloster Montecassino konzipiert. Schon bald jedoch orientierten sich immer mehr Mönchs- und Monialengemeinschaften an der Benediktsregel – dies vor allem im fränkischen Merowingerreich, in England und in Gallien, wo sie in Verbindung mit anderen Mönchsregeln rezipiert wurde. Auf diese Weise entstanden zahlreiche sogenannte Mischregeln. Als dann im Fränkischen Reich im 8. Jahrhundert immer mehr Mönchs- und Nonnenklöster gegründet wurden, drangen vor allem die karolingischen Herrscher auf eine Vereinheitlichung des klösterlichen Lebens – und auf dessen Reform. Im Lauf der Jahre und Jahrzehnte nämlich war die Fackel der Begeisterung für die klösterliche Lebensweise gelegentlich zu einem Armenseelenlicht verkommen. Laxheit breitete sich aus und statt auf geistliche Zucht waren manche Mönche und Nonnen eher auf weltliche Lüste bedacht. Immer wieder lesen wir in zeitgenössischen Klosterchroniken, dass auch Klosterleute gegen homo- und heterosexuelle Beziehungen nicht immun waren; dass Nonnen Kinder zur Welt brachten, deren Väter längst nicht in jedem Fall ein Mönchsdasein fristeten, oder dass die Gaumenfreuden oft höher gewichtet wurden als die geltenden Fastenregeln.
Beim Bekämpfen solcher Missstände wurden die weltlichen Herrscher tatkräftig unterstützt von dem Abt Benedikt von Aniane (in Südfrankreich; um 750–821), der seine Jugend am Hof Karls des Großen verbracht hatte. Sein Reformprogramm war knapp und klar: Una regula – una consuetudo (eine Regel – ein Brauchtum). Dieses Postulat vermochte er mithilfe Kaiser Ludwigs des Frommen, des Sohnes und Nachfolgers Karls des Großen durchzusetzen, so dass vorerst nur noch eine einzige Klosterregel, nämlich jene des heiligen Benedikt von Nursia Geltung hatte. Diese allerdings wurde entsprechend den inzwischen veränderten Zeitläuften an die neuen Verhältnisse adaptiert und unter dem Titel Capitulare monasticum (Monastisches Kapitelbuch) ediert – was mit sich brachte, dass nicht Benedikt von Nursia, sondern mit größerem Recht Benedikt von Aniane als eigentlicher Begründer des Benediktinertums gelten kann. Dies umso mehr, als das benediktinische Mönchstum mit dieser Reform gleichzeitig drei Entscheidungen von höchster Tragweite traf, von denen in der ursprünglichen Benediktregel kaum Spuren zu finden sind, die aber bis heute nachwirken.
Die erste betrifft die Schaffung von Großklöstern, welche nunmehr als ideal galten. Die zweite Grundentscheidung bestand darin, dass diese Niederlassungen gleichzeitig Kulturklöster sein sollten. Das setzt natürlich materielle und personelle Ressourcen voraus, wie nur Großklöster sie bieten können. Ein dritter Schwerpunkt der anianischen Reform betrifft die Liturgie der Mönchsgemeinschaft, welche in der Abteikirche öffentlich zugänglich sein muss.
Da die einzelnen Konvente nach wie vor voneinander unabhängig waren, kann von einem eigentlichen (Benediktiner-) Orden nur bedingt die Rede sein. Und das ist bis heute so geblieben. Tatsächlich (und rechtlich gesehen) handelt es sich beim ›Benediktinerorden‹ um eine Benediktinische Konföderation, welche aus weltweit rund 20 weitgehend selbstständigen Vereinigungen von benediktinischen Klöstern besteht. Diese Konföderation wurde erst durch Papst Leo XIII. im Jahr 1893 ins Leben gerufen. Geistiger Mittelpunkt ist das Kolleg Sant’Anselmo in Rom, wo der Abtprimas seinen Sitz hat. Dessen Verfügungsgewalt aber ist, im Gegensatz etwa zu jener von Vorstehern anderer Orden, ziemlich eingeschränkt.
Ohne die zahlreichen Klostergründungen in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends – und dies ist nur eines der Verdienste der mittelalterlichen Mönche – wäre die antike Kultur und damit das angesammelte Wissen von Jahrhunderten zum größten Teil verloren gegangen. Dass dies nicht zutraf, verdanken wir unter anderem einem Gelehrten, der ein Werk verfasste, ohne das unsere Wikipedia kaum denkbar wäre.