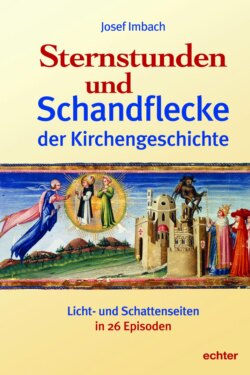Читать книгу Sternstunden und Schandflecke der Kirchengeschichte - Josef Imbach - Страница 7
ОглавлениеMachtkämpfeoder Seht, wie sie miteinander streiten!
Jesus zufolge misst sich die Autorität im Reich Gottes nicht an irgendwelchen gesellschaftlichen Positionen, sondern am beharrlichen Einsatz für die Mitmenschen, vorab für die Bedürftigen.
Eine diesbezügliche Erläuterung findet sich im Markusevangelium an jener Stelle, die davon berichtet, wie Jesu engste Vertraute sich um einen Spitzenposten balgen:
Jesus und seine Jünger kamen nach Kafarnaum. Und als er im Haus war, fragte er sie: Was habt ihr auf dem Weg besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander besprochen, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen: Wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener (Markus 9,33–35).
Es scheint, dass die Jünger der Ansicht waren, dass diese Wegleitung nicht für sie, sondern lediglich für alle anderen gelte. Haben sie Jesu Mahnung geflissentlich überhört? Waren sie auf beiden Ohren taub? Aufschlussreich ist, dass der Evangelist schon im folgenden Kapitel berichtet, wie sich die Jünger erneut zu übervorteilen suchen:
Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, traten zu Jesus und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm: Lass in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und den andern links neben dir sitzen! Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben; dort werden die sitzen, für die es bestimmt ist. Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele (Markus 10,35–45).
Bevor wir näher auf diesen Sendungsauftrag eingehen, ist auf ein pikantes Detail zu verweisen. Bekanntlich hat der Verfasser des Matthäusevangeliums den Markustext als Vorlage benutzt und dabei nicht gezögert, die beiden Zebedäussöhne in ein etwas günstigeres Licht zu stellen; ihm zufolge nämlich ist es die Mutter des Jakobus und des Johannes, welche Jesus bestürmt, ihren Söhnen im Reich Gottes eine Vorrangstellung einzuräumen (vgl. Matthäus 20,20–21)! Damit zanken sich also ›nur‹ noch zehn Jünger um die besten Plätze!
Jesu »Kelch trinken« und seine »Taufe empfangen« – das bezieht sich nicht etwa auf das Tauf- und das Altarssakrament, sondern meint das ›Sterben mit (oder wie) Christus‹, womit der Evangelist aber nicht das blutige Martyrium, sondern die tägliche und tätige Nachfolge im Glauben meint. Die aber besteht nicht einfach im Machtverzicht, sondern darin, dass die Menschen ihre ›Macht‹ – und das bedeutet ihr Können und ihre Kräfte – zum Wohl der Allgemeinheit einsetzen: Macht als Ermächtigung zum Dienst!
Das Markusevangelium lässt durchblicken, dass diese Dienstanweisung sogar Jesu Jüngern zu schaffen machte. Und dass selbst in diesem Kreis eine offensichtliche Diskrepanz besteht zwischen Postulat und Realität.
Ungefähr anderthalb Jahrzehnte nach Jesu Tod, vermutlich ums Jahr 48 oder 49, beginnt es unter den Jerusalemer Jesusleuten so richtig zu brodeln. Dabei geht es um die Frage, ob die nichtjüdischen, zum Christentum übergelaufenen Gläubigen vor dem Empfang der Taufe zuerst beschnitten werden müssen und damit auf die mosaische Weisung zu verpflichten sind.
Angesichts der herrschenden Meinungsunterschiede sehen sich die Jerusalemer Gemeindemitglieder gezwungen, die Angelegenheit in einem größeren Kreis zu diskutieren. Prompt kommt es bei dieser Veranstaltung zum Eklat. Als einige Judenchristen dafür plädieren, strikt an der Beschneidung aller Neubekehrten festzuhalten, entsteht, so der Verfasser der Apostelgeschichte, »ein heftiger Streit« (Apostelgeschichte 15,7). Wohlgemerkt, wir befinden uns hier nicht in einem Kreis von Regenschirm tragenden englischen Gentlemen, sondern in einer Versammlung von gutturallautigen und wild gestikulierenden Orientalen. Petrus vermittelt. Das letzte Wort hat Jakobus, der Vorsteher der Jerusalemer Gemeinde; er entscheidet, offenbar ohne auf Widerspruch zu stoßen, dass auch Unbeschnittene ein anständiges Christenleben führen können.
Allerdings war der Konflikt damit nicht endgültig beigelegt, sondern schwelte weiter. Das geht aus der Auseinandersetzung zwischen Petrus und Paulus, den beiden Säulen der Urkirche, hervor, von der Letzterer in seinem Schreiben an die Gemeinde im kleinasiatischen Galatien berichtet. Paulus war ein Hitzkopf, Petrus ein Eiferer. Das konnte nicht gut gehen; prompt gerieten sie aneinander. Dabei ging es scheinbar bloß um Tischmanieren. Bekanntlich hatte Petrus keinerlei Hemmungen, in Antiocheia zusammen mit den dortigen Heidenchristen zu tafeln, was naturgemäß eine Übertretung der jüdischen Speisegesetze beinhaltete. Später jedoch, als einige aus dem Judentum zugewanderte Christen auftauchten, welche die besagten Speisevorschriften weiterhin beobachteten, ging Petrus auf Distanz zu seinen bisherigen Tischgenossen, damit die Neuangekommenen von seinen veränderten Essgewohnheiten nichts mitbekämen. Ein solches Verhalten kann ein Paulus partout nicht billigen, weshalb er Petrus glattweg der »Heuchelei« bezichtigt. Auch andere Judenchristen, wettert Paulus, hätten sich vom Beispiel des Petrus anstecken und fortreißen lassen (Galater 2,13–14).
Schon fast anekdotisch mutet es an, dass die Kontroverse zwischen Petrus und Paulus gut drei Jahrhunderte später einem Augustinus und einem Hieronymus nicht nur einiges Kopfzerbrechen, sondern vermutlich auch ein paar schlaflose Nächte bereitete. Ist es überhaupt denkbar, dass die zwei Ur- und Erzheiligen Petrus und Paulus so unfreundlich miteinander umgegangen sein sollen? Dass Heilige sich gelegentlich die Haare raufen, mag ja noch angehen. Aber dass sie einander in die Haare geraten? Tatsache ist, dass der Verfasser der Apostelgeschichte und Paulus im Galaterbrief diesen Tatbestand mit schwarzer Tinte auf blassgelbem Pergament festgehalten haben. Indessen steht für Hieronymus und für Augustinus außer Zweifel, dass Petrus und Paulus, diese beiden Tragpfeiler der Kirche, sich nicht wie zwei verkrachte Erben überworfen haben konnten.
Diese Möglichkeit war für die beiden Kirchenväter absolut undenkbar. Das geht aus ihrem in dieser Sache geführten Briefwechsel hervor. Schließlich kamen sie überein, dass es sich nicht um eine wirkliche, sondern lediglich um eine fingierte Auseinandersetzung gehandelt habe, gewissermaßen um eine didaktische Übung oder um eine dialektische Lektion, um den die Frage der Beschneidung diskutierenden Christenleuten den Willen Gottes vor- und sie selber zur Einsicht zu führen. Nach Ansicht der beiden Kirchenmänner haben Petrus und Paulus mit dieser angeblich künstlich inszenierten Auseinandersetzung so etwas wie ein pädagogisches Gesellen- oder Meisterstück geliefert.
Selbst wer nicht zur Gilde der Schriftgelehrten gehört, hört aus diesen Mutmaßungen schnell heraus, was die beiden erlauchten Vordenker der abendländischen Christenheit bewegt, nämlich dass nicht sein kann, was ihrer Meinung nach nicht sein darf, will sagen, dass die zwei heiligen Apostelfürsten innerhalb der heiligen Kirche in einen unheiligen Streit verwickelt waren und diesen auch noch öffentlich austrugen.
Leider verhält es sich so, dass wir mit den Begriffen Konflikt oder Streit fast ausschließlich Negatives assoziieren: Hader und Hass, Zänkereien und Zerwürfnisse, Zwietracht und Niedertracht, Arglist und böses Blut und boshafte Gesinnung… Das hat zur Folge, dass man meint, in der Kirche Gottes dürften wohl Kerzen brennen, aber keine Funken sprühen.
In Wirklichkeit kommt es doch gerade darauf an, dass man Konflikte weder unterdrückt noch bagatellisiert, sondern dass man sie austrägt, und zwar frank und frei, wie das damals in Jerusalem und Antiocheia geschah.
Bemerkenswert ist, dass die Auseinandersetzung um die Notwendigkeit der Beschneidung bloß auf verbaler Ebene ausgetragen wurde. Das sollte sich aber schon bald ändern, als zu Beginn des 5. Jahrhunderts ein Theologe namens Nestorios im kleinasiatischen Antiocheia ein derartiges Aufsehen erregte, dass sogar der Kaiser, Theodosios II., auf ihn aufmerksam wurde. Dieser ernennt den berühmten Mann im Jahr 428 zum Patriarchen von Konstantinopel. Dort ist gerade ein heftiger Streit im Gang, den ein paar eifrige Marienprediger entfacht haben, weil sie Maria als Gottesgebärerin preisen. Nun gibt es aber unter den Gläubigen welche, denen durchaus nicht einleuchten will, dass Gott eine Mutter haben sollte; sie betrachten Maria lediglich als Menschengebärerin. Nestorios versucht zu vermitteln und schlägt die Bezeichnung Christusgebärerin vor. Weil aber keine der Parteien nachgeben will, hat Nestorios jetzt alle gegen sich. Längst nimmt auch das einfache Volk lebhaften Anteil an diesen Auseinandersetzungen. Auf dem Markt kommt es zu Tumulten, in den Gassen zu Schlägereien, die Gottesdienste werden gestört, organisierte Sprechchöre unterbrechen die Prediger.
Weil der Streit sich immer mehr ausweitet und schließlich die ganze damalige Christenheit in zwei Lager zu spalten droht, beruft der Kaiser auf das Pfingstfest des Jahres 431 eine allgemeine Kirchenversammlung in die kleinasiatische Stadt Ephesos, welche die Einheit wiederherstellen soll. Dort entscheiden die Konzilsväter, dass der Ehrentitel Gottesgebärerin Maria angemessen ist – und setzen Nestorios als Patriarchen von Konstantinopel ab.
Wie aus der Entscheidung des Konzils eindeutig hervorgeht, ging es in dieser ganzen Auseinandersetzung nicht um Maria, sondern um die Person Christi: »Wer nicht bekennt, dass Emmanuel wahrhaftig Gott und deshalb die heilige Jungfrau Gottesgebärerin (theotókos) ist (denn sie hat das Wort, das aus Gott ist und Fleisch wurde, dem Fleisch nach geboren), der sei von der Kirche ausgeschlossen.« Obwohl dieses Dogma sich nicht auf die Rolle Marias innerhalb der Heilsgeschichte, sondern auf Christus – genauer: auf die Gottheit Jesu – bezieht, rückt in der Folge die Gottesgebärerin immer mehr in den Mittelpunkt. Was zur Folge hat, dass sie nach dem Konzil von Ephesos der dort verehrten Muttergöttin Artemis den Platz streitig macht und diese schließlich ganz verdrängt – aber das ist wieder eine andere Geschichte.
Spannungen in Sachen Glaubenslehre und Kirchendisziplin, die immer häufiger zu Spaltungen führen, bleiben auch in der Folge nicht aus.
Als im 4. Jahrhundert der Grundbesitz der römischen Kirche durch Schenkungen zahlreicher Güter in Süd- und Mittelitalien und auf Sizilien anwächst, sind die Grundlagen für den späteren Kirchenstaat mit dem Papst als oberstem Herrscher gelegt. Damit erscheint das Papsttum vor allem den römischen Baronen besonders attraktiv, die sich fortan um den Stuhl Petri streiten. Im 11. Jahrhundert trennt sich die Ostkirche von Rom. Letztere wiederum spaltet sich zur Zeit Luthers (dessen zu einem guten Teil begründete Anliegen Papst Leo X. als frattate, als Klosterkram, abqualifiziert) in verschiedene Konfessionen auf. Als sich die Römische Kirche zur Zeit der Aufklärung gegen manche fundierte Forderungen sperrt (ein Stichwort unter anderen: Religions- und Gewissensfreiheit), kommt es zu verheerenden Auseinandersetzungen. Papst Pius X. wiederum bringt mit seinem Antimodernistenfeldzug vorab katholische Intellektuelle in massive Gewissenskonflikte, eine Tragödie, die sich unter Pius XII. mit dessen Kampagne gegen die Vertreter der Nouvelle théologie wiederholt, was erneut eine gewaltige Erschütterung auslöst.
Wer in der Kirchengeschichte einigermaßen bewandert ist, erinnert sich, dass im Anschluss an jedes ökumenische Konzil eine Minderheit die getroffenen Entscheidungen nicht akzeptierte, was jeweils zu weiteren Abspaltungen führte.
Das alles zeigt: Die ganze Kirchengeschichte ist nicht nur eine Glaubens-, sondern auch eine permanente Krisengeschichte.
Glaubensgeschichten verlaufen längst nicht immer gradlinig, weder im persönlichen noch im kirchlichen Leben. Was weiter nicht verwundert, weil angesichts veränderter Situationen und der daraus resultierenden neuen Fragestellungen mancherlei Unsicherheiten und damit verbundene Querelen nie auszuschließen sind.
Solange die neue, sich auf Jesus berufende Glaubensgemeinschaft eine Minderheit darstellte, war sie wiederholt Verfolgungen ausgesetzt. Kaum aber hatten sich die ehemals Verfolgten gesellschaftlich integriert und politisch etabliert, wurden sie ihrerseits zu Verfolgern. Bereits gegen Ende des vierten Jahrhunderts beschränkten sich die Nachfolger der Apostel nicht mehr auf die Verbreitung der Frohen Botschaft, sondern beteiligten sich eifrig am Poker um die Macht, wobei ihnen oft jedes Mittel recht war, um ihre Ziele zu erreichen. Gelegentlich erlagen Kirchenleute der Versuchung, ihre Vorstellungen (die sie in der Regel mit dem Willen Gottes identifizierten) mit klirrenden Waffen statt mit klaren Worten durchzusetzen. Dabei scheuten sie sich nicht, selbst die schlimmsten Gewalttaten als gottgewollt hinzustellen.
Dem Johannesevangelium zufolge fordert Jesus die Seinen auf, einander zu lieben: »Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt« (13,35). Sobald es aber vorzugsweise oder gar ausschließlich um die Macht ging, war dieses Kriterium Makulatur.
Das Christentum kann auf eine zweitausendjährige Krisen- und Glaubensgeschichte zurückblicken. Die eine bedingt die andere. Bedauerlich ist, dass Krisen oft eher vom Machtstreben als vom Willen zur Rechtgläubigkeit ausgelöst wurden. Und dass man der Rechtgläubigkeit nicht selten mit Mitteln und Methoden zum Durchbruch verhelfen wollte, welche dem von Jesus verkündeten Glauben entgegenstanden.
Überdies müsste die Kirche (und nicht nur sie!) eine Streitkultur pflegen, die diesen Namen verdient – der Akzent liegt auf Kultur.
Dass es die nicht (oder nicht hinreichend) gibt, hängt auch damit zusammen, dass wir mit dem Begriff Konflikt immer gleich Hader und Hass, Zwietracht und Niedertracht, fehlgeleitete Ansichten und böswillige Absichten assoziieren; offenbar hat die Christenheit seit Hieronymus und die Menschheit seit Augustinus in dieser Hinsicht wenig dazugelernt.
Auseinandersetzungen sind unerlässlich, wenn es darum geht, die evangelische Botschaft unter sich wandelnden sozialen Bedingungen und wechselnden kulturellen Umständen zu verkünden und zu aktualisieren. Wenn man jedoch jede ungewohnte Ansicht gleich als Attentat auf das Glaubensgut interpretiert, entartet der notwendige Streit zur gehässigen Streiterei. Wahrheitsfindung kommt zustande nur auf dem Weg der Toleranz, des Dialogs, der Versöhnlichkeit und – dies vor allem – bei gegenseitigem Respekt. Wo lediglich die Bestätigung seitens Gleichgesinnter gefragt ist, geht es entgegen allem äußeren Anschein weder um den Glauben, noch um die Kirche und schon gar nicht ums Christentum – also nicht mehr um die Sache, sondern um die eigene Person und Position.
Diskussionen um theologische oder kirchendisziplinarische Fragen laufen so letztlich auf Machtfragen hinaus. Das führt dazu, dass einzelne Gläubige nur deshalb bestimmte Lehrmeinungen verteidigen, weil sie es unter ihrer Würde finden, sich von anderen informieren zu lassen; dass Christusjüngerinnen und Jesusnachfolger anderen lieber den Kopf als die Füße waschen; dass kirchliche Amtsträger es vorziehen, ein Exempel zu statuieren, statt ein Beispiel zu geben.
An sich ist Streit durchaus nichts Verwerfliches. Auseinandersetzungen, auch und gerade um religiöse Fragen, sind ein Zeichen von Anteilnahme am kirchlichen Leben. Besser eine streitende als eine schlafende Kirche! Damit aber eine Debatte nicht in kleinliches Gezänk ausartet, brauchen wir eine Streitkultur. Und die setzt die Bereitschaft voraus, die eigenen Ansichten, und seien sie noch so altvertraut und herzenslieb, zu hinterfragen und notfalls zu revidieren.
Streit, wenn er denn sachlich ausgetragen wird, ist nicht nur nicht schädlich; er ist darüber hinaus auch zuträglich. Für Menschen mit einem halbwegs gesunden Herz-Kreislauf-System ist es schon aus rein medizinischen Überlegungen ratsam, gelegentlich zu streiten; das fördert die Blutzirkulation. Darüber hinaus sprechen auch soziale Gründe für das Streiten. Denn nur durch gemeinsame Überlegungen, die Auseinandersetzungen zwingend mit einschließen, überwinden wir die heute weitverbreitete zwischenmenschliche Gleichgültigkeit und kommen einander näher. Ja: näher! Naturgemäß geht es auch innerhalb der Kirche nicht ohne Meinungsverschiedenheiten und die damit verbundenen Konflikte ab, wie gerade das Apostelkonzil zeigt. Einvernehmen erreicht man nicht, indem man blind dem Papst gehorcht oder blindwütig gegen ihn ankämpft, auch nicht, indem man einen Bischof danach beurteilt, ob er einer Ansicht zustimmt, die man selber vertritt. Natürlich verhält es sich nicht so, dass bloß der Kopf des Papstes oder der des Bischofs oder jener des Lieblingstheologen einen geeigneten Landeplatz darstellt für die Taube des Heiligen Geistes. Ein Windhauch seines Flügelwehens kann grundsätzlich jede Stirn streifen. Dennoch sollten wir nicht in jedem Luftzug einen Unfehlbarkeitsbeweis für etwaige persönliche Erleuchtungen sehen, sondern stets bereit sein, die eigenen Überzeugungen mit den Argumenten anderer zu konfrontieren und mit ihnen zu debattieren, mit Ernst und Eifer, mit Überzeugungskraft und Vehemenz. Dabei dürften wir, wir haben ja nur einen Mund, aber zwei Ohren, über dem Sprechen das Zuhören nicht vergessen.
Wenn immer dies zutrifft, werden die Menschen aufhorchen und staunen und sich erinnern, was der afrikanische Kirchenschriftsteller Tertullian (um 150 – nach 220) seinerzeit feststellte: »Seht, wie sie einander lieben!« Was in diesem Zusammenhang besagt: »Seht, wie vorbildlich sie miteinander streiten!«