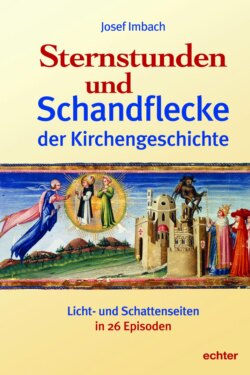Читать книгу Sternstunden und Schandflecke der Kirchengeschichte - Josef Imbach - Страница 6
ОглавлениеZur Einführung: Göttliches Feuerund menschlicher Rauch
»Jésus annonçait le royaume, et c’est l’Église qui est venue – Jesus verkündete das Reich Gottes, und dann kam die Kirche.« Diese oft zitierte Äußerung des französischen Theologen und Historikers Alfred Loisy bringt das Problem auf den Punkt. Tatsächlich hat Jesus nicht daran gedacht, eine Kirche zu gründen. Er hat Menschen in seine Nachfolge gerufen. Und die sich ihm beigesellten, bildeten eine Gemeinschaft, die sich bald einmal institutionalisierte. Die Frage ist daher nicht, ob Jesus eine Kirche wollte, sondern ob die Menschen, die sich auf ihn berufen, tatsächlich seine Absichten verwirklichen und entsprechend handeln. Dass es innerhalb der Jesusbewegung schon früh zu Kontroversen kam, was im konkreten Fall dem Willen des Nazareners entspreche, verwundert nicht. Nachdenklich stimmt jedoch die Tatsache, dass bei der Umsetzung des Jesusprogramms längst nicht immer uneigennützige Motive, sondern oft auch Machtgelüste, Geldgier und persönliche Rivalitäten eine nicht zu unterschätzende Rolle spielten.
Was ist die Kirche? Auf diese Frage antwortet der 1566 im Anschluss an das Reformkonzil von Trient herausgegebene Catechismus Romanus: »Die Kirche ist das Reich Gottes auf Erden.« Womit sie sich praktisch gegen jede Art von Kritik immunisierte.
»Kirche? Was ist denn das?« Diese Frage stellt auch Friedrich Nietzsche in seiner Schrift Also sprach Zarathustra. Dort lautet die Antwort: »Kirche – das ist eine Art von Staat, und zwar die verlogenste.«
Auch wenn man Nietzsches Behauptung mit guten Gründen widersprechen kann, bedeutet das noch lange nicht, dass man sich deswegen die erwähnte Katechismusantwort zu eigen machen muss. Ausdrücklich wurde diese quasi häretische Ansicht erst vom Zweiten Vatikanischen Konzil zurückgenommen, wenn es in seinem Grundsatzdokument Über die Kirche lehrt, dass diese auf dem Weg zum Gottesreich ist, bis zum Ende der Zeiten. Weiter unterstreicht das Konzil, dass die Kirche eine »komplexe Wirklichkeit« ist, »die aus göttlichen und menschlichen Elementen zusammenwächst«. Ins Alltagsdeutsch übersetzt: Aus dem von Jesus entfachten göttlichen Feuer züngeln nicht nur geistliche Flammen; vielmehr steigt daraus auch viel garstiger menschlicher Rauch empor. Was das praktisch bedeutet, hat Joseph Ratzinger vor Jahren, als er in Regensburg noch Theologie unterrichtete, so formuliert:
Es ist nicht zu verkennen, dass auch von Amts wegen vieles in der empirischen Kirche geschieht, was, theologisch gesehen, unkirchlich oder gar antikirchlich ist. Die Folgen dieser für unser heutiges Empfinden ob ihrer Selbstverständlichkeit beinahe banal klingenden Aussage sind schwerwiegend. Denn wenn es so steht, und zwar nach kirchlicher Lehre so steht, dann kann und darf gerade die Kirche selbst eine Totalidentifikation mit der jeweiligen empirischen [d. h. konkreten] Kirche nicht wollen.
Kurzum, das göttliche Wesen der Kirche ist an allen Orten und zu allen Zeiten von menschlichem Unwesen durchsetzt. Daraus folgt, dass sich die Treue zur Kirche nicht in blinder Ergebenheit, sondern in kritischer Loyalität manifestiert. Denn nicht mit der Kirche schlechthin, sondern mit Christus (und seiner Vorstellung von Gemeinschaft) können und sollen sich die Getauften vollumfänglich identifizieren. Diese Identifikation bildet gleichzeitig das kritische Korrektiv gegenüber der konkreten Kirche, die (wie schon die Kirchenväter betonten) ständig der Umkehr und der Erneuerung bedarf.
Seit jeher hat es Rufer und Mahnerinnen gegeben, die im Namen Jesu, im Namen des Evangeliums und im Namen Gottes Missstände anprangerten und zu Reformen aufriefen. So wird denn hinsichtlich der Geschichte der römischen Kirche (von ihr ist in diesem Buch die Rede) nicht nur deren Größe, sondern auch ihr Elend augenscheinlich. Dabei kann es nicht darum gehen, Sternstunden gegen Schandtaten aufzurechnen. Vielmehr werden im Folgenden ruhmreiche Ereignisse und Ärgernis erregende Entwicklungen nach Möglichkeit in chronologischer Reihenfolge dargestellt (wobei jedes Kapitel ein Ganzes bildet, sodass mit der Lektüre auch in der Buchmitte begonnen werden kann). Gelegentlich kommt gar beides in ein und derselben Geschichte zur Sprache – etwa wenn Papst Hadrian VI. die Laster der Kurie geißelt und gleichzeitig eine Reform des Klerus anmahnt. Die Blütezeiten verdienen es durchaus, großgeschrieben zu werden, allerdings ohne dass die Skandale im Kleingedruckten verkrümeln. Stets handelt es sich um Momentaufnahmen von Höhen und Tiefen einer Glaubensgemeinschaft, die wie jede menschliche Institution immer wieder hinter ihren eigenen Ansprüchen zurückbleibt.