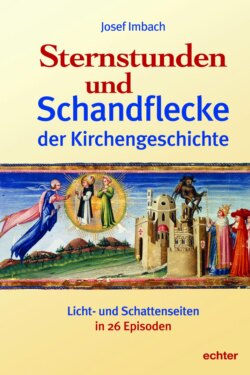Читать книгу Sternstunden und Schandflecke der Kirchengeschichte - Josef Imbach - Страница 12
ОглавлениеDie Leichensynodeoder Schändung der Totenruhe
Auf Hochverrat stand im Rom der Kaiserzeit die Todesstrafe. Nach der Hinrichtung wurde den Schuldigen das Begräbnis verweigert. Etwaige zu ihren Ehren errichtete Standbilder mussten zerstört werden. Den Angehörigen war es verboten, um die Verurteilten zu trauern oder Bildnisse von ihnen aufzubewahren. Alle diese Bestimmungen gipfelten in der damnatio memoriae, der vollständigen Auslöschung des Andenkens. Das bedeutet, dass die Namen der Verfemten – es handelte sich ja fast ausschließlich um illustre Persönlichkeiten – von allen öffentlichen Denkmälern entfernt und aus den Staatsakten getilgt wurden.
Später, als das Christentum dem angeblich zappendusteren Heidentum endgültig den Garaus gemacht und die Kirche die Macht an sich gerissen hatte, gehörte die Rache an den Toten keineswegs der Vergangenheit an. Da die Christgläubigen anfänglich Denkmäler für noch Lebende ablehnten, beinhaltete die von ihnen gepflegte damnatio memoriae naturgemäß die Tilgung des Andenkens. Dabei entwickelten die Kirchenführer zeitweise einen ausgeprägten Sinn für das Schauerliche und Makabere. Das abstoßendste und frevelhafteste Beispiel dafür bildet die berühmte Leichensynode, welche Papst Stephan VI. 897 in Rom inszenierte. Diese hatte jedoch, wie häufig bei scheinbar religiösen Auseinandersetzungen, überhaupt nichts mit dem Glauben, desto mehr aber mit Herrschaftsansprüchen und mit Politik zu tun.
Gegen Ende des 9. Jahrhunderts stritten der Markgraf Berengar von Friaul und der Herzog Guido II. von Spoleto in wüsten Kämpfen um die Herrschaft in Italien. Guido vermochte sich durchzusetzen. Vom Größenwahn gepackt, zwanger Papst Stephan V. 891, ihn zum Kaiser zu krönen. Das führte zu neuen Unruhen, weil Markgraf Berengar weiterhin nach der Krone strebte. Damals fragten sich viele, ob es überhaupt rechtens sei, dass der Papst italienischen Kleinfürsten die Kaiserwürde verlieh. War dieser Rang denn nicht ausschließlich den Nachkommen Karls des Großen vorbehalten, den Leo III. an Weihnachten des Jahres 800 zum Kaiser gekrönt hatte?
Stephan V. stirbt schon im September des Krönungsjahres. Zum Nachfolger gewählt wird Formosus, der 75-jährige Kardinalbischof von Porto. Der aber sympathisiert mit Berengar – und ist im Übrigen der Ansicht, dass die Kaiserkrone eher auf den Kopf des deutschen Königs Arnulf passe. Nach Guidos Tod eilt dessen Sohn Lambert nach Rom, begleitet von seinen Truppen, um vom Papst die Krone zu fordern. Formosus fügt sich dem Druck, ruft dann aber, kaum dass der Neuerkürte Rom verlassen hat, den deutschen König Arnulf zu Hilfe, um gegen die »schlechten Christen« von Spoleto vorzugehen und den arroganten Lambert abzusetzen. Arnulf marschiert gen Rom, Lambert flieht. Es ist dies das erste Mal in der abendländischen Geschichte, dass ein deutsches Heer Rom belagert, weil ein deutscher König sich die Kaiserkrone holen will. Formosus, von den Römern des Verrats bezichtigt und unter Hausarrest gestellt, wird von den deutschen Truppen befreit; zum Dank krönt er Arnulf im April 896 zum Kaiser.
Den neuen Herrscher hält es gerade drei Wochen in Rom, dann schnappt er sich zwei Adelige als Geiseln und bricht nach Spoleto auf, um Lambert zu bekriegen. Doch statt sich auf dem Schlachtfeld zu bewähren, übt sich der zu Ausschweifungen neigende Arnulf lieber in Bettschlachten, holt sich eine venerische Krankheit und zieht nach Regensburgweiter, wo er 899 stirbt.
Formosus indessen ist durch die Förderung des Deutschen bei den Römern in Misskredit geraten; schon einen Monat nach der Krönung, im Mai 896, lassen seine Kräfte nach; eine kurze Krankheit führt zum schnellen Tod. Sein Nachfolger Bonifaz VI. regiert gerade zwei Wochen; dann stirbt er unversehens. Ob er umgebracht wurde, ist umstritten.
Der nächste Papst, Stephan VI., Sohn eines römischen Presbyters und bis dahin Bischof von Anagni, ist eine Kreatur der Spoletaner. Solange Arnulf in Italien weilt, anerkennt ihn Stephan als Herrscher. Kaum jedoch hat der »nordische Barbar« Italien verlassen, schlägt der Papst sich auf die Seite des Schattenkaisers Lambert. Um diesem seine Anhänglichkeit zu beweisen, möglicherweise aber auch aus persönlicher Rachsucht gegenüber seinem Vorgänger Formosus, inszeniert Stephan in der Folge ein abscheuliches Schauspiel. Er beruft eine Synode ein. Kaum dass die Kardinäle, Bischöfe und andere geistliche und weltliche Würdenträger sich eingefunden haben, lässt er die Leiche des Formosus aus der Gruft reißen. Dann wird der bereits in Verwesung übergegangene Körper mit päpstlichen Gewändern bekleidet und im Lateranpalast auf einem Thron festgebunden; der Prozess kann beginnen.
Erster und wichtigster Anklagepunkt bei diesem frevelhaften Totengericht: Formosus wurde gegen das geltende Recht zum Papst gewählt. Wie bereits erwähnt, war dieser, bevor er den Stuhl Petri bestieg, Erzbischof von Porto. Nun erinnerte man sich plötzlich wieder an weit zurückliegende und längst überholte Entscheidungen früherer Kirchenversammlungen, welche verboten, einen Bischofssitz mit einem anderen zu vertauschen. Ebendies aber habe Formosus sich zuschulden kommen lassen, indem er, angeblich aus Ehrgeiz, von Porto nach Rom wechselte – ergo sei seine Wahl null und nichtig. »Weshalb«, so der lebende zu dem schon verwesenden Papst, »hast du aus Ehrsucht den apostolischen Stuhl usurpiert, da du doch Bischof von Porto warst?«
Wohl hat man dem Toten einen Anwalt zugestanden, der für ihn spricht. Aber der übt sich wohlweislich in Zurückhaltung, weil er befürchten muss, dass man sonst auch mit ihm kurzen Prozess macht … In der Folge erklärt die vor der Papstleiche tagende Synode sämtliche von Formosus vollzogenen Weihen und Amtshandlungen – somit auch Arnulfs Krönung – für ungültig. Anschließend unterschreiben die Versammelten ein Absetzungsdekret, während der Henker der Leiche die drei Segensfinger der rechten Hand abhackt. Dann wird der Verurteilte vom Thron gerissen, durch die Straßen Roms geschleift und in den Tiber geworfen.
Stephan bringt die Leichensynode (wie diese ruchlose Versammlung schon bald genannt wird) kein Glück. Da er alle systematisch verfolgt, welche Formosus in ihre Ämter eingesetzt hat, wächst die Zahl seiner Gegner. Diese verehren den Vorgänger wie einen Märtyrer und bald geht die Rede, dass Rom seinen Wohltäter geschändet habe. Die deutschfreundliche Partei gewinnt zunehmend Sympathisanten und wagt den Aufstand. Stephan wird gefangen gesetzt und im Kerker erdrosselt.
Die geschändete Leiche des Formosus hingegen wird später von Fischern aus dem Tiber gezogen und in Alt-Sankt-Peter ehrenvoll beigesetzt. Das Grabmal fiel (wie das so vieler anderer Päpste) im 16. Jahrhundert dem Neubau der Peterskirche zum Opfer. Abgesehen von einem Porträt im Kranz der Papst-Rundbilder, die das Mittelschiff der Basilika San Paolo fuori le Mura zieren, erinnert in Rom kein Monument und keine Inschrift an Formosus.