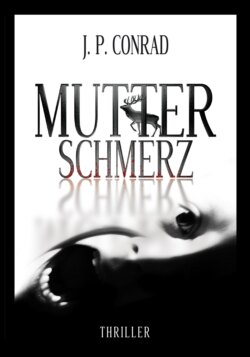Читать книгу Mutterschmerz - J.P. Conrad - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
ОглавлениеWilhelm spürte keine Schmerzen. Seit fast zwei Minuten lag er wach und spürte überhaupt nichts, außer einer erneut aufziehenden Müdigkeit. Da er sich aufgrund seiner körperlichen Schwäche kaum bewegen konnte, blieb ihm nichts anderes übrig, als an die kahle Decke über ihm zu starren, deren unregelmäßige Erhebungen er mittlerweile auswendig kannte.
»Anna? Anna, bist du da?«, rief er, als er der Stille überdrüssig wurde. Nach einem kurzen Moment hörte er Schritte im Flur, dann wurde die Tür zu seinem Krankenzimmer, das ursprünglich einmal ihre gemeinsame kleine Wohnstube gewesen war, aufgeschoben.
Die Schwester blickte ihn, mit leichter Verwunderung an. »Ihre Frau ist weggegangen«, sagte sie dann. »Sie holt Ihre Tochter vom Bahnhof ab.«
Wilhelm hatte gar nicht mitbekommen, dass sie gegangen war, und auch nicht, dass sie die Pflegerin hereingelassen hatte. Aber er bekam ja so vieles nicht mehr mit, seit er krank war. Das Leben zog schnell an ihm vorbei, während sein eigenes vollkommen stillstand; wie eine Uhr, die man vergessen hatte, aufzuziehen. Das Bett war seine ganze Welt; seit über einem Jahr nun schon. Es war eine Aussätzigeninsel, mit ihm als einzigem Bewohner.
Aber es gab einen kleinen Hoffnungsschimmer; ein Licht am Ende des Tunnels, das nicht das seiner Erlösung, sondern seiner Heilung sein konnte. Er setzte alle Zuversicht in die optimistischen Worte des Arztes, die er nach der letzten großen Untersuchung und dem Beginn einer neuen Therapie, zu ihm gesagt hatte. Vielleicht war ihm ja doch vergönnt, dieses furchtbare Bett nochmal verlassen und sich für ein paar Jahre an den Dingen erfreuen zu dürfen, die er früher getan hatte. Oder wenigsten noch für ein weiteres Jahr, um das wieder aufzuholen, was er verpasst hatte.
Die Schmerzen hatten ihn von Beginn an begleitet. Aber jetzt, nachdem er geschlafen hatte, waren sie plötzlich fort.
»Ich spüre nichts«, sagte er zur Schwester, die sich über ihn beugte und seine Pupillen überprüfte. »Keine Schmerzen mehr.«
»Ein gutes Zeichen«, erwiderte sie und lächelte sanft.
»Wieso?«
»Das heißt, dass die Spritze gewirkt hat.« Sie tippte auf seinen Unterarm.
Wilhelm sah sie unverständig an und drehte dann den Arm herum. Dort klebte ein kleines Pflaster, das sie jetzt abzog. Der Einstich darunter war kaum zu erkennen.
»Sie haben mir eine Spritze gegeben?«, fragte er verwirrt. »Während ich schlief? Wieso?«
Die Schwester antwortete nicht sofort, zog ihm stattdessen seine Decke ordentlich bis über die Brust.
»Warum haben Sie mir eine Spritze gegeben?« Bisher hatte sie das nie getan; nur der Arzt, der alle zwei Tage bei ihm vorbei schaute.
»Nachher kommt doch Ihre Tochter zu Besuch«, erklärte sie ihm, während sie ihn etwas vorbeugte und das Kissen geraderückte. »Und ich möchte, dass für sie und Ihre Frau alles bereit ist.«
Wilhelm verstand nicht, was sie damit meinte. »Sie dürfen mir nichts spritzen! Nur Doktor Falk darf das!« Die Tatsache, dass sie es dennoch getan hatte, wühlte ihn innerlich auf.
Die Schwester machte eine beschwichtigende Geste. »Es gibt überhaupt keinen Grund, sich aufzuregen! Wollen Sie nicht lieber wissen, was drin war?« Sie zog erwartungsvoll eine Augenbraue nach oben.
Als er ihr nicht sofort antwortete, erklärte sie, mit beängstigender Gelassenheit: »Ich habe Ihnen eine Kombination aus Morphin und Diazepam gespritzt. Genau abgestimmt auf Ihre Körpergröße und Ihr Gewicht. Das Morphin wirkt ja wohl schon. Mit dem Valium dürfte es jeden Moment soweit sein. Wundert mich ohnehin, dass Sie nochmal aufgewacht sind.« Sie klang fast ein wenig verärgert.
»Warum haben Sie das gemacht?«, wollte Wilhelm wissen und spürte jetzt umso deutlicher, wie ihm die Augenlider langsam schwer wurden.
»Aus Gerechtigkeit. Ihnen gegenüber.« Sie nahm einen Stuhl und stellte ihn an sein Bett. Nachdem sie sich gesetzt hatte, seufzte sie mit im Schoß gefalteten Händen.
»Eigentlich ist es nicht meine Art, zu petzen. Aber was bleibt mir jetzt übrig? Ich kann ja schlecht einfach aus dem Zimmer gehen und einen Kaffee trinken. Nein, das bin ich Ihnen dann auch schuldig.« Sie atmete tief durch und fuhr fort: »Ich habe gestern, nachdem Doktor Falk hiergewesen ist, ein Gespräch zwischen ihm und Ihrer Frau belauscht. Er hat mit ihr über die letzte Untersuchung gesprochen.«
Wilhelm schaute die Schwester mit fiebrigem Blick an. Diese verzog bedauernd die Mundwinkel und schüttelte den Kopf.
»Ich fürchte, es gibt keine Hoffnung mehr für Sie. Sie werden, bei entsprechender Pflege, vermutlich noch Jahre dahinsiechen, bis Sie endlich erlöst sind.«
»Das glaube ich nicht. Doktor Falk hatte mir gesagt, die neue Behandlung würde gut anschlagen«, entgegnete Wilhelm aufgewühlt und mit zitternder Stimme. Er wollte sich aufrichten, stemmte die Arme auf das Laken. Aber er brachte es nicht fertig. Sein Körper war zu sehr geschwächt.
Sie schüttelte erneut den Kopf. »Er hat Ihnen das gesagt, was Sie hören sollten. Was Ihre Frau wollte, dass Sie hören sollen! Nicht wirklich gerecht, oder? Der Funken Hoffnung, der Sie am Leben hält, ist plötzlich nicht mehr als eine Kerze im Wind, während der Sturm aufzieht. Aber dank mir wissen Sie jetzt, dass Sie nur mehr Schmerzen und Qualen hätten erdulden müssen. Und ebenso Ihre Frau und Ihre Tochter. Ich denke nicht, dass Sie ihnen das antun wollen, oder?« Sie sah ihn fordernd an.
»Ich werde wieder gesund!«, sagte Wilhelm trotzig. »Der Arzt hat es gesagt! Meine Werte sind besser geworden!«
»Alles gelogen! Ihre Frau, Doktor Falk und alle, die Sie kennen, lügen Ihnen dreist ins Gesicht. Ich versichere Ihnen, Ihre Frau sitzt gerade mit Ihrer Tochter in der Straßenbahn und weiht sie in das Geheimnis ein.« Ihr Zeigefinger deutete in Richtung Tür. »Und sie wird genauso mitspielen und Ihnen ins Gesicht lügen. Alles unter dem Deckmantel der Liebe zu Ihnen. Pah!« Sie rollte verächtlich mit den Augen. Als sie Wilhelm wieder anschaute, glättete sich die Zornesfalte auf ihrer Stirn und sie setzte wieder ihr sanftes Lächen auf. »Nur ich tue das nicht. Und wissen Sie, wieso? Weil ich Anstand besitze! Sie sind nicht einfach nur ein Patient für mich, wie ein Kunde in einer Metzgerei. Ich trage Verantwortung für Sie, pflege Sie seit fast einem halben Jahr. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass Sie wieder gesund werden. Aber ich denke realistisch und habe die bittere Wahrheit gleich akzeptiert. Und deshalb helfe ich Ihnen jetzt; das sehe ich einfach als meine Pflicht an!«
»Wie?«, fragte Wilhelm ängstlich. Er hatte inzwischen große Mühe, die Augen geöffnet zu halten. Schweißperlen bildeten sich auf seiner Stirn.
»Indem ich Sie von Ihrem Leiden erlöse«, antwortete die Schwester ruhig. »Sie und die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen.« Nach einer Pause fuhr sie eindringlich fort: »Sie sollten sich aber fragen, ob Sie ihrer Familie ebenso am Herzen liegen, wenn Sie von ihr derart belogen werden! Insofern soll das, was ich für Sie tue, nicht nur eine barmherzige Tat sein, sondern Ihnen auch die Genugtuung geben, allen ein schlechtes Gewissen zu bereiten, für die Lügen, die sie Ihnen erzählen. Und das werden sie haben, ganz sicher. Vielleicht für den Rest ihres Lebens! Ich denke, so können Sie wirklich beruhigt sterben!«
Wilhelm schüttelte heftig den Kopf. »Aber ich will das nicht! Sie dürfen das nicht tun!«, krächzte er heiser.
Die Schwester lächelte mild, tupfte ihm den Schweiß mit einem Tuch ab und legte ihre Hand auf seine.
»Sie werden ganz friedlich einschlafen. Die Embolie, die Sie haben werden, wird überhaupt nicht wehtun. Wegen des Morphins. Und es wird im Schlaf passieren, dank des Valiums.«
Wilhelm schnappte panisch nach Luft. »Sie bringen mich um!«
»Ich bringe Sie nur schneller an einen besseren Ort. Mit einer kleinen Injektion. Ich werde Ihnen nichts weiter als ein bisschen Luft spritzen, um Ihnen zu helfen. Sie sollten mir dankbar sein! Und Sie können mir vertrauen, ich weiß, was ich tue. Sie sind nicht der Erste, der sein Gnadenbrot durch mich erhält. Und Sie werden sicher nicht der Letzte sein.« Sie schaute teilnahmsvoll ins Leere. »Es gibt noch so viel Leid zu lindern. Aber ich tue, was in meinen Kräften steht!«
Sie stand auf und überprüfte erneut seine Pupillen. »Sehr schön«, lobte sie. »Es wird nicht mehr lange dauern. Wenn Ihre Frau zurückkommt, werden Sie eingeschlafen sein. Ich muss mich jetzt darauf vorbereiten, ihnen die furchtbare Nachricht zu überbringen. Und ich muss natürlich den Notarzt verständigen.« Sie ging zur Tür und verließ den Raum mit den Worten: »Freuen Sie sich, eine bessere Welt wartet auf Sie!«