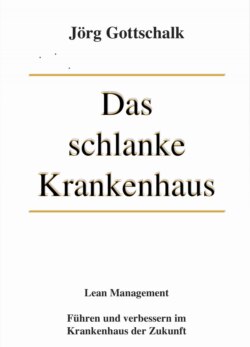Читать книгу Das schlanke Krankenhaus - Jörg Gottschalk - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3 Was uns daran hindert, besser zu werden
ОглавлениеEin Krankenhaus ist eine äußerst intelligente Organisation. Sie strotzt nur so vor Wissen, Ideen und Lösungen. Diese intelligente Organisation wird ununterbrochen daran gehindert, Ideen in die Tat umzusetzen. Doch Hindernisse treten selten offen zutage, viele verstecken sich tief unter der Oberfläche. Die meisten halten wir für so selbstverständlich im Leben einer Organisation, dass wir sie als gegeben akzeptieren – meist stillschweigend. Diese stillschweigende Akzeptanz ist nichts anderes als eine geistige Kapitulation vor dem Faktischen, dem Heute. Was also hindert uns, voranzukommen? Was führt dazu, dass das Bewahren des Ungewollten offenbar leichter scheint als seine Verbesserung?
Knappheit, Komplexität, Kultur und Kompetenz – die vier K der Krankenhausorganisation stellen die Hindernisse dar, die so unüberwindlich erscheinen.
Knappheit – von allem existiert immer weniger, als wir zu brauchen meinen.
Komplexität – egal, an welchem Rädchen wir drehen, es drehen sich andere mit.
Kultur – Medizin bedeutet Individualität und wird damit zum Feind effizienter Prozesse.
Kompetenz – es herrscht organisatorische Kompetenzlosigkeit.
Knappheit
Knappheit bedeutet, dass naturgesetzlich von allem zu wenig existiert: zu wenig Personal, Zeit, Geräte, Räume oder einfach zu wenig Geld. Knappheit ist kein Krankenhausprivileg, sondern die Grundlage unserer gesamten Wirtschaftsordnung. Hätten wir von allem immer genug oder noch mehr, hätten wir viele Probleme nicht. Sehr wahrscheinlich würden wir uns in diesem Fall mit anderen Sorgen quälen, die wir jedoch heute nicht kennen. Wir beklagen uns über die ständige Knappheit, ohne wirklich zu wissen, ob es uns oder unseren Organisationen besserginge, wenn keine Knappheit herrschte.
In einem Unternehmen dreht sich vieles um die optimale Organisation von Knappheit. Der Grundkonflikt besteht darin, zu entscheiden, wie welche Ressourcen wo eingesetzt werden, damit der resultierende Output den größtmöglichen Nutzen stiftet. Es geht um die bestmögliche Verteilung stets knapper Ressourcen zum Wohle von Patienten.
Komplexität
Eine Krankenhausorganisation weist eine ungleich höhere Komplexität auf als jedes Industrieunternehmen. Im Prozess der Patientenversorgung besteht stets eine starke, wechselseitige Abhängigkeit jedes Arbeitsschrittes von dem jeweils vor-, gleich- oder nachgelagerten Schritt. Jeder Prozessschritt hat dabei eine hohe Variabilität, was zu einem schwankenden und damit schwer zu steuernden Arbeitsanfall führt. Deswegen erzeugt jede Veränderung an einer Stelle der Organisation an einer anderen Stelle eine Wirkung – manchmal positiv, oft negativ. Solche Wirkungen können wir selten vorhersehen, geschweige denn (konzeptionell) planen.
Die Komplexität nimmt unaufhaltsam zu, weshalb auch viele Rezepte der Vergangenheit heute nicht mehr funktionieren. Der konzept- bzw. projektorientierte Ansatz, mit dem wir in der Vergangenheit mehr oder weniger erfolgreich versucht haben, Organisationen zu verändern, weicht deshalb im Lean Management dem Prinzip der kleinen Schritte.
Kultur
Die Versorgung von Patienten in der Institution Krankenhaus ist einst aus der Einsicht entstanden, dass Heilung kein individueller ärztlicher Akt bleiben kann, sondern viele Kompetenzen gleichzeitig erforderlich sind, die von einer Person alleine unmöglich geleistet werden können. Zwar arbeiten heute in einem Krankenhaus zahlreiche Berufsgruppen und Menschen miteinander, doch bleibt der Kern der Krankenhausversorgung die Medizin. Das ist der Grund, warum sich Krankenhausprozesse nach wie vor primär an der ärztlichen Ressource ausrichten, die stets wichtig, besonders knapp und teuer zu sein scheint. Sie orientieren sich selten an den Patienten. Die Kultur der Ärzteorientierung führt zu einer Fehlfokussierung von Behandlungsprozessen, zu hoher Individualität, zu latenter Regelaversion sowie zu einer Überbetonung medizinischer Sachverhalte vor organisatorischen Notwendigkeiten. Krankenhausversorgung funktioniert auf diese Weise offensichtlich gut, doch sie frisst viel Energie, Ressourcen und Geld.
Kompetenz
Eine Krankenhausorganisation ist zweifelsfrei hochkompetent, ihr Gesamtbildungsgrad hebt sich deutlich von anderen Organisationsformen ab. Es existiert ein großes medizinisches, pflegerisches und funktionelles Wissen, für dessen Erhalt und Ausbau erhebliche Mittel und Zeit investiert werden. Es fehlt jedoch eine zentrale Kompetenz: wie Organisationen und ihre Prozesse verbessert werden. Es fehlt das methodische Prozesswissen ebenso wie handwerklich-prozessuales Wissen, um Organisationen kontinuierlich weiterzuentwickeln, sie stetig zu verbessern.
Solche Kompetenzen wurden bisher kaum abgerufen und folglich nicht aufgebaut oder sie blieben lediglich einer kleinen Gruppe zentraler Unterstützer im Qualitätsmanagement oder in den Organisationsabteilungen vorbehalten. Die aber sind angesichts der schieren Größe und der hohen Komplexität einer Krankenhausorganisation in der Regel hoffnungslos überfordert.
Die vier K bieten eine erste Orientierung für das, was eine Organisation täglich daran hindert, sich selbst zu verbessern. In gewisser Weise bilden sie den Ordnungsrahmen. Auf der Prozessebene, also im konkreten Tun, existieren weitere, greifbare Barrieren für Veränderung.
Abb. Zehn Hindernisse © Jörg Gottschalk
Ziellosigkeit
Alle Krankenhausorganisationen verfügen über messbare, wirtschaftliche Ziele. Sie stellen jedoch keine spürbare Verbindung her zwischen der „abstrakten“ Unternehmens- oder Abteilungsebene einerseits, auf die diese Ziele primär abzielen, und dem konkreten Arbeitsplatz der Mitarbeitenden andererseits. Was genau muss an einem spezifischen Arbeitsplatz von diesem einen Mitarbeiter oder dieser einen Mitarbeiterin getan werden, damit die wirtschaftlichen Ergebnisse erreicht werden? In der täglichen Verbesserungsarbeit bewegt sich eine Organisation stets auf der Prozess-, Vorgangs- und Aufgabenebene, also dort, wo Mitarbeitende konkret im Arbeitsalltag handeln und mit Patienten direkt im Kontakt stehen. Hier helfen keine abstrakten Qualitäts- oder Gewinngrößen. Notwendig sind vielmehr operative Prozesskennzahlen, die Orientierung genau dort geben, wo sie tatsächlich benötigt wird: bei jedem einzelnen Mitarbeitenden an jedem einzelnen Arbeitsplatz. Ohne operative Prozesskennzahlen verlieren sich die Mitarbeitenden im Abstrakten und Prozessarbeit verliert sich im Unendlichen und Beliebigen. Es fehlt die Orientierung, die Richtung. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf der Prozessebene arbeiten ziellos, ohne eine erlebbare Verbindung zu einem übergeordneten Ziel.
Die Fähigkeit einer Organisation, aus den abstrakten Erwartungen ihrer Patienten und den Unternehmenszielen lebendige, operative Prozessziele abzuleiten, fehlt – und damit fehlt auch ein sehr zentrales Element für die nachhaltige Schaffung von Prozessstabilität und Veränderungsdynamik.
Transparenz
Während noch vor zehn Jahren Daten und Kennzahlen im Krankenhaus eine Mangelware darstellten, verfügen Krankenhäuser heute über eine beinahe unendliche Anzahl an Ergebnis-, Leistungs-, Kosten- und Qualitätskennzahlen. Controlling erlebt derzeit einen beispiellosen Bedeutungsaufschwung. Auf der Prozessebene allerdings herrscht nach wie vor Intransparenz. Es mangelt an gelebten Standards und Regeln sowie Prozesskennzahlen, heutige IT-Systeme folgen einer primären Abrechnungs- und weniger einer Prozesslogik. Deshalb stehen relevante Kennzahlen auf der Arbeitsebene selten zur Verfügung und müssen mühsam, zum Teil händisch, erhoben werden.
Es fehlen also die Fakten, an denen sich Mitarbeitende, Teams und Führende zeitnah und nicht lediglich retrospektiv orientieren können. Messbarkeit und Faktenorientierung aber sind die grundlegenden Voraussetzungen für jede Organisation, um Probleme zu erkennen, sie zu analysieren, zu bewerten und die Wirkung von Verbesserung zu bemessen. Ohne belastbare Fakten bleibt jede Argumentation und jede Diskussion im Ungefähren, im Gefühlten und Individuellen. Sie entziehen sich jeder objektiv-rationalen Beurteilung und Verbesserung.
Erfahrungen
Alles Handeln von Menschen basiert auf den Erfahrungen, die sie im Laufe eines Lebens und in einer Organisation sammeln. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in komplexen Organisationen müssen in der Regel die Erfahrung machen, dass sie nur sehr schwer etwas bewegen können, von ihren Vorgesetzten wenig Unterstützung erfahren und bei der Lösung ihrer Probleme weitgehend auf sich selbst gestellt sind.
Wenn diese Haltung in einer Organisation vorherrscht, werden Probleme nicht mehr gelöst, sondern umgangen. Es wird irgendwann nicht mehr der Versuch unternommen, Hindernisse beherzt anzugehen, um sie zu überwinden. Alle Mitarbeitenden entscheiden sich lieber dafür, keine Energie mehr für Handlungen und Konflikte aufzuwenden, wenn es sich nach ihrer Erfahrung nicht lohnt: „Verbesserung gelingt doch nie. Das haben wir alles schon probiert.“
Das wirkliche Hindernis für Verbesserungsarbeit besteht dann nicht mehr darin, das Hindernis selbst zu überwinden. Die Hauptarbeit liegt darin, Menschen dazu zu bewegen, ihre Energien überhaupt für einen solchen Hindernislauf aufzubringen, ihre Erfahrungen über Bord zu werfen und eine neue Erfahrung zuzulassen: dass sich doch etwas bewegen lässt. Die einzige Möglichkeit, ein solches kollektives „Erfahrungstrauma“ zu überwinden, besteht darin, neue Erfahrungen zu sammeln. Es helfen weder PowerPoint-Folien, Apelle noch große Reden – nur Taten.
Es stellt eine echte Herausforderung dar, Menschen dazu zu bewegen, etwas Neues auszuprobieren und niemals aufzugeben, auch wenn sich wieder einmal ein Hindernis nicht beim ersten Mal überwinden lässt. Wir müssen die Beteiligten wieder neugierig machen und zum Durchhalten bewegen. Anders wird es nicht gelingen.
Tunnelblick
Der Mensch neigt dazu, das aktuell Gelebte als sein persönliches Universum zu begreifen. Außerhalb dieses Tunnels lauert das Unbekannte, das Gefährliche. Wer lange Jahre in einer Organisation arbeitet, erlebt sein System als sein persönliches Universum und kann sich kaum vorstellen, dass ein anderes existieren könnte. Seine Erfahrungen und Routinen verleiten ihn dazu, am Bekannten festzuhalten – so unbequem und falsch es auch ein mag. Dabei spielt ihm sein Gehirn einen gewaltigen Streich. Etwa Neues auszuprobieren oder zu experimentieren ist zwar häufig nicht schwer, doch es entspricht nicht dem natürlichen, menschlichen Handlungsmuster. Das Gehirn liebt es, erfahrungsbasiert, automatisch, schnell und häufig unbewusst solche Lösungen zu finden, die es bereits kennt. Es ist fester Bestandteil des urmenschlichen Überlebensdrangs.
Im Verbesserungsprozess arbeitet man gegen diesen menschlichen Wesenszug an. Zu Beginn jeden Veränderungsprozesses fällt es schwer, ursachenorientiertes Problemlösen zu praktizieren. Man kämpft gegen den menschlichen Reflex, Offensichtliches als das eigentliche Problem zu identifizieren oder schnelle Lösungen zu favorisieren, die entweder nicht die wirklichen Ursachen bearbeiten oder ein Problem lösen, das so gar nicht existiert. Der Mensch schießt zu schnell und wird so Opfer seiner eigenen Ungeduld. Es fehlt die Kompetenz, rational und ursachenorientiert zu arbeiten, der Weitblick, über den eigenen Tellerrand hinauszudenken und die Fähigkeit, sich aus dem persönlichen Erfahrungstunnel zu befreien.
Not invented here
Not invented here beschreibt ein Phänomen, bei dem es am ehesten um die Frage geht: „Was geht es mich an?“ Positiver formuliert fragt sich ein Mitarbeiter: „Was kann ich schon tun?“ In großen Organisationen, in denen der Beitrag jedes Einzelnen zum Gesamterfolg kaum mehr messbar, sichtbar und damit für den Einzelnen nicht mehr erlebbar wird, schwindet nicht automatisch das Interesse am Ganzen. Immer jedoch sinkt die persönliche Betroffenheit und der persönliche Verantwortungsbezug. Der Einzelne verliert seine eigene Bedeutung für das Ganze aus den Augen und fühlt sich unwichtig. „Was kann ich schon bewegen?“ Seine Bereitschaft sinkt, überhaupt Energie für Verbesserungsarbeit aufzubringen. Als Rädchen im Getriebe des Großen und Ganzen empfindet er seine persönliche Anstrengung als zu unbedeutend.
Je kleinteiliger Prozessziele definiert werden, je konkreter jeder einzelne Mitarbeitende (auch kleinste) Verbesserungen selbst bewirken muss (oder darf) und den eigenen Beitrag zur Verbesserung selbst erlebt, umso mehr steigt seine persönliche Involviertheit. Es geht nicht darum, Mitarbeitenden das Gefühl der Beteiligung zu geben oder sie gar (irgendwohin) mitzunehmen. Das ist typischer Managerwortnebel. Es geht darum, Führende und Mitarbeitende auf der Arbeitsebene in konkretes Handeln zu bringen und das Ergebnis ihres Handels auf genau dieser Detailebene transparent und spürbar werden zu lassen. Wir müssen unsere Mitarbeitenden nicht mitnehmen, sondern befähigen und machen lassen.
Angst vor Machtverlust
Die Kompetenzen von Mitarbeitenden zu entwickeln, Kompetenz aktiv zuzulassen und sie für das Unternehmen wirksam zu nutzen, fällt vielen Führenden in hierarchischen Systemen schwer. Es ist oft verbunden mit der Angst vor dem eigenen Machtverlust. Neben der formalen Macht existieren nicht ohne Grund zahlreiche weitere Formen informeller Macht, zu deren wichtigsten die Informations- oder Wissensmacht zählt. Wer über Informationen und Wissen verfügt, kann Einfluss üben. Wer andere an seinem Wissen teilhaben lässt oder gar von Mitarbeitenden wissenstechnisch übertroffen wird, verliert an Einfluss. Zumindest lautet so die Befürchtung vieler Führungskräfte.
In einer Organisation der dezentralen, kontinuierlichen Verbesserung müssen sowohl Kompetenzen als auch Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheiten von Mitarbeitenden wachsen dürfen. In einer komplexen Welt entsteht Erfolg und Fortschritt nicht mehr aus der alles umfassenden Kompetenz einer einzelnen Führungskraft, sondern aus ihrer Fähigkeit, das eigene Team zu befähigen und ihre Fähigkeiten für die Organisation produktiv zu nutzen. Hat eine Führungskraft Angst vor der Stärke ihrer eigenen Organisation und befürchtet sie ihren persönlichen Machtverlust, wird sie versuchen, diese Entwicklung zu verhindern – vielleicht nicht bewusst, aber möglicherweise erfolgreich.
Angst vor Neuem
Nicht nur die Angst vor Machtverlust verhindert Veränderung, sondern die Angst vor Neuem generell. Jedem Neuen wohnt vielleicht ein Zauber inne, vor allem aber bedeutet es: Unsicherheit und neue Risiken. Kann man es? Beherrscht man es? Welche (ungewollten) Wirkungen treten ein? Was hat man nicht bedacht? Wie reagieren andere darauf? Was passiert, wenn es schiefgeht? All diese Fragen laufen vor dem inneren Auge ab. Das alte Schlechte kommt uns immer noch besser vor als das neue Unbekannte.
Angst als Gefühl ist durchweg negativ belegt. Im Grunde schützt Angst den Menschen und seine Organisation so manches Mal vor unüberlegtem Handeln, vor nicht kalkulierbaren oder unbedachten Risiken. Angst lädt förmlich zum Nachdenken ein. Solange sie nicht zu Angststarre führt, bleibt sie ein wichtiges, stabilisierendes Element für Menschen und Organisationen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Führungskräfte bereits von der Angst ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gerettet worden sind.
Um im Organisationskontext voranzukommen, müssen wir Ängste überwinden und ausräumen. Ein guter Anfang ist bereits gemacht, wenn man sie als wichtiges, menschliches Gefühl akzeptiert, anstatt sie als etwas Negatives oder Überflüssiges zu verurteilen. Verliert Angst erst ihren negativen Kontext, muss sie weder bekämpft noch infrage gestellt werden. Wie gut kennen wir alle den Ausspruch unserer Eltern: „Du brauchst keine Angst zu haben.“ Ein Dank an unsere Eltern für diesen überflüssigen Hinweis!
Statt die eigene Angst zu ignorieren, infrage zu stellen oder gar abzulehnen, können wir uns nun darauf konzentrieren, uns selbst und anderen zu beweisen, dass es sich lohnt, die eigene Angst zu überwinden und sich selbst die (neue) Erfahrung zu verschaffen, dass das Neue tatsächlich hilfreich sein kann und dass Fehler bzw. Rückschläge nicht bestraft werden. Im Gegenteil: Fehler und Rückschläge sind starke Treiber des Fortschritts und Bestandteil jedes professionellen Veränderungsprozesses.
Hier ist wirkliche und kompetente Führung gefragt: Kleine Schritte machen weniger Angst als große. Transparenz fördert Sicherheit ebenso wie Wissen und Kompetenz. Eine positive Führungs- oder Fehlerkultur schafft den (positiven) Rahmen für Neues. Mit Blick darauf, wie weit wir im Alltag von diesen segensreichen Zuständen entfernt sind, ist es nicht verwunderlich, wenn die Angst tatsächlich zum Bremsklotz der Entwicklung wird.
Hilf(e)losigkeit
Verbesserungsarbeit gleicht einem Hindernislauf. Widerstände, mangelnde Kompetenzen, fehlende Instrumente, lange Entscheidungswege und vieles mehr können eine Organisation und ihre Mitarbeitenden daran hindern, eine angestrebte Lösung zu erreichen. In vielen Situationen benötigen sie Unterstützung und Hilfe von Spezialisten, von Kollegen, aber vor allem von der eigenen Führung. Diese wird ihnen heute allzu oft verweigert. Ihre Hilfebedürftigkeit wird nicht erkannt.
Führung kann mit Wissen helfen, manchmal mit Geld, vor allem jedoch mit schnellen und verbindlichen Entscheidungen. Manchmal ist es nötig, dass die Führung in der eigenen Organisation Türen öffnet, z. B. die einer anderen Abteilung, die ihre Leistung nicht erbringt oder nicht kooperiert. Wenn es diese Hilfe nicht gibt, kann Fortschritt an jeder Stelle im Prozess im Keim ersticken und es erlischt die Energie für Veränderung. Es geht nicht voran.
Deshalb wird sich die Rolle der Führung radikal verändern müssen. In modernen Organisationen erteilt die Führung nicht nur Aufträge an andere und fordert von ihrem Schreibtisch oder aus ihren bequemen Besprechungsräumen heraus „Erfolge“ von ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein. Stattdessen verlässt die Führung ihren Schreibtisch und arbeitet dort (mit), wo die Probleme realiter zu lösen sind. Sie hilft ihren Mitarbeitenden dabei, Verbesserung möglich zu machen. Es liegt nun einmal nicht immer in der Kompetenz dezentraler Teams, organisatorische Hindernisse zu beseitigen. Dazu brauchen sie „Oben“.
Schubladendenken
Die klassische Organisationslehre ordnet eine Krankenhausorganisation sorgfältig in Kästchen und Schubladen ein, streng hierarchisch in ihrer Darstellung von oben nach unten. Jede Schublade repräsentiert einen beschreibbaren, möglichst abgeschlossenen Aufgaben- und Verantwortungsbereich. Bei dieser „Schubladisierung“ stehen traditionell Funktionen und Aufgaben im Fokus, nicht Prozesse und schon gar nicht der Patient. In einem Krankenhaus wird dieser Effekt noch dadurch verstärkt, dass die Dienstgruppenzuständigkeiten abteilungsorientierte Zuordnungen durchqueren. Wer leitet eine Station? Der Chefarzt? Die Pflege? Beide? Wir wissen es nicht. Eine Krankenhausorganisation agiert als Matrix der formalen Unzuständigkeit. Es entstehen viele selbständige, sich selbst optimierende Einheiten mit starker Innenidentität. In der Systemtheorie begründet die starke Innenidentität einer Abteilung und ihre Abgrenzung von anderen erst ihre Lebensberechtigung. Wenn sich eine Organisationseinheit nicht von anderen unterscheidet, dann bräuchte man sie nicht. Umso mehr Gruppen existieren, umso stärker wird ihre Tendenz sein, sich voneinander abzugrenzen.
Dieses Schubladendenken mit seiner fest verankerten Sucht nach Selbstoptimierung verhindert im Grunde jede Form der Kooperation, die in einem Prozess der gemeinsamen Leistungserstellung eine Grundbedingung für effizientes Arbeiten darstellt.
Moderne Verbesserungsarbeit kann auf absehbare Zeit nicht verhindern, dass Abteilungen und Dienstgruppen existieren und sich selbst optimieren. Führung kann jedoch dazu beitragen, dass natürliche Interessensgegensätze nicht auch noch unnötig verschärft werden. Es gibt durchaus wirksame Wege, um abteilungs- und dienstartenübergreifende Kooperationen zu fördern.
Deshalb wird die Führung die Aufgabe annehmen müssen, ihre Schubladen produktiv zu nutzen. Sie wird ihre Organisationseinheiten erhalten, sie nutzen und gleichzeitig überwinden müssen. Keine ganz einfache Angelegenheit.
Bürokratie
Krankenhäuser sind von Natur aus risikoavers, weshalb sie prädestiniert sind für ausgeprägte bürokratische Strukturen. Die Arbeit am Patienten erfordert Ressourcen, Material und Geräte. Manchmal werden nur einfache Hilfsmittel benötigt, manchmal komplexe Software oder aufwendige Geräte. Meist geht es jedoch gerade nicht um die großen Investitionen. Es sind fast immer die kleinen Stolpersteine, die Verbesserung verunmöglichen: eine neue abteilungsübergreifende Handlungsregel, ein fehlender PC, eine fehlende Pinnwand, eine kleine Änderung in der Eingabemaske einer Software, die Änderung eines Formulars, manchmal fehlen nur Sammelordner.
Wenn jede Beschaffung oder Entscheidung, so klein sie auch sein mag, große Entscheidungsprozesse und Genehmigungsverfahren nach sich zieht und jede Beschaffung und jeder interne Auftrag zu einem wahren Hindernislauf für alle Beteiligten wird, dann fließt viel Energie in die falsche Richtung. Hier ist die Führung gefragt, um die Voraussetzungen für schnelles Entscheiden und Handeln zu schaffen. Bürokratie ist ein Geschwindigkeitsfresser und damit ein echtes Hindernis für Verbesserung. In einem Prozess der kontinuierlichen Verbesserung wird Geschwindigkeit zum Selbstzweck und Bürokratie zum Gegner des Fortschritts.