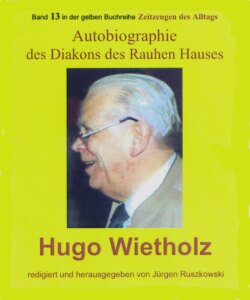Читать книгу Hugo Wietholz – ein Diakon des Rauhen Hauses – Autobiographie - Jürgen Ruszkowski - Страница 4
Hugo Wietholz' Kindheit
ОглавлениеHugo Wietholz, in kleinbürgerlicher Umgebung unter kriegsbedingten Entbehrungen aufgewachsen, durch die Jugendbewegung zwischen den Weltkriegen geprägt, zur Zeit des Nationalsozialismus konträr zum Zeitgeist entschieden ein Mann der Bekennenden Kirche, schrieb seine Lebenserinnerungen sehr detailliert, teilweise aus freier Erinnerung, für die Jahre 1938 bis 1991 an Hand von Tagebuchaufzeichnungen, für seine Familie auf.
1989: „Nach langer Zeit hole ich meine Tagebuchaufzeichnungen in den Diakonenkalendern hervor. Ich staune über all das, was uns so bewegte. Man wundert sich, was man so alles zuwege gebracht hat, aber was ist nun von bleibendem Wert? Ich beginne, das zu Papier zu bringen. Von jetzt an schreibe ich jeden Morgen ein paar Stunden.“ Er schloss seine Notizen im Sommer 1992 ab. Es wurde eine zeitgeschichtliche Fundgrube. Der Alltag eines tief im christlichen Glauben verwurzelten, begnadeten Jugendführers und engagierten Gemeindediakons wird in diesen Zeilen sichtbar. Überarbeitete Auszüge daraus sollen hier einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt werden:
Hugos Kindheit
„Aus der Jugendzeit klingt ein Lied mir immerdar, o, wie liegt so weit, was einst mein eigen war.“ Ja, nach über 80 Jahren klingt es immer noch, weit stärker, als man es vorher wahrhaben wollte. Im Blick auf die erste Zeit meines Lebens, kann ich nur in großer Dankbarkeit gegenüber unserem Herrn Christus zurückblicken. Urteilt selbst, wenn ihr euch diese Zeilen zu Gemüte führt. Es ist viel Menschliches, allzu Menschliches darunter, aber es zieht sich unbemerkt ein roter Faden durch mein Leben, der ein Ziel hat.
Wir schrieben 1909. Es war die Zeit Kaiser Wilhelms II., der wohl bescheidener hätte auftreten und sich nicht von schlechten Ratgebern hätte leiten lassen sollen, bevor er den eisernen Kanzler vom Regierungsschiff verbannte.
Ich konnte am 4. September 1909 um 11.30 Uhr in der Wrangelstraße in Hamburg in einer gut möblierten Wohnung zum ersten Mal in die Sonne blinzeln. Ja, da war nun der Stammhalter, der die Namen Hugo, Henry, Karl erhielt.
Mein Vater war klein und gedrungen aber kräftig von Statur. Er war ein fleißiger Mann. In seinem Beruf konnte ihm keiner etwas vormachen. In seiner Gesellenzeit war er auch auf Wanderschaft gewesen. Sein Fleiß und seine Begabung kamen ihm zugute, er wurde Vorarbeiter mit besonderer Verantwortung. Die große Firma hat ihn später immer wieder geholt. Anfangs war er wohl in der Gewerkschaft gewesen. Als es dann zum Streik kam, hat man ihm kein Streikgeld gewährt, weil er nicht genügend Mitgliedsbeiträge gezahlt hätte. Wenn er nicht in der Firma arbeiten konnte, so gab es für ihn bei seinem Vater, der ja Meister war, genug zu tun, auch wenn man ihn dann als Streikbrecher beschimpfte. Die Familie brauchte das Geld. Wenn ich mal am Tag zur Aufwartung weggegeben werden konnte, arbeitete Mutter als Reinmachefrau. Die Abzahlungen drückten, und man wollte finanziell Luft haben.
1910-1915
Da war ja nun der kleine Hugo, der sich körperlich gut entwickelte. Mutter gab mir viel Milch. So nahm ich gut zu, ob auch an Geist und Weisheit, lässt sich nicht sagen, mal sehen, was später daraus wurde.
Erst mal kam der 26. Juni 1910. Man brachte mich zur Taufe in die Johanniskirche. Pastor Bernitt vollzog die Taufe. Mutter sagte mir später, dass das bei Donner und Blitz geschah. Der Taufspruch stammte aus den Sprüchen Salomons 23, Vers 26, und da heißt es: „Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen.“ Eigenartig, nachher stellte ich fest, der Spruch passte für mein ferneres Leben.
In unserer Familie ging es wohl auf und ab, denn plötzlich bekamen meine Eltern, das Angebot einer Kellerwohnung, in der Knauerstraße 9. Hier haben wir wohl einige Zeit gewohnt. Meine Mutter ist oft mit mir, in der Karre, ausgefahren. Es ging zur Sengelmannstraße. Hinter der Kirche konnte ich spielen. Im Sommer konnte ich in der Alster baden, die Alsterdampfer machten Wellen, und ich jubelte.
Dann kam der Augenblick, dass man aus dem Keller aufsteigen konnte, denn siehe, in der Hinterhof-Terrasse wurde in der 2. Etage, im Haus Nummer 11c, eine Wohnung frei. Die Beleuchtung bestand noch aus Petroleumlampen.
Es war der 13.12.1913: Ich wurde aus der Wohnung geschickt, saß fröstelnd draußen auf der Treppe und sollte warten. Mein Vater gab mir zur Beruhigung eine getrocknete Feige. Ich spürte, mit Mutter ist irgend etwas nicht in Ordnung. An diesem Tag wurde meine Schwester geboren. Ich hörte später, bei dieser Geburt wäre meine Mutter fast verblutet. Gott sei Dank, alles verlief noch so, dass wir Mutter behalten durften. Ob ich mich zur Schwester, die den Namen Marie bekam, gefreut habe, weiß ich nicht mehr. Nur eines weiß ich, mit der Ruhe war es vorbei.
Kriegszeit
Am 1. August 1914 war der Krieg ausgebrochen. War das eine Aufregung. Blöd war das Gesinge: „Siegreich woll’n wir Frankreich schlagen.“ Es sollte ein Krieg sein, den man bis Weihnachten beendet haben wollte.
An einem Abend, es war ein Sonnabend, saß ich in der Zinkbadewanne. Mutter machte das Licht aus und sagte: „Still!“ Über Hamburg brummte tatsächlich ein englisches Flugzeug.
Weihnachten wurde nun mit dem neuen Erdenbürger gefeiert. Mariechen äugte ganz erstaunt in die Kerzen. Das Fest wurde schon durch die Einberufung meines Vaters zum 23.1.1915 getrübt. Ausgerechnet jetzt, da wir ein neues Familienmitglied hatten, wie sollte es nur werden, wenn der Vater nicht mehr verdienen konnte. Vom Staat wurde dann doch durch Unterhaltszahlung geholfen. Die Kriegerfamilien bekamen eine Kriegsversorgung.
Die Verluste im Westen wurden immer größer, die Blockade gegen die Wirtschaft immer stärker, und nun wurden Lebensmittelkarten eingeführt. Die Stimmung war gedämpft. Die Verpflegung bestand hauptsächlich aus Kohl und Steckrüben. Oft bin ich mit einem Henkeltopf gegenüber zu der Badeanstalt gegangen und konnte dort im Keller den Topf mit Kohlsuppe füllen lassen.
Von Vater hörten wir, er müsse an die Ostfront. In den nächsten Jahren erlebte ich ihn nur mal im Urlaub oder wenn er im Lazarett lag.
1916-1922
1916 wurde ich eingeschult. Ich hatte es gut, brauchte nur über die Straße zu gehen und war in der Schule. Diese Schule in der Knauerstraße steht heute noch, sie hat auch den 2. Weltkrieg überdauert. Es war eine Knabenschule.
Mein erster Eindruck war: Lauter Mütter mit ihren Jungen warteten. Ein älterer Lehrer nahm uns in Empfang und hielt eine Ansprache. Dann ließ er uns die Klappen der Pulte öffnen und wieder schließen. Ganz langsam ging der Lernbetrieb mit den neuen Lesebüchern los.
Immer, wenn an der Front ein Sieg errungen war, gab es frei, und wir freuten uns. Im Westen tobte die Somme-Schlacht und forderte große Verluste. In Verdun ging es um die Festungswerke. Deutschland machte ein Friedensangebot, das wurde aber abgelehnt. Der Hass zwischen den Völkern war groß, Deutschland sollte nicht als gleichberechtigtes Mitglied der Völkergemeinschaft aufgenommen werden. Daraufhin wurde der U-Bootkrieg verschärft. Dann fand die berüchtigte Skagerrak-Schlacht statt, wo es weder Sieger noch Verlierer gab. Im November starb der österreichische Kaiser Franz Josef I. Durch unseren Beistandspakt mit Österreich, waren wir in den Krieg hineingezogen worden, ohne zu bedenken, dass eine Welt nur darauf wartete, Deutschland eins auf den Hut zu geben. Bismarck hatte damals vor einem Zweifrontenkrieg gewarnt, aber auf den alten Mann im Sachsenwald hatte ja niemand gehört.
Das Jahr 1917 sollte ein entscheidendes Jahr für uns Deutsche werden. Amerika trat in den Krieg ein. Noch etwas geschah in dieser Zeit, mit furchtbaren Folgen: Man brachte Lenin und sein Gefolge in einem bewachten Zug nach St. Petersburg, weil man hoffte, damit, den Krieg gegen Russland beenden zu können. Lenins Parole hieß: Alle Macht den Sowjets, den Räten, alles Land den Bauern. In Russland brach die Revolution aus. Der Zar musste abdanken und wurde ermordet. Der Adelsstand sollte vernichtet werden, ebenso alle oppositionellen Kräfte. Ein ungeheures Blutvergießen begann. An der Westfront tobte der Kampf mit unverminderter Härte weiter.
Doch nun wieder zu meiner Familie. Mein Vater war auf Urlaub da und beaufsichtigte meine Schulaufgaben. Er schimpfte über mein Stottern beim Lesen, und ich bekam eine Kopfnuss. „Was hab ich doch für einen Dummbüdel von Jungen“, sagte er. Na, eine Leuchte war ich in der Schule nicht, obwohl mein Lehrer, Herr Drehsten, sich große Mühe mit mir gab. Er war ein guter Lehrer, der es verstand, uns Pflanzen und Blumen nahe zu bringen, wenn wir mit ihm unterwegs waren. Im Sommer liefen wir meist barfuß, auch zur Schule. Man musste ja sparsam mit dem Schuhzeug sein. Dadurch gab es öfter Verletzungen der Füße.
Aus welchen Gründen mein Großvater dann zu uns zog, weiß ich nicht mehr. Vielleicht, weil er in der Nähe seinen Berufskeller hatte, wo er sich immer umzog. Wir haben ihn dort oft besucht, Marie in der Karre und ich nebenher. Wahrscheinlich war das Verhältnis zu der Tochter besser geworden. Jedenfalls lernte ich meinen Großvater als einen lustigen Menschen kennen. Wenn wir mal mit ihm unterwegs in einem Lokal einkehrten und dort stand ein Klavier, dann setzte er sich an das Instrument und spielte viele Lieder, alles ohne Noten. Wenn wir ihn in seiner Klause oben auf dem Dachboden besuchten, spielte er auf dem Schifferklavier viele Kinderlieder. Er hatte ja inzwischen dies Dachzimmer über unserer Wohnung bezogen. Er besaß auch eine Zither, auf der versuchte meine Schwester zu spielen. Oft sang er lustige Reime. So zu Beispiel: „Als alte Jungfer sterben, das muss gar schrecklich sein, das kommt von all den Körben, wohl in der Jugendzeit.“ Oder: „Die Zähne, die hat sie vom Zahnarzt...“ Wenn er bei uns in der Küche war, hüpfte er herum und sang: „Wenn ich einmal sterb, sterb, dann sollen mich zehn Jungfern tragen und die Zither schlagen.“ Wir hatten das Empfinden, wenn Vater nicht da war, fühlte er sich unten bei uns wohl. Wenn Vater auf Urlaub war, blieb er meistens in seinem Stübchen oder kam selten zu uns runter.
Das Verhältnis zu der Großmutter war kühlerer Natur. Meinen Großvater Karl mit dem Barte, den mochte ich gern. Oft hat er mir einen kleinen Wunsch erfüllt.
Dies Kriegsjahr war schlimm, die Blockade wurde schärfer, ebenso der U-Bootkrieg. An der Front im Westen wurde Giftgas eingesetzt. Die Feinde rollten mit den ersten Panzern über die Schützengräben. In der Heimat wurden Anleihen aufgelegt. Ein Spruch ging um: „Gold gab ich für Eisen.“ Es wurde Gold gesammelt und dafür gab es Eisenplaketten. Die Frauen waren längst in die Wirtschaft eingespannt. Mutter hatte eine Stelle zum Austragen von Zeitungen angenommen. Ich marschierte mit ihr zur Gegend um die Rothenbaumchaussee und half beim Austragen. Es war oft ein mühseliges Geschäft, nachmittags unterwegs zu sein und das bei jedem Wetter. Oft musste ich den weiten Weg nach Hause allein traben. Mutter war schon mit der Straßenbahn gefahren. Es regnete und ich dachte mir, was Mutter kann, kann ich auch. Also auf, in die nächste überfüllte Bahn, und das ohne Geld. Wer aber entdeckte mich da? Mutter! Sie flüsterte mir zu: „Du bist wohl nicht zu retten, du Lausebengel.“
An der Ostfront wurde es bald ruhig, denn mit Russland begannen Verhandlungen wegen eines Waffenstillstands. Lenin erlangte die absolute Diktatur über Russland. Am 8.06.1918 verkündete Amerikas Präsident, Wilson, ein 14-Punkteprogramm. Für Deutschland zeichnete sich am Horizont langsam eine Niederlage ab. Österreich brach aus der Waffenbrüderschaft aus und nahm die Waffenstillstandsbedingungen der Alliierten an.
Für uns Kinder wirkte sich die Hungerblockade böse aus. Wir waren alle ziemlich unterernährt. Bei meiner Schwester wirkte sich die Rachitis so aus, dass sie erst sehr spät laufen lernte. Wer war der Leidtragende? Der Bruder musste sie in der Karre spazieren fahren. Manchmal wurde mir das zu dumm. Ich kippte die Karre um, Mariechen lag mit großem Geschrei auf dem Erdboden. Mutter kam in Windeseile angerannt und schimpfte: „Der Bengel ist zu nichts zu gebrauchen.“ Ich aber war frei vom Ausfahren und konnte mit meinen Freunden spielen. Wir hatten etliche Spiele, je nach Jahreszeit. Oft wurde Kriegen gespielt rund um den Häuserblock Knauerstraße – Schrammsweg – Kellinghusenstraße - Goernestraße und zum Anschlagmal wieder zur Knauerstraße. Dann gab es Kreiselspiel und Messersteck. Langeweile kannten wir nicht.
Am 9. November 1918 war Kriegsschluss. Bei uns in der Goernestraße liefen Matrosen herum und schossen. Wir haben uns versteckt, bis der Aufstand vorbei war. Der deutsche Kaiser musste abdanken und ging mit großem Gepäck nach Holland. Wir Kinder sangen damals oft: „O, Tannenbaum, der Kaiser hat in`n Sack gehau’n.“
In Versailles wurden Friedensbedingungen ausgehandelt. Die Franzosen kannten kein Pardon gegen Deutschland, der Hass war groß. In den damaligen Bedingungen (8% von Deutschland wurde abgetrennt, Reparationen in unglaublicher Höhe, Danzig als Freistaat mit einem Korridor durch Polen) lag schon der Keim eines neuen Krieges. Was politisch so um uns herum vorging, war uns schnuppe. Wir hatten unsere Kinderwelt. Wir ärgerten die Uddels (Polizisten) beim Ausmachen der Laternen und waren im Herbst oft an der Planke des Bürgermeisterparks und klauten die Birnen vom Spalier.
In der Schule fiel der Unterricht oft wegen Kohlenmangel aus. Unser Hunger war meist nicht zu stillen. Mutter gab uns dann eine Scheibe Steckrüben, damit unser Betteln aufhörte. Zu der Zeit kümmerte sich ein Judenkomitee um Bedürftige. Eine Dame kam öfter zu uns und brachte Kleidung. Wir bekamen jeden Tag Lebertran.
1919 gab es eine Schulspeisung, die von den Quäkern, einer religiösen Gruppe aus Amerika, durchgeführt wurde. Sie war nur für ganz besonders bedürftige Kinder gedacht. Weil wir angeblich nicht dazu gehörten, standen wir oft an der Tür, wo das Essen ausgegeben wurde, in der Hoffnung auch etwas zu bekommen. Einmal in der Woche gab es Schokoladensuppe und Weißbrot. Wenn wir Glück hatten, durften wir die Milchkannen auskratzen, da war immer noch allerlei drin.
Die Geldentwertung nahm immer mehr zu, es war alles sehr teuer geworden. Vater, der wieder bei seiner Firma angefangen hatte zu arbeiten, musste sich beeilen, wenn er sein Geld bekam, damit sofort etwas dafür gekauft wurde, sonst war es schon wieder wertlos. Ab und zu gab es im Angebot auch Pferdefleisch. Um etwas davon zu ergattern, wurde ich schon morgens um 5 Uhr in Marsch gesetzt. Ich musste mich dann in die Schlange der Wartenden einreihen, hatte Glück, bekam ein Stück Beinfleisch, und wir alle freuten uns. Mutter konnte nun endlich eine Suppe kochen, wo mehr (Fett-) Augen heraus als hinein schauten.
Sonntags ging ich mit meiner Schwester zur Sonntagsschule, die in einem Gartenhaus gehalten wurde. Das Haus gehörte den Guttemplern und steht heute noch. Die Frauen in der Sonntagsschule gaben sich viel Mühe, uns die biblischen Geschichten und die Lieder beizubringen.
An einem Sonntag machten wir mit ihnen einen Ausflug nach Rissen. Immer aber musste ich auf meine Schwester aufpassen, die mir mit ihrem Geplärre oft auf den Keks ging. Ich hatte in diesem Alter um 10 nichts im Sinn mit Mädchen, es hätte sie gar nicht zu geben brauchen.
Im Herbst, wenn der Sturm die Bäume geschüttelt hatte und viele Äste auf der Erde lagen, ging Mutter mit uns und einem leeren Kinderwagen los, um Holz zu sammeln. Das Brennholz war knapp. Wir mussten oft bis zum Borsteler Moor mitmarschieren. Uns gegenüber befand sich die Badeanstalt in der Kellinghusenstraße. Dort wurde Koks angeliefert. Die Wagen wurden scharf bewacht, so dass es nicht möglich war, Koksstücke zu ergattern. Wenn aber die Asche auf die Straße geschüttet wurde, um dort später abgeholt zu werden, waren wir Kinder eifrig dabei, die kleinen unverbrannten Koksstücke heraus zu klauben. Es kam allerlei zusammen, um damit zu heizen, und Mutter freute sich, wir hatten eine warme Stube. Langsam besserte sich die Versorgungslage. Wir konnten öfter Pferdefleisch erstehen.
Die Großen hatten so viel zu erzählen. Als man einmal bei den Kriegserlebnissen ankam, sagte mein Vater zu mir: „Sollte es noch einmal dazu kommen, nimm das Gewehr und haue es ihnen um die Ohren.“ Ja, wer ahnte damals wohl, dass der Rummel in 20 Jahren wieder los gehen würde.
In Europa wütete eine Grippeepidemie, die viele Millionen Menschen dahin raffte. Auch unsere Mutter wurde furchtbar geplagt von dieser Krankheit und wir fürchteten, sie könnte ihr erliegen. Wie froh waren wir, dass sie diese Krankheit überstand.
1919 war in Hamburg der Aufstand der Spartakus-Kommunisten. Bei dem Kampf gegen die Polizei, die für Ordnung sorgen sollte, kamen auch viele Polizisten ums Leben. Wir Kinder erlebten den langen Trauerzug mit den Särgen, an der Kellinghusenstraße. Wir waren schockiert über das Bild, das sich uns dort bot. Diese Toten liegen in Ohlsdorf bei der Blutbuche, als Mahnung an den Blutsonntag.
Ich konnte eine Laufstelle in der Eppendorfer Landstraße ergattern. Es war das Wild- und Geflügelgeschäft von Witthoeft. Morgens musste ich mit einer Karre voller Eisblöcke zu den Kunden fahren. In einem Eimer wurden aus jedem Block kleine Eisstücke geschlagen, die dann in den Haushalten gebraucht wurden, um in dem mit Zink ausgeschlagenen Eisschrank die Speisen zu kühlen. Diese Tätigkeit konnte ich aber nur in den großen Ferien ausführen. Nach dem Eisaustragen, waren dann die bestellten Pakete mit Wild oder Geflügel zu den Kunden zu bringen. Oft bereiteten wir das Geflügel vor zum Einfrieren und fuhren damit zum Kühlhaus in der Kampstraße. War das aber kalt da drinnen, ich war immer froh, wieder draußen zu sein. Auf dieser Laufstelle bin ich gern gewesen. Ich sah, wie die Hühner zurecht gemacht wurden oder wie das verschiedene Wildbret zerkleinert wurde. Oft gab es auch ein gutes Stück mit zum Essen. Ich glaube, der Konfirmandenunterricht machte dieser Stelle später ein Ende.
Ich machte oft einen Besuch in der Bankstraße. Dort hatte mein Großvater in einem Keller seine Klempnerwerkstatt. Manchmal bettelte ich um eine Taschenlampenbatterie, die er mir auch gern gab. Mein Vater war in dieser schlimmen Zeit der Geldentwertung hier bei seinem Vater in Lohn und Brot. Die Großmutter bewohnte mit den meisten Kindern in der Bankstraße eine große Wohnung.
Wenn meine Eltern uns am Sonntag mal los sein wollten, gab es ein paar Groschen, und wir durften zur Kindervorstellung ins Kino. Ein Kino war in der Alsterdorferstraße, ein anderes in der Straße Im Tale. Meistens waren es Indianerfilme, die wir sahen. Während der Vorstellung klimperte ein Mann am Klavier, denn den Tonfilm gab es noch nicht. Abends übte ich fleißig auf der Mundharmonika, bis ich das erste Lied spielen konnte: „An der Saale hellem Strande...“
Ich bastelte einen Kaninchenstall, den bald ein Kaninchen bewohnte. Jetzt musste jeden Tag für Futter gesorgt werden. Was zuerst nur Spaß machte, nun aber in Arbeit ausartete, wurde zur Last. Der Käfig stand auf dem Dachboden und musste ja auch sauber gehalten werden. Das ging dann doch nicht lange gut. Das Tier wurde geschlachtet aber ich konnte kein Stück davon essen.
Dann kam eine Zeit, wo wir Jungen alles mögliche bastelten. Beliebt waren Flugzeuge mit Propeller, die mit einem Gummiband aufgezogen wurden. Unsere Fertigkeit im Bau von Doppeldeckern war erstaunlich. Zwei Unfälle musste ich verzeichnen. Einmal glitt mir beim Schnitzen das Messer aus und fuhr in den Daumen, so tief, dass man die Stelle heute noch sehen kann. Beim Basteln kann man ja allerlei Dinge gebrauchen, so fand ich eines Tages irgendwo eine Patrone. Wahrscheinlich hatte Vater sie als Andenken mitgebracht. Ich wollte sie für mein Flugzeug gebrauchen. An der Patrone befand sich ein Stift, wahrscheinlich der Zünder, wovon ich aber keine Ahnung hatte. Dieser Stift störte mich. Also ging ich zum Hauklotz, der neben dem Herd stand, um das Holz zu zerkleinern. Dort arbeitete ich ja auch sonst mit meinen Schnitzereien. Nun wollte ich hier den Stift aus der Patrone entfernen. Der aber rührte sich nicht. Ich, so blöd wie ich war, nahm das Ding in den Mund und versuchte den Stift mit den Zähnen zu lockern. Auch das ging nicht. So nahm ich die Patrone zwischen die Finger und legte sie auf den Hauklotz und schlug mit dem Hammer darauf. Dann gab es einen lauten Knall und das Ding flog in den Ofen. Ein Schuss in den Ofen! Wiedergefunden hab ich das Ding nicht. Danach kam mir die Erleuchtung, was wäre gewesen, wenn das im Mund passiert wäre, nicht auszudenken. Auch hier musste ich einen Schutzengel gehabt haben.
Vielleicht noch etwas zum Turnunterricht. Ich war kein guter Turner, hing wie ein nasser Sack am Reck, Bockspringen und Barren wurden mit Mühe genommen. Dafür war ich aber draußen beim Schlagballspielen nicht zu schlagen.
Dann kam das Pflichtfach Schwimmen. Erst wurden in der Turnhalle Trockenübungen gemacht, auch zu Hause übte ich die Schwimmbewegungen. Später dann, im Kellinghusenbad war ich einer der Ersten, die sich freischwammen. Unsere Schwimmleidenschaft war groß. Auch nach dem Unterricht wollten wir gern zum Schwimmen. Doch den Groschen, den der Eintritt kostete, hatten wir nicht. Da kam uns eine tolle Idee. Wir stellten uns an die Kasse und wenn dann die Hafenarbeiter kamen, um nach der Arbeit ein Bad zu nehmen, bettelten wir um den Groschen. Meistens mit Erfolg. Wir warteten bis auch der Letzte sein Geld hatte und dann rein ins Vergnügen. Vorher hatte der einarmige Bademeister die Uhrzeit mit Blaustift auf der Badekarte vermerkt, wehe, wir hatten die Badezeit überschritten. Wenn wir dann an seinem Schalter vorbei mussten, bekamen wir etwas mit einer nassen Badehose um die Ohren. Das passierte uns aber nur einmal, später flitzten wir wie die Wiesel an seinem Fenster vorbei.
1923-1924
Dann kam der Tag, da Mutter mit mir zur Andreaskirche in der Bogenstraße ging, um mich bei Pastor Bernitt zum Konfirmandenunterricht anzumelden. Ich habe oft über den weiten Weg von der Knauerstraße zur Bogenstraße gestöhnt. Die Eltern meinten, weil Pastor Bernitt mich getauft hätte, sollte ich auch dort konfirmiert werden.