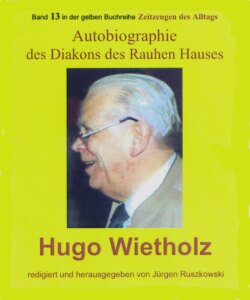Читать книгу Hugo Wietholz – ein Diakon des Rauhen Hauses – Autobiographie - Jürgen Ruszkowski - Страница 5
CVJM Esplanade – Klempner-Lehre – Klempnergeselle
ОглавлениеVorher gab es aber noch ein anderes Ereignis. In unserer Straße lernte ich einen Jungen, Kurt Beisinger, kennen. Wir freundeten uns an und spielten zusammen, bauten hinten in seinem Garten eine Erdhöhle und hatten so unser Vergnügen. Eines Tages erzählte er mir, er sei in einer Jungengruppe in der Esplanade 12, im dortigen CVJM. Da ginge es toll her, Geschichten würden erzählt, Brettspiele gebe es und zum Schluss würde eine Andacht gehalten. Der Leiter, Herr Bock, wäre ein prima Mann. Nun, ich sollte doch einmal mitkommen und mir das ansehen, es wäre ein schönes Haus, sogar mit einer Turnhalle. Ich habe meine Mutter dann bedrängelt, bis ich mit Kurt den weiten Weg in die Innenstadt machen durfte. Das Vereinshaus war ein großes Gebäude, als Eingang eine große Doppeltür mit einem gekachelten Flur, der nach hinten zur Turnhalle und zu einem großen Saal führte. An den Tischen saßen Jungen in unserem Alter und spielten Brettspiele. Außerdem standen in dem Zimmer ein Bücherschrank und ein Klavier. Wir wurden von dem Leiter sehr herzlich begrüßt und konnten erst mal spielen. Später wurden die Spiele eingesammelt, und der Leiter erzählte eine spannende Geschichte, von der wurde für später eine Fortsetzung angekündigt. Zum Schluss wurde eine Andacht gehalten. Das Thema war die Sturmstillung. Noch heute, nach fast 70 Jahren klingt mir das Lied im Ohr: „Mächtig tobt des Sturmes Brausen, um ein kleines Schiff, Jesus kommt, um uns zu erretten, er führt dich nach Haus.“ Ohne zu wissen, was diese Einführung für mein Leben bedeuten sollte, gingen wir beide, Kurt und ich, seit 1923 immer wieder in den Verein.
Schäferhof
Eines Tages gab uns Hans Bock einen Zettel mit einer Einladung zu einem Jungenlager in Schäferhof bei Appen. Natürlich habe ich meine Eltern gelöchert, mir die Teilnahme zu erlauben. Endlich ging Mutter mit zum CVJM, um auch die finanzielle Seite zu klären, wir hatten es ja nicht so dicke. Dann kam der Tag der Abfahrt. Mit einer großen Gruppe ging ich mit meinem kleinen Gepäck zum Dammtorbahnhof. Von dort fuhren wir dann für 14 Tage mit dem Bummelzug nach Pinneberg. An der Kirche sammelten wir uns dort mit anderen Jungengruppen, und dann ging der Marsch auf der Landstraße Richtung Appen-Schäferhof. Hier auf dem Gelände der Arbeiterkolonie hatte der CVJM schon seit Jahren sein Freizeitgelände. Einige Männer wie von Stockhausen, Hermann Geißler und Sechinger hatten diesen Platz gepachtet. Im Wald war ein großes Zeltlager mit tollen Hauszelten. Die waren innen abgeteilt zu Schlafstätten, die mit Stroh gefüllt waren. Etwas höher gab es dann eine Ablage für das Gepäck. Leider war für uns Jüngere dort keinen Platz, vielleicht war das Zeltlager überbelegt, jedenfalls mussten wir in die geräumten Jungtierställe. Dort hatten wir unsere Strohsäcke, und wir schliefen auch hier prima. Abends kam ein Leiter des Lagers, wir sangen ein Abendlied, und er sprach das Nachtgebet.
Morgens wurden Waschschalen mit Pumpenwasser gefüllt und sich gewaschen, puh, war das Wasser kalt. Unser Strohlager wurde aufgeschüttelt, Ordnung musste sein. Dann ging es zur großen Buche. Da waren Tische und Bänke aufgestellt. Am Küchenhaus stand ein langer Tisch, an dem die Lagerleiter saßen, daneben auf Böcken die Töpfe mit Suppe. Meistens gab es Haferflockensuppe und eine große Semmel. Nach dem Tischgebet wurde das Essen ausgegeben.
Aus Kiel und Umgebung hatten wir Realschüler, die schon 14-16 Jahre alt waren. Die schliefen in den Zelten, mussten zeltweise die Nachtwache stellen. Der jeweils Verantwortliche einer Gruppe musste dann einen Wachbericht über die Nacht schreiben. Das wurde oft in Gedichtform geschrieben und nach einer bekannten Melodie gesungen. Hermann Geißler spielte dann dazu auf der Klampfe. Nach dem Essen saßen wir auf einer Wiese hinter dem Wald und hielten eine Bibelarbeit, die für uns sehr verständlich dargebracht wurde. Überhaupt hat uns das Lagerleben viel Spaß gemacht. Wenn es zu heiß war, ging es zum Karpfenteich, dort gab es ein altes Rettungsboot, auf dem wir herumtollten, meistens mehr unter Wasser als darüber.
Wir erlebten viele Überraschungen. Einmal wurden Spaten und Schaufeln ausgegeben, und es ging zu einer nahe gelegenen Sandkuhle. Da war ein sogenannter Burggraben, vor dem Gelände ein Sandturm und in der Mitte des Burggrabens ein Hügel. Dies Gelände hatte den Namen Treuburg. Draußen vor diesem Gelände gab es einen Gedenkstein mit dem Namen seines Gründers, von Stockhausen. Dieser war auch 1912, der Erbauer des Elbtunnels. Leider ist er schon gleich zu Beginn des ersten Weltkriegs gefallen.
Also, unter Beratung unserer Leiter wurde die Treuburg wieder für einen großen Burgenkampf hergerichtet. Der Sandturm wurde mit Grassoden befestigt, die Burg und der Wall neu aufgeschüttet. Auf dem Hügel errichteten wir einen Turm mit Stangen und verkleideten ihn mit Zeltbahnen. Als alles fertig war, sah das Ganze recht imposant aus. Vorher wurde mit Speeren, die ich noch nicht kannte, geübt. Wir waren ca. 150 Jungen im Lager, diese wurden in zwei Abteilungen, mit je einem Heerführer, eingeteilt. Eine Abteilung bekam die Farbe blau, die andere rot. Als wir dann ins Gelände marschierten sangen die einen: „Rot ist die Liebe und blau kriegt die Hiebe.“ Die anderen sangen: „Blau ist die Treue und rot bekommt Bläue.“
Eines Tages wurden wir wieder in zwei Abteilungen, rot und blau eingeteilt. Jede Abteilung nahm am Haus aus der Kammer, wo viele Gerätschaften aufbewahrt wurden, die Speere entgegen, zwei für jeden. Diese Speere waren aus Bambusstangen und hatten an der Spitze ein dickes Polster, damit man sich nicht verletzen konnte. Dann gab es auch noch ein Stück Kreide. Bevor nun der Kampf gegen die andere Abteilung losging, wurde das dicke Ende des Speers mit Kreide eingerieben und dann der Speer gegen den Gegner geschleudert. Wer auf seiner Kleidung einen Kreidefleck hatte, musste aus dem Kampfgetümmel ausscheiden, was der Kämpfer ungern tat. Aber der Schiedsrichter holte ihn heraus und stellte ihn an die Seite. Da machten dann die „Toten“ dann das meiste Geschrei, um ihre Mannschaft zum Sieg anzuspornen. Die Abteilung mit den meisten Überlebenden hatte gewonnen und durfte geschmückt mit Eichenlaub ins Lager einziehen. Dort gab es einen Jubelempfang, und der Sieg wurde noch lange gefeiert.
Beim Essen sang Hermann Geißler oft Lieder zur Laute. Und dann im Chor der Ruf nach Post, die immer mit großem Hallo ausgeteilt wurde.
Ein Höhepunkt des Lagers war der Treuburgkampf. Schon früh am Tag rückten beiden Gruppen aus, die einen als Verteidiger, die anderen als Angreifer. War das eine Aufregung, denn die Angreifer durften sich nicht von den Verteidigern überraschen lassen. Diese waren auf der Hut und hatten im Gelände kleine Trupps im Hinterhalt. Bis wir endlich das Vorwerk genommen hatten, waren schon etliche auf der Strecke geblieben und waren nun Zuschauer. Es war ein hartes Ding, bis wir die Burg geknackt hatten, da mussten noch viele ausscheiden. Selten geschah es, dass die Verteidiger gewannen. Nach dem Kampf zogen wir staubbedeckt zum Karpfenteich, um uns zu säubern. Nach diesem Kampftag konnten wir dann bei schönstem Sonnenschein mit Kaffee und Kuchen Abschied feiern.
Für mich war dieses Schäferhofer-Lager ein großes Erlebnis. Als wir nach den Ferien in der Klasse bei unserem Lehrer Prätorius, den wir sehr schätzten, unsere Ferienerlebnisse zum besten gaben, staunten alle über meinen Bericht, so etwas hatte man noch nicht erlebt. Etwas ist mir von diesem letzten Tag besonders im Gedächtnis geblieben. Als wir vom Dammtorbahnhof zum Vereinshaus marschierten, sah ich auf dem Weg eine Obstkarre. Dort war der Preis für ein Pfund Pflaumen mit 1000 Mark verzeichnet. Ich konnte es nicht fassen, wie konnten nur die Preise so klettern. Im Vereinshaus nahmen wir dann Abschied von den Lagerleitern. Dies war eine der schönsten Erinnerung meiner Kindheit.
Danach kam wieder der Alltagstrott, Schule, Konfirmandenunterricht, leider war der Pastor oft krank.
Es kam nun die Frage, was nach der Schulzeit werden würde. Vater meinte, ich solle doch auch Klempner und Mechaniker werden, denn beim Großvater in der Bankstraße hätte ich mich beim Löten ganz gut angestellt. Damals war mein Vater schon bei einer Firma Schmidt in der Hansastraße, und dort war eine Lehrstelle frei. Vater nahm mich mit zur Vorstellung, und ich wurde angenommen. Jetzt wurde Arbeitszeug gekauft, ein Klempnerkittel und eine blaue lange Hose. Stolz bin ich mit der Büx durch die Straßen marschiert. Wir trugen ja sonst bis zur Schulentlassung kurze Hosen.
Der Konfirmationstag stand fest, es sollte der 23. März 1924 sein. Vorher war in der Turnhalle der Schule die Entlassungsfeier. Die war sehr feierlich, der Chor sang: „Nun zu guter Letzt, geben wir dir jetzt...“ Ansprachen wurden gehalten, Mutter war ganz gerührt. Dann kam der 23. März. Ich zog den Konfirmandenanzug an und musste dazu einen Hut aufsetzen, der mir gar nicht passte. Ich weiß heute noch, wir gingen die Eppendorfer Landstraße bis zur Bogenstraße. Die Pfützen waren gefroren. In der Kirche waren viele Eltern mit ihren Sprösslingen. Als wir zur Einsegnung vor dem Altar knieten, gab Pastor Bernitt mir den Spruch aus dem 73. Psalm: „Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich mit deiner Hand.“ Christus ist Gottes Hand.
Nach der Feier in der Kirche wurde zu Haus mit Freunden tüchtig gefeiert. Mariechen und ich haben uns bald verkrümelt. Diese Zecherei und Skatspielen waren nichts für uns.
1924-1927 – Klempner-Lehrzeit
Bis zum 1. April hatte ich noch Ferien. Dann hieß es: Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Ich musste meine Lehrstelle bei Firma Schmidt antreten. Diese Episode dauerte aber nur 4 Wochen. Vater war mit dem Betrieb nicht einverstanden, denn es stellte sich heraus, der Meister hatte mehr Lehrlinge als Gesellen. So kam es, dass wir uns in der freien Zeit wieder auf Lehrstellensuche machten. Dabei kamen wir in die Eichenstraße. In einem Lampengeschäft entdeckte ich ein Schild: Lehrling gesucht! Vater und ich sind dann am Abend gleich dort aufgekreuzt, und ich habe mich vorgestellt.
Der Meister, Herr Lampe, ein etwas älterer, recht kleiner Herr, machte auf uns einen guten Eindruck. Er erzählte uns einiges über seinen Betrieb. Sein Sohn, der mit im Geschäft arbeitete, sei in der Elektrobranche tätig und so könnte ich neben dem Beruf des Klempners und Mechanikers auch Elektriker lernen. Wir waren mit dem Angebot einverstanden und so wurde der Lehrvertrag geschlossen. Am 1. Mai 1924 konnte ich die Lehrstelle antreten.
Noch heute frage ich mich, warum musste es gerade diese Lehrstelle sein? Der Weg war doch ziemlich weit, aber ich habe unendlich viel gelernt und bin dafür jetzt noch dankbar. Zunächst war ich wohl über die Lage der Werkstatt etwas erstaunt. Sie lag hinten auf dem Hof. Um dorthin zu gelangen, musste man durch den langen Wohnungskorridor. In der Werkstatt roch es immer nach Hühnerdreck, daran musste man sich erst gewöhnen. Die etwas hagere Frau Meisterin hielt im Garten Hühner. Mein Lehrkollege war ein langer Kerl, der schon im dritten Lehrjahr war und mich als den Jüngsten anlernen musste.
Hier bei Meister Lampe wurde ich ordentlich in das Handwerk eingewiesen. Zuerst hieß es, am Sonnabend die Werkstatt aufzuräumen. Aller Dreck von Werkbank und Fußboden musste ordentlich zusammen gefegt und in den Ascheimer befördert werden. Als ich am Montag in die Werkstatt kam, hatte der Meister den Inhalt des Ascheimers ausgeschüttet und alles Metall schön sortiert, hier Zink, dort Messing und Kupfer. Er zeigte auf die verschiedenen Häufchen und sagte nur: „Nicht noch einmal so mit dem Metall umgehen.“ Den Rüffel habe ich gut verdaut, und in Zukunft kam das nicht mehr vor.
Überhaupt war das erste Lehrjahr sehr interessant. Ich wurde von dem Gesellen viel mit auf Kundschaft genommen. Dabei lernte ich Menschen und ihre Wohnungen kennen. Die Firma Lampe war mehr auf solche Reparaturarbeiten eingestellt als auf große Bauten. In der Gegend waren sehr viele Beamte zu Hause, und oft stöhnte der Meister, dass sie sich so viel Zeit beim Bezahlen der Rechnungen ließen.
Mein erstes Lehrlingsgeld betrug 3 Mark in der Woche, die Löhne waren damals niedrig. Später bekam ich als Geselle einen Stundenlohn von 0,82 Reichsmark. Der Meister musste zusätzlich noch Urlaubsmarken kleben. Die Klempnerinnung war die erste, die diese Errungenschaft vor allen anderen Handwerksbetrieben einführte. So konnte der Geselle nach einem Jahr mit diesen Urlaubsmarken, die dann eingelöst wurden, unbeschwert in Urlaub gehen. Für mich war es bis dahin noch ein weiter Weg.
Unser Meister war die Sparsamkeit in Person, ebenso wie seine Frau, die auch selbst die Ladenscheibe putzte. Ihr Wahlspruch hieß: „Arbeit regiert die Welt und der Knüppel den Hund.“ Der Meister muss früh nach Hamburg gekommen sein, durch Fleiß und Sparsamkeit war er zum Besitzer von zwei Wohnhäusern geworden. Eines war das, in dem er in der Eichenstraße 27 wohnte, das andere befand sich in der Fruchtallee 5. Seine Sparsamkeit konnte man auch daran erkennen, dass er seine Lehrlinge mit der Schottschen Karre nach Barmbek schickte, um da bei den Gaswerken ein Fass Teer zu holen. Der Liter kostete 5 Pfennig. In der Eichenstraße wieder angekommen, wurde das Fass auf Brettern durch die Wohnung getrudelt, zum Hof hinaus zu einer Grube. Dort wurde der Teer in Eimer oder Kannen abgefüllt.
Bei einer der ersten Teerarbeiten auf einem Dach in der Eichenstraße, machte ich eine böse Erfahrung. Wir mussten die Teereimer bis zur Dachluke im 5. Stock hinauftragen. Das Pappdach war sehr schräge. Der Meister, der Geselle und ich machten uns fertig zum Dachteeren mit dem Teerbesen. Der Meister zeigte mir, wie der Teer ausgeschrubbt wird. Dabei waren ein paar Tropfen vom Besen auf das Dach gekleckert, ich rutschte darauf aus und stieß den vollen Teereimer um. Bei der großen Schrägung rutschte der Eimer immer schneller auf die Dachkante zu, und keiner konnte ihn aufhalten. Am Ende des Daches kippte der Eimer über die Mansarde und sein Inhalt ergoss sich nach unten. Einige Fenster waren offen, und es hing auch Wäsche draußen. Der Teer verschonte weder Fenster noch Wäsche. Der leere Eimer polterte in den Garten. Nun musste ich mit Petroleum die Fenster wieder reinigen. Eigenartig, mein Meister schalt mich überhaupt nicht aus, er war wohl froh, dass keiner zu Schaden gekommen war. Ich denke, alles andere hat die Versicherung bezahlt.
In der Werkstatt zeigte mir der Meister, wie die vielen Kochtöpfe, die zur Reparatur gebracht wurden, geflickt werden konnten. Es waren Pütt und Pann, manchmal auch ein großer Waschtopf. Die undichte Stelle oder das Loch wurden am Schleifstein gereinigt, ein entsprechend großer Blechflicken wurde dann aufgelötet. Zum Schluss wurde das Gefäß mit Wasser gefüllt, um zu prüfen ob es dicht war. Der Meister hatte mit dieser Arbeit, die ja auch von Lehrlingen gemacht werden konnte, einen guten Nebenverdienst. Es gab viel zu reparieren. Die Badewannen und die Waschbecken waren ja damals aus Zink, dazu kamen die kupfernen Badeöfen, bei denen der Boden oder das Flammrohr durch unsachgemäßes Heizen oft zerfressen waren.
Ich durfte viel lernen. Wenn ein neuer Badeofen gesetzt wurde, musste auch getöpfert werden. Manchmal musste der Steinfußboden oder eine aufgeschlagene Wand wieder vermauert werden.
Mit dem jungen Meister ging es auf Montage, da wurde dann eine Wohnung mit elektrischen Brennstellen versehen. Die meisten Wohnungen in dieser Gegend hatten noch Gas zum Beleuchten. Viele Leute wollten vom Gas loskommen. Es war gefährlich, und die Glühstrümpfe mussten sehr oft erneuert werden. Dazu schickte mich der Meister oft in die Häuser, nachdem der Meister mir das Aufsetzen der Glühstrümpfe beigebracht hatte. Man musste diese Dinger vorsichtig aufsetzen und dann abbrennen, wehe, man berührte den Strumpf, dann zerfiel er.
Ich muss schon sagen, mein Beruf machte mir viel Spaß, wenn ich auch abends müde ins Bett fiel. Mein Vater fragte oft, was den ganzen Tag so los war. Er wollte ja, dass ich auch richtig etwas lernte.
Schwer war es, wenn in einer Wohnung die Zinkbadewanne durch eine emaillierte Gusswanne ersetzt wurde. Einmal mussten wir mit vier Mann so ein Ding mehrere Etagen raufschleppen. In der Badestube musste der Bleiboden, auf dem die neue Wanne stehen sollte, untersucht und ausgebessert werden. Oft musste auch der Dreck von mehreren Jahren beseitigt werden, denn die Hausfrau konnte vorher nie hinter und unter die Wanne kommen.
Mit dem jungen Meister war ich gern unterwegs, um elektrische Leitungen zu legen. Zuerst war ich gespannt, wie wohl der Draht in die Mitte der Zimmerdecke käme. Dort hing ja vorher die Gaslampe, die wurde entfernt und die Gasleitung mit einem Kapphaken verschlossen. Damals hatten wir keine elektrische Bohrmaschine, wir machten die Löcher mit einem Rohrbohrer, der beim Lochschlagen immer gedreht werden musste, sonst könnte auf der anderen Seite ein Stein herausfliegen, dies geschah auch manchmal.
Eines musste man dem jungen Meister lassen, er sah sehr auf Sauberkeit. Beim Schlagen oder Bohren wurde stets eine Schaufel oder ein Karton untergehalten. Wenn etwas vorbei fiel, wurde es sofort aufgefegt, es sollte so wenig Schmutz wie möglich geben. Die Hausfrau war dann auch immer froh darüber. Nachmittags gab es dann oft eine Tasse Kaffee mit einem Keks.
Nun aber kurz die Erklärung, wie der Draht in die Mitte der Decke kam, ohne dass er zu sehen war. Meistens hatten diese Altbauwohnungen in den Stubendecken eine Gipskehle. Vom Korridor wurde ein Loch geschlagen, um in den Hohlraum zu gelangen. Die Gipskehle wurde aufgeschnitten und in der Mitte der Decke ein Loch gebohrt, um in den Blindboden der Decke zu gelangen. Mit einem dünnen Draht wurde nun versucht, von der Mitte bis zu der Gipskehle zu gelangen und dort wurde der Draht mit einem Gegendraht herausgezogen. Daran wurde nun der Leitungsdraht gebunden und zur Mitte gezogen. Nun war die Leitung in der Decke und viele staunten, wie das möglich war. Ich selber wurde zum Gipsen angelernt und konnte später die ausgesägten Gipsstücke so gut wieder einsetzen, dass man die Stelle nicht mehr erkennen konnte.
Lange Zeit war ich begeisterter Strippenzieher, wie man den Elektriker nannte. Mein Vater hat dann dem Meister klargemacht, der Junge soll doch den Klempner- und Mechanikerberuf erlernen. Aber noch war ich von dem Elektrikerberuf wie besessen. Es gab ja so viele Neuigkeiten. Die Kronleuchter, die mit Gas gespeist wurden, mussten auf elektrisch umgearbeitet werden. Dabei mussten Drähte eingezogen und Fassungen montiert werden. Einmal passierte es mir, dass ein Glasarm der Krone entzwei ging. Da war ich aber in Druck. Der Meister sagte: „Sieh mal zu, wie du das wieder in Ordnung bringst.“ So bin ich bis zur Feldbrunnenstraße gelaufen. Dort fand ich einen Glasschleifer, der mir den Schaden in Ordnung brachte. Ich hatte doch einen Bammel gehabt, ich dachte, ich müsste die Glaskrone ersetzen.
Wenn eine Wohnung fertig installiert war, kam der spannende Augenblick, wenn der Beamte von den HEW den Zähler anbrachte und die Lampen angingen. Die Bewohner solcher Wohnung freuten sich riesig über das neue Licht. Auch ich hatte meinen Spaß und dazu das Trinkgeld. Oft war ich um 21 Uhr noch nicht im Haus, und mein Vater erkundigte sich beim Meister, was denn los sei. Der Meister sagte dann, der Junge ist nicht von der Arbeit wegzubringen.
So kam Weihnachten 1924 heran. Es war ein trauriges Fest, denn Vater lag mit einer schweren Lungenentzündung im Bett. Mutter machte sich große Sorgen, denn Vater war aus dem Krieg schon nicht als Gesunder heimgekehrt. Er hatte ein Kehlkopfleiden. Natürlich kam der Arzt mehrere Male. Mutter kochte dann eine kräftige Hühnerbrühe und langsam ging es besser. Wir bekamen dann doch noch unsere Geschenke, Marie ihre Puppe und ich mein Buch: „Quer durch die Wüste Gobi“ von Sven Hedin. Später gab es noch ein Buch: „Mit Stanley durch Afrika“. Ich hatte solche Lektüre sehr gern, die Schilderungen von Land und Leuten fand ich spannend.
Zum Jahresende 1924 musste in der Fachschule ein Probestück abgeliefert werden. Bei mir war es ein Wasserkastenschwimmer aus Zink, der sauber gelötet sein musste. Für gute Arbeit gab es eine besondere Zensur und der Meister bekam ein Lob für gute Lehrlingsbetreuung.
Das Jahr 1925 war für mich besonders inhaltsreich. Meine Zeugnisse waren ganz gut geraten, und die Schulleitung meinte, der Lehrling müsse in eine andere Klasse, wo mehr gefordert würde. Das geschah dann auch. Ganz leicht war es in dieser Klasse zunächst nicht. Es waren da etliche Meistersöhne, die eine andere Schulbildung genossen hatten. Auch war ihre Art oft recht überheblich. Zum Glück fand ich später einen Freund, der auch im Wesen zu mir passte.
In unserem Betrieb in der Eichenstraße war viel los. Die heißen Sommertage wurden zum Dachteeren genutzt. Es gab in der Gegend viele Pappdächer, die nach Jahren immer wieder geteert werden mussten. Wenn das nicht rechtzeitig geschehen war, musste das ganze Dach neu mit Dachpappe gedeckt werden. Dazu wurde eine Klebemasse gebraucht, die auf einem Ofen gekocht wurde. Dabei musste man höllisch aufpassen, damit die Masse nicht überkochte. So langsam gewöhnte ich mich an die Höhenluft, denn man musste schon schwindelfrei sein. Die Dächer hatten nach hinten ausgebaute Mansarden, diese Schrägen mussten auch geteert werden. Nachdem nun feststand, dass ich schwindelfrei war, wurde ich ans Ende der Mansarde geschickt, um diese zu teeren. Dabei stand man in der Dachrinne und wenn die voll Klebemasse war, blieb man mit dem Schuh darin stecken und kam nur mit Mühe wieder frei. Eigentlich gab es eine Vorschrift, dass man diese Arbeit nur angebunden machen sollte, aber darunter litt die Beweglichkeit. Manchmal war es auf dem Dach so heiß, dass wir öfter Pausen einlegen mussten. Ich wurde dann zum Milchhändler geschickt, um mehrere Liter Buttermilch zu holen. Oft hatte man Sehnsucht nach Urlaub, aber während der guten und heißen Tage ging das nicht, nur die Fachschule hatte Sommerpause. Später bekam ich im Herbst mal 3 Tage frei und war darüber schon ganz froh.
Eines Tages, ich hatte schon Feierabend, bekamen wir Besuch. Durch meine viele Arbeit beim Lehrmeister, hatte ich den CVJM ganz vergessen. Nun war der Leiter, Hans Bock, persönlich erschienen, um mich zur Jugendabteilung, die immer Sonntagabend stattfand, einzuladen. Ich war ganz gerührt, dass er den weiten Weg meinetwillen gemacht hatte, um den vergesslichen Jungen zurückzuholen.
Von meinem ehemaligen Freund, Kurt Beisinger, war nichts mehr zu sehen. Der musste seine eigenen Wege gegangen sein. Später hörte ich, er sei bei der Fliegerei gelandet und im Krieg mit dem Flugzeug abgestürzt.
Nun, am Sonntag ging ich dann den Weg zu den Colonaden. Im Heim traf ich eine muntere Schar von jungen Leuten. Es wurde gespielt, erzählt und von Wanderungen berichtet, die schon stattgefunden hatten oder noch geplant wurden. Dann setzten wir uns rund ums Klavier und Hermann Schmidt begleitete die Fahrtenlieder, die wir aus voller Kehle sangen. Zum Schluss wurde uns Gottes Wort ausgelegt und mit in die Woche gegeben. Mir gefielen diese Sonntagsstunden sehr, und ich löste mich langsam von der Klicke aus der Knauerstraße.
Bald fand ich Freunde, die in der Frickestraße in Eppendorf wohnten. Es waren drei Brüder, der Hermann wurde mein besonderer Freund. Wir holten uns am Sonntag gegenseitig ab und marschierten zum CVJM.
Eines Sonntags wurde angekündigt, wir treffen uns am nächsten Sonnabend mit Übernachtungsgepäck, es geht zur Heideburg, einem Heim des Nordbundes. Es sollte eine Nachtwanderung gemacht werden. Am Sonnabend ging es dann mit der Bahn bis Harburg und dann mit der Straßenbahn bis zur „Goldenen Wiege“. Das war die Endstation an den Schwarzen Bergen. Es war schon dunkel geworden, die Gruppe musste dicht beieinander bleiben, damit keiner verloren ging. Hans Bock mit seinen Helfern führte uns plötzlich vom Weg ab, quer durchs Gelände. Wir mussten eine ausgewaschene Sandrinne durchklettern. Auf Händen und Füßen ging es durch dies Hindernis. Nach einer guten Stunde waren wir am Eingang zur Heideburg angelangt. Jetzt musste noch ein Berg genommen werden, denn die Heideburg lag hoch oben. Der Hausvater gab uns den Schlüssel zur Holzbaracke, die seitwärts im Wald lag. Es war ein großer Raum mit Doppelstockbetten. Die Bettsäcke waren mit Stroh gefüllt, zum Zudecken gab es zwei Wolldecken. Nach der anstrengenden Wanderung schliefen wir bald ein. Morgens ging es früh raus, Frühsport im Wald und dann im Waschraum mit kaltem Wasser frisch gemacht. Im Haupthaus wurde dann gefrühstückt. Beim Hausvater konnte man für 15 Pfennige einen Becher Heidetrank erstehen. Der Tag hatte ein volles Programm, Andacht, Waldspiele usw. Nachmittags ging es durch den Wald wieder zur Goldenen Wiege und von dort nach Hause. Zu Hause konnte ich dann meine Erlebnisse spannend erzählen. Es war ja meine erste Nachtwanderung. In der Firma ging der Betrieb abwechslungsreich weiter.
Die Heideburg sollte in meinem Leben noch eine große Rolle spielen. Der CVJM ließ dort verschiedene Tagungen abhalten. Da war einmal eine mit dem Missionsdirektor Freytag. Er machte uns schon damals klar, dass es einmal heißen würde, Afrika den Afrikanern, Asien den Asiaten.
Eines Tages lud mich unser Jugendleiter Hans Bock zur Bibelstunde ein, die jeden Dienstagabend stattfand. Wie dort Gottes Wort erklärt wurde, so hatte ich es noch nicht erlebt. Nach einigen Wochen meinte Hans Bock zu mir: „Komm doch am Sonnabendabend zu einem Gebetskreis.“ In dieser Gemeinschaft erlebte ich dann, ganz ungewollt und doch sehr bewusst, wie mir das Wort Gottes bis in die Seele drang. Glauben heißt ja, im Gewissen überwunden werden, durch Sein Wort, so dass man nicht anders konnte, als den eigenen Willen in Seinen Willen zu legen, im Vertrauen, Gehorsam und in Treue. Das Wort aus dem Psalm 42, V. 2, wo es heißt: „Meine Seele dürstet nach Gott“, wurde mir wichtig und sollte erst später zum Durchbruch kommen.
Es war an einem Sonntag, wir waren schon nachmittags im Vereinslokal, da spielte Hermann Schmidt am Klavier das Lied: „Welch Glück ist es, erlöst zu sein“, als sich in mir plötzlich etwas frei machte und ich mit großer inneren Freude in das Lied einstimmte. Später, es war im September 1926, kaufte ich mir eine Taschenbibel und las darin. Mir wurde mit einem Mal der Römerbrief, der ja oft schwer zu verstehen ist, verständlich und das, was Paulus schrieb konnte ich gut nachvollziehen. Von jetzt an ging es mit dem Verständnis langsam aber stetig voran. Wichtig war aber nun, in der Gemeinschaft zu bleiben, die sich um Sein Wort versammelte. Zu Hause spürte man wohl auch etwas von meiner inneren Umstellung. Vater war neugierig und inspizierte den Inhalt meiner Schublade, in der die Bibel und Schriften vom CVJM lagen. Zu Mutter sagte er nur: „Lass den Jungen mal.“ Vaters Wahlspruch lautete: „Tue recht und scheue niemand.“ Nur hat er sich nie gefragt, wie das eigentlich geht. Denn wie kann man das Recht Gottes tun, wenn man nicht vorher von seinem Unrecht vor Gott erlöst ist. Das Recht, das vor Gott gilt, kann einem nur klar werden, wenn man die Bindung an Jesus Christus erfahren hat. Alles andere ist das sogenannte Recht, das Menschen aufstellen.
In der Gemeinschaft der Gleichgesinnten im CVJM herrschte ein Miteinander, wie ich es noch nie erlebt hatte. Im Glauben ging es langsam voran, es gab auch Schwierigkeiten, aber das Lesen in der Bibel war schon eine Hilfe. Es gab eine Anleitung zur täglichen Morgenwache, für jeden Tag einen bestimmten Text.
Oft machten wir Fahrten durch die Nordheide, nachts schliefen wir beim Bauern im Stroh. In einer Herberge in Schätzendorf erlebten wir beim Singen andere Gruppen. Dort hörte ich zum ersten Mal das Lied: „Wilde Gesellen vom Sturmwind umweht...“ mit dem Refrain: „Uns geht die Sonne nicht unter.“ Eines Tages sagte mir unser Jugendleiter, auf der nächsten Fahrt solle ich die Andacht halten. So etwas hatte ich ja schon oft gehört, doch wenn man selbst vor der Gruppe steht, das ist schon etwas eigenartig.
Der Sonntag kam und es ging über die Holm-Seppenser Mühle, weiter zum Büsenbachtal. Unterwegs wurde Halt gemacht, und nun konnte ich meine vorbereitete Andacht vortragen. Es war bestimmt mit Zittern und Zagen, aber es ging ganz leidlich. Das Wort, das ich ausgesucht hatte, war aus dem Johannesevangelium, Jesus Christus spricht: „Ich lebe und ihr sollt auch leben.“ Das habe ich bis heute nicht vergessen.
Im Büsenbachtal machten wir Rast und tobten herum. Da kam einer auf den Gedanken, den Wimpel von dem Ger, das ist die Stange, an der er befestigt ist, abzulösen. Wir teilten uns in zwei Gruppen und dann wurde das Spiel „Treiben“ durchgeführt. Der Ger wurde geschleudert und von da, wo er die Erde berührte, musste die andere Gruppe den Ger schleudern. Zu Anfang ging das alles prima, bis einer der Jungen versuchte, den Ger aufzufangen und so zugriff, dass er ihm in den Handballen fuhr. Jetzt mussten wir mit ihm auf dem schnellsten Wege zum Arzt in der nächsten Ortschaft. Die Fahrt war durch diesen Unfall schnell zu Ende gekommen. Uns aber war klar geworden, das war eine Riesendummheit.
Bei unseren vielen Wanderfahrten waren wir immer eine große Schar und wenn wir in der Eisenbahn unsere Lieder sangen, gab es bei den Mitreisenden großes Staunen und viel Beifall.
Bei all dem Erleben durfte die Ausbildung nicht zu kurz kommen. Oft war es am Montagmorgen nicht so leicht, richtig in Schwung zu kommen. Die Glieder waren von den Wanderungen oft noch müde.
Die Weihnachtszeit kam heran, es gab viel zu tun. An der Ecke Eichenstraße gab es eine Apotheke. In dem Haus sollten wir beim Ausbau des Dachgeschosses zur Wohnung mitarbeiten. Das Schieferdach musste umgedeckt werden. Hier lernte ich, wie Schiefer eingebunden wird. Auch die Sanitäranlagen wurden neu eingebaut.
Dann kam von der Schule die Aufgabe: En Prüfungsstück musste angefertigt werden und bis zur Weihnachtsausstellung der Innung fertig sein. Der Meister meinte, ich solle eine Kaffeedose aus Weißblech herstellen. Diese Arbeit war gar nicht so einfach. Das Blech durfte keine Falten haben, und die Lötstellen mussten ganz glatt und sauber sein. Es durfte an den Nähten nicht geschabt werden. Die Dose wurde termingerecht fertig, und der Meister meinte, sie sei gut geworden und ich könnte sie abgeben. Wie immer, fand die Ausstellung der Innung mit allen Arbeiten der Lehrlinge und Gesellen statt. Mit meinem Vater besuchte ich die Ausstellung. Es wurden interessante Stücke aus den verschiedenen Lehrjahren gezeigt. Für uns war auch wichtig, zu entscheiden, welcher Art mein Gesellenstück werden sollte. Wir suchten natürlich auch meine jetzige Arbeit. Plötzlich fanden wir meine Kaffeedose, herausragend auf der Fensterbank. Daran steckte ein blauer Zettel mit dem Vermerk „Prämiert“ und die Zeugnisnote „Sehr gut“. Als Preis bekam ich einen Fachkalender. Natürlich war mein Vater stolz auf seinen Sprössling.
Am Sonntag vor unserer Jugendstunde gingen wir mit einer größeren Gruppe durch die Straßen, um andere junge Leute einzuladen, auch zum CVJM zu kommen. Zu diesem Dienst wurden wir eingeteilt, natürlich war das freiwillig. Auf einer Tafel am Eingang unseres Heims stand ein Wort Lord Williams, dem Begründer des CVJM: „Gerettet sein, gibt Rettersinn“. Dieser Lord Williams wurde in England später geadelt. Zuerst hatte es mit einer kleinen Gruppe in einer Gebetsgemeinschaft begonnen. Auch diese jungen Leute sind auf die Straße gegangen und haben eingeladen. Heute ist der CVJM eine weltweite Organisation mit vielen Vereinshäusern. Der Verein will keine Konkurrenz gegen die Kirche sein, doch bei der Amtskirche klaffte eine Lücke, die durch den CVJM ausgefüllt wurde.
Bevor wir jeweils auf die Straße gingen, wurde unser Handeln im Gebet unter die Hand des Herrn gestellt. Zum ersten Mal, mit den Einladungszetteln in der Hand, auf die Straße zu gehen, war schon ein Wagnis. Es war das Jahr 1927. Die Erwerbslosigkeit war schon groß. Viele Gruppen der verschiedensten Parteien trieben ihr Unwesen. Ohne Straßenschlachten ging es schon nicht mehr ab. Wir sprachen trotzdem junge Männer an und etliche folgten unserer Einladung. Im Verein waren verschiedene Berufsgruppen, die ihre Veranstaltungen hatten, so konnte sich jeder aussuchen, wohin er gehen wollte. Immer aber wurde das Evangelium, die frohe Botschaft verkündigt, damit der Mensch heraus kommt aus seinem Todeskreis zu einem Leben mit Jesus Christus.
Es tummelten sich ja draußen viele Weltanschauungsgruppen. Da waren nicht nur die Kommunisten, auch die SPD, die völkischen Gruppen, unter anderen die von Mathilde Ludendorff (am heiligen Quell der Germanen), eine gefährliche Gruppe. Auch die Nazis versuchten, durch diese Gruppe, politischen Boden zu gewinnen.
Bei meiner Arbeit in der Fruchtallee, im Zinshaus meines Meisters, wohnte eine Familie, die dieser Gruppe anhing. Ich versuchte mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Was da gegen die Bibel und Gottes Wort hervorgebracht wurde, war unglaublich. Es war überhaupt nicht an sie heran zu kommen. Man spürte, diese Leute hatten so etwas, wie ein Brett vor dem Kopf. Der Stadtmissionar Dr. Witte rief zu einer Versammlung bei Sagebiel auf, um mit den Ludendorffern zu diskutieren. Der Saal in der Nähe des Gänsemarkts war brechend voll. Auch ich saß auf der Empore und schaute auf die große Versammlung. Pastor Dr. Witte versuchte, ihre Angriffe auf die Bibel zu widerlegen, aber immer wieder kamen Redner von der Gegenseite und brachten Texte aus der Bibel, ganz aus dem Zusammenhang gerissen. Man konnte mit Engelszungen reden, es half nichts, hier war eine Sperre, die man nicht beiseite bringen konnte.
Eigenartig aber war, ich war oft froh, konnte abends in die Stille des Borsteler Waldes flüchten und in meiner Bibel lesen, um die Orientierung nicht zu verlieren. Später habe ich erkannt, wie wichtig es für das innere Wachsen des Glaubens war, denn was war noch alles in der Zukunft verborgen?! Nur einer, der alles in Händen hält, kann uns bewahren. So etwas von Bewahrung erlebte ich mehrere Male.
Im Betrieb hatten wir ein Fahrrad, das für weite Entfernungen zur Kundschaft gebraucht wurde. Eines Tages bekam ich den Auftrag, etwas aus der Innenstadt zu besorgen. So fuhr ich mit dem Rad durch die Bankstraße, geriet mit dem Vorderrad in die Straßenbahnschiene und schlug hart aufs Pflaster. Da die Bankstraße eine Durchfahrtstraße zum Gemüsemarkt war, gab es hier sehr lebhaften Verkehr. Die Leute blieben stehen, als ich das verbeulte Rad aus den Schienen zog. In dem Augenblick kam mein Vater, der damals bei seinem Vater in der Bankstraße arbeitete, die Straße entlang und sah seinen Sohn inmitten einer Menschenansammlung stehen. Zum Glück hatte ich keine nennenswerten Verletzungen, und so war auch mein Vater froh und gab mir einen Wink, schnellstens mit dem ramponierten Rad zu verschwinden. Mein Meister sagte auch nicht viel, auch er war froh, dass es noch so gut abgegangen war. Das Rad wurde dann in unserer Werkstatt repariert.
Mit Fahrrädern hatte ich überhaupt so einiges am Hut. Als ich genug Taschengeld gespart hatte, kaufte ich mir ein gebrauchtes Rad. Daran hatte ich nicht viel Freude, denn es gab dauernd Reparaturen. Einmal hatte der Meister den Gesellen und mich mit einer Karre voll Zement zu seinem Haus in der Fruchtallee geschickt. Mein Altgeselle konnte auch Wände verputzen und ich lernte es von ihm. Wir hatten dort aber auch einiges im Garten zu tun, und dabei entdeckte ich unter der Veranda, ein altes, rostiges Opelrad. Ich fragte den Eigentümer, ob ich es haben dürfte. Nach einer zustimmenden Antwort zog ich glücklich damit nach Hause. Nach einiger Zeit hatte ich es auf Vordermann gebracht. Jetzt konnte ich zur Arbeit radeln, das war doch eine große Erleichterung.
An einem Sonntagmittag kam ich auf den Gedanken, mit dem Rad nach Kiel zu fahren, um dort das Meer zu sehen. Spät kam ich da an, musste aber gleich den Heimweg wieder antreten, damit ich wenigstens bis Mitternacht wieder zu Hause sein würde. Als ich Quickborn erreicht hatte, ging nichts mehr, mein Hintern hatte Hornhaut, nun mussten mal die Füße dran glauben. Kaputt und zerschunden erreichte ich mein Ziel und bin halb tot ins Bett gefallen. Meine Eltern haben nur den Kopf geschüttelt: Was ist das nur für ein verrückter Jung. Der nächste Arbeitstag ist mir recht schwer gefallen, vor Müdigkeit wäre ich fast von der Trittleiter gefallen.
Wenn wir mal einen Auftrag für das Cafe Lehfeld am Schulweg bekamen, freuten wir uns, denn vielleicht fiel ja mal ein Stück Kuchen für uns ab. Groß war die Enttäuschung, als der Chef in der Backstube uns nicht von der Seite wich, so konnte uns kein Geselle etwas zustecken. Einmal wurde uns diese Aufpasserei zu dumm. Als es Mittag wurde, gab mir der Geselle etwas Geld, um in einer naheliegenden Bäckerei einige Brötchen zu holen. Die verzehrten wir nun vor den Augen des alten Geizkragens.
Wie ganz anders war der Chef in einer Schokoladenfabrik. Nach getaner Arbeit, bekam man ein Paket mit Bruchschokolade. Zu dieser Arbeitsstelle bin ich besonders gern gegangen, denn Süßigkeiten hatten es mir schon immer angetan. Wenn es das Taschengeld erlaubte, habe ich mir später sonnabends eine Tafel Schokolade gegönnt.
Nun muss mal wieder die Rede vom CVJM sein. Unsere Eppendorfer Gruppe war sehr stark geworden. So kam der Plan auf, doch in Eppendorf eine Zweigabteilung zu gründen. Bis der Plan aber ausgereift war und sich ein Leiter fand, ging noch viel Wasser die Elbe runter. Für ein Ferienlager in Sarow am Müggelsee wurde geworben, und bald war eine Gruppe zusammen, die am Lager teilnehmen wollte. Es war eine Bibelfreizeit mit vielen anderen jungen Leuten. Nicht viel ist davon bei mir haften geblieben, nur ein neues Erweckungslied, das damals aufkam. Später wurde mit der Gruppe Berlin besucht. Wir fuhren mit einem Doppeldeckerbus und hatten von oben eine herrliche Aussicht. Natürlich wurde das CVJM-Haus in der Wilhelmstraße besucht, in dem der Rittmeister Rothkirch so segensreich gewirkt hatte.
Nach den kurzen Ferientagen gab es im Beruf allerlei zu tun. Jetzt war ich im 3. Lehrjahr, und der Meister konnte mich schon allein zur Kundschaft schicken. Ein neuer Lehrling war eingetreten. Das war ein Windbeutel, der seine Ausbildung nicht ernst nahm, was sich dann nach 4 Jahren zeigte. Wenn ich ihm eine Arbeit in die Hand gab, war die so mies ausgeführt, dass man es noch einmal machen musste. Ich sagte ihm, wenn er sich keine Mühe gebe, könne ich ihn nicht zur Kundschaft mitnehmen.
In der Schule wurde tüchtig auf die Gesellenprüfung hin gearbeitet. Unser Lehrer Meyer hatte immer einen besonderen Ausspruch: „Junge Leute, wir müssen die Prüfungshürde nehmen.“ Für die Prüfung gab es bestimmte Verordnungen. In der Schule wurde die Prüfung über vier Stunden abgehalten. In der Innungswerkstatt mussten dann unter Aufsicht eines Prüfungslehrers aus Abflussrohr und Wasserleitung besondere Sanitärteile hergestellt werden. Die Lötstellen auf dem Bleimaterial mussten besonders sauber gelötet sein. Und dann kam das Gesellenstück, das auch ansprechend sein sollte. Ich entschied mich für einen Dokumentenkasten aus Weißblech. Diese Arbeit durfte in der Werkstatt meines Meisters hergestellt werden. Manchmal werkte ich bis spät in den Abend an diesem Stück. Der Kasten musste ohne Fehler und Kratzer erstehen, damit er vor der Prüfungskommission bestehen konnte. In der Innungswerkstatt wurden meine Sanitärteile aus Blei, ein Abflussbogen mit T-Stück und eine Wasserleitungsabzweigung, gut zensiert.
Dann kam der theoretische Teil der Prüfung. Bevor die Hefte mit den Prüfungsaufgaben verteilt wurden, sagte ein Lehrer: „Jetzt wird sich die Spreu vom Weizen scheiden.“ Nach der Prüfung zeigte sich, dass gerade seine Favoriten, die Meistersöhne, schlecht abgeschnitten hatten. In dieser Klasse war überhaupt nur ein Schüler mit dem ich guten Kontakt hatte, und der war auch der christlichen Botschaft gegenüber nicht ablehnend.
Einmal hatten wir eine Auseinandersetzung mit einem anderen Schüler. Wir gingen zusammen durch die Michaelisstraße. Er wollte nicht einsehen, dass die Welt vergänglich ist und der Mensch mehr braucht, als das, was er sieht. Ich weiß noch heute, dass von mir der Einwand kam: „Und wenn dies alles einmal in Schutt und Asche fällt?“ Ich ahnte nicht, dass es 1943 die Michaelisstraße nicht mehr geben würde, die Bomben sorgten dafür.
Als die Prüfungen abgeschlossen waren und das Gesellenstück bei der Innung hinterlegt war, hörten wir, die Prüfung sei bestanden. Die Auslieferung der Gesellenstücke würde noch vor dem 1. April 1927 geschehen.
Doch für mich kam erst der 15. März 1927. Vater war krank, er wollte aber doch zur Arbeit gehen. Ich sehe ihn noch vor mir, wie er aus dem Bett kam und in der Küche versuchte, seine Arbeitshose anzuziehen, was ihm aber nicht gelang. Mutter machte sich große Sorgen und schickte mich zu unserem Hausarzt Dr. Meyer, der seine Praxis in der Eppendorferlandstraße hatte, er solle schnell kommen.
Von dort ging ich weiter zur Arbeit. Ich bekam den Auftrag, in der Bornstraße das Treppenlicht nachzusehen. Wie ich feststellte, hatte es einen Kurzschluss durch eine Glühbirne gegeben. In der 2. Etage ließ ich mir von einem Nachbarn eine Trittleiter geben und schraubte die Glaskuppel ab. Ich stellte sie fest auf die oberste Sprosse der Leiter und schraubte eine neue Glühbirne ein. Ohne die Glaskuppel berührt zu haben, fiel sie runter und zersprang. Meine Uhr zeigte Punkt 11 Uhr. Ich fegte die Scherben zusammen und fuhr wieder in die Werkstatt.
Dort kam mir die Meisterin entgegen und sagte, es wäre angerufen worden, ich solle schnell nach Hause kommen. Im Haus fand ich Mutter und Schwester in einem aufgelösten Zustand. Vater war tot. Er hatte plötzlich einen Schlaganfall bekommen und hatte sich davon nicht erholt. Als Mutter mir erzählte, dass Vater um 11 Uhr eingeschlafen war, dachte ich an die heruntergefallene Glaskuppel. Auch meine Schwester erlebte, dass unsere Stubenuhr um 11 Uhr stehen geblieben war. Als es Vater am Morgen so schlecht ging, konnte ich ihm noch sagen, dass ich die Gesellenprüfung bestanden hatte. Ob er das noch aufgenommen hat, weiß ich nicht.
Vaters Tod war für unsere Familie besonders tragisch, denn am drauffolgenden Sonntag sollte die Konfirmation meiner Schwester in der Andreaskirche sein. Es wurde eine bedrückende Angelegenheit. Wir waren erleichtert, als am 19.03.1927 die Beerdigung überstanden war. Es war eine große Trauergemeinde in der Kapelle 1 auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Viele Freunde und Arbeitskollegen waren gekommen. Vater hatte ja bei der Firma Oldenburg und Hengstler eine Vorarbeiterstellung innegehabt.
Aber alles, was Mutter an Zuspruch entgegen gebracht wurde, konnte die tiefe Wunde nicht heilen. Sie litt unendlich unter dem Verlust ihres Mannes. Es kam zu einer Gemütskrankheit, die sich noch zu einem dauerhaften Verhängnis für sie entwickeln sollte.
1927-1937, Gesellenzeit
Von meinen ehemaligen Klassenkameraden hörte ich, die Feier zur Ausschreibung zum Gesellen sei schon vorbei, und ich war nicht dabei gewesen. Durch meinen Meister erfuhr ich dann, weil meine Lehrzeit erst am 1. Mai begonnen hatte, bekäme ich den Gesellenbrief auch erst am 1.05.1927. Mein Meister war aber so anständig, mir schon ab April den Gesellenlohn auszuzahlen. Die Löhne waren damals niedrig. Als Junggeselle hatte ich einen Stundenlohn von 87 Pfennigen. Das Schlimmste war, dass die Wirtschaft darniederlag. Man musste auf Kundschaft warten. Die Zahl der Erwerbslosen wurde immer größer.
Im Betrieb hatten wir ein Auftragsbuch, in das wir schauten, den Auftrag erledigten und unseren Namen dann dahinter setzten. Eines Tages stand kein Auftrag mehr in dem Buch. Weil ich der jüngste Geselle war und den Altgesellen nicht verdrängen wollte, bat ich den Meister um meine Entlassung. Über die Antwort vom Meister und seiner Frau war ich sehr erstaunt. Sie sagten: „Nein Hugo, dich entlassen wir nicht, wir haben hinten im Büro noch Aufträge, von denen die anderen nichts wissen.“
Wenn ich dann oft in der Werkstatt wartete, bis ein Auftrag kam, so war mein Wochenlohn nicht groß, aber wir konnten davon leben. Mutter hat versucht, eine Rente zu bekommen. Weil Vater schon mit 41 Jahren gestorben war, hatte er nicht genügend Beiträge für die Rentenversicherung gezahlt und so wurde ihr Antrag abgelehnt. Später bekam sie im Eppendorfer Krankenhaus eine Arbeitsstelle in der Küche. Wegen ihrer angeschlagenen Gesundheit konnte sie dies aber nicht lange durchhalten.
Meine Schwester versuchte, eine Lehrstelle zu bekommen, was aber wegen der schlechten Wirtschaftslage nicht gelang.
Mein Leben war bestimmt vom CVJM. Es wurde nun eine Zweigabteilung in Eppendorf gegründet. Georg Andresen, ein Kaufmann, war bereit, die Leitung zu übernehmen. Wir nahmen Verbindung zum Volksheim Tarpenbekstraße auf. Der dortige Hausmeister konnte uns für sonntags ein großes Zimmer zur Verfügung stellen und außerdem einen Kellerraum für die Jungschararbeit.
Den Kellerraum hatte eine Jugendgruppe von der KPD gestaltet. Er war ganz in blau gehalten und mit einem Sowjetstern an der Decke geschmückt. Also, die Räume waren gemietet. Vom CVJM an der Esplanade bekamen wir Einladungsmaterial, um Jungen und junge Männer auf der Straße einzuladen. Mit unserem neuen Leiter hatten wir abgesprochen, dass mein Freund Hermann Schmidt die Jungschar I leiten sollte und ich die Jungschar II. Also konnte es losgehen. Mit meinen Einladungszetteln zur Jungscharstunde ging ich auf die Straße. Zwei Jungen waren dann ins Volksheim gekommen. Nun, der Anfang war gemacht. Nach dem Spielen, las ich ihnen eine Geschichte vor und zum Schluss noch eine biblische Geschichte. Beim Weggehen bekamen sie mit auf den Weg, doch beim nächsten Mal jeder einen anderen Jungen mitzubringen. Es dauerte nicht lange, so reichte der Raum nicht mehr aus. Auch wurde der Wunsch geäußert, einen eigenen Jungscharwimpel zu haben.
Wir trugen uns mit großen Plänen, die im nächsten Jahr erfüllt werden sollten. In meinem Beruf lief die Arbeit auf Sparflamme. So hatte ich hier für die Jugendarbeit viel Zeit. Abends traf ich oft mit Hermann zusammen, um mit ihm Pläne und auch Probleme zu diskutieren. Wenn wir Geld hatten, gingen wir in Groß-Borstel ins Cafe, saßen da in einer Ecke und tranken eine Tasse Kakao. Wie es so bei jungen Menschen ist, es gab ja so viele Probleme, die gelöst werden mussten.
Meine Mutter war immer erstaunt über meine abendlichen Aktivitäten. In der Woche hatten wir mit den Älteren unsere Bibelstunden und am Sonntagnachmittag unsere Versammlung mit Vorträgen und Berichten von Tagungen und Reisen. Der Verein mit seinen verschiedenen Abteilungen wuchs und blühte.
Dann kam für mich ein Schlag. Hermann traf eine Mädchengruppe in der Breitenfelderstraße und verknallte sich in eins der Mädchen so doll, dass unsere Freundschaft in die Brüche ging. Wie wir hörten, verlobte er sich noch, doch dann platzte diese Verlobung. Für unsere Abteilung war er verloren, er ging seine eigenen Wege. Viel später kam er mal zu uns in der Horner Landstraße zu Besuch. Er hatte geheiratet, aber vom CVJM wollte er nicht mehr viel wissen, warum, das konnte ich nicht herausfinden. Dann habe ich nichts mehr von ihm gehört, bis ich in der Zeitung seine Todesanzeige las.
In meinem Beruf war in der Zeit mit Arbeit nicht viel los. Oft saß ich in der kalten Werkstatt und wartete auf Aufträge. Manchmal waren es in der Woche nur 15 Stunden, die ausbezahlt wurden. Mein Mittagbrot war in der Kälte so gefroren, dass ich die Brotscheiben über der Gasflamme auftaute.
Mutter muss schon gezaubert haben, um mit dem wenigen Geld über die Runden zu kommen. Mit meiner Schwester hatten wir auch Erziehungsschwierigkeiten. Mutter litt unter dem Verlust des Ehemanns, und ich selber hatte meine Probleme und die Aufgabe mit der Jungschar. So konnten wir Mariechen in ihrer Entwicklung nicht verstehen und darum auch nicht helfen.
Der harte Winter 1928/29 ging vorüber. Es waren viele Frostschäden entstanden, verstopfte Abflüsse und eingefrorene Wasserleitungen. Dadurch hatten wir wieder mehr Arbeit und ich brachte mehr Geld nach Hause.
Als Pfingsten kam, rüstete der CVJM Esplanade zu einem Jungmännertreffen in Stuttgart. Eine Gruppe von uns durfte dabei sein. Ich bekam ein paar Tage Urlaub und fuhr mit dem Generalsekretär Stoelzner nach Stuttgart zur großen Tagung. Auf dem Marktplatz war das Treffen der vielen jungen Männer aus ganz Deutschland. In Stuttgart besaß der CVJM ein großes Vereinshaus mit einem Wohnheim für junge Männer. Das Haus hatte sogar ein eigenes Schwimmbad und ein eigenes Kraftwerk. Auf dem Dach des Hauses war in großen Buchstaben die Losung der Tagung zu lesen: „Wir sollen Gott fürchten und lieben.“
Wir Hamburger wurden in Privatquartieren untergebracht. Ich wohnte bei einer Familie Thierfelder in Feuerbach. Es waren sehr liebe Leute, wir verstanden uns prächtig. Zum Abschluss der Tagung, ging es nach Degerloch zu einem Waldcafe mit einer großen Wiese. Hier sprachen dann Männer aus dem Verband des weltweiten CVJM. Ein älterer Herr mit Namen Elsässer rief uns zu: „Junge Männer, nehmt aus unseren Händen die Kreuzesfahne und tragt sie weiter ins deutsche Volk.“ Nach der Schlusskundgebung war eine Schwarzwaldwanderung vorgesehen. So zogen wir dann mit unserem Leiter durch den Schwarzwald und besuchten das Monbachtal mit seiner romantischen Umgebung. In Freudenstadt machten wir Quartier und von dort ging es zur Ruine Hohen-Urach. Zum Abschluss besichtigten wir das Heidelberger Schloss und sahen dort im Keller das große Fass. An der Wand hing ein Kasten, wenn man an dem Griff zog, kam ein Fuchsschwanz herausgeschossen und konnte einen schon erschrecken. Von dieser erlebnisreichen Fahrt sind wir froh nach Hamburg zurückgekehrt und hatten daheim viel zu erzählen.
Der CVJM Eppendorf machte weitere Fortschritte. Oft gingen wir mit einer großen Schar auf Heidefahrt. Es war eigenartig, zu der Zeit hatten wir einen großen Zulauf von Jungen und jungen Männern. Die Jungschar war auf über 50 Jungen angewachsen.
Der Wunsch wurde laut, doch einmal draußen im Zelt zu schlafen. In der Nähe des Flughafens fand ich ein passendes Waldgelände. Dicht dabei war ein Bauernhof, denn wir brauchten Wasser zum Abkochen. Heute hat der Flughafen das ganze Gebiet geschluckt. Die ganze Meute zog also los. Als Zeltmaterial hatten wir Dachpappe mitgenommen. Aus Holzstangen machten wir ein Gerüst, worauf die Dachpappe kam. Die Jungen waren begeistert. Abends lagen wir am Lagerfeuer, und es wurden Geistergeschichten erzählt. Wasser holten wir beim Bauern aus einem Soot, wo das Wasser in einem tiefen Loch gesammelt wurde. Für unsere Verpflegung hatten wir Brote von zu Hause mitgenommen. So kochten wir nur Kaffee. Solche Fahrten haben wir oft unternommen, dann aber nicht mehr mit Dachpappe. Es gab eine Möglichkeit, uns bei Serchinger in der Bachstraße Zeltbahnen zu leihen. Am Montag mussten diese in ordentlichem Zustand wieder zurück gebracht werden, was immer viel Zeit kostete.
Im Herbst starteten wir die erste Herbstfahrt in meinem Leben, später kamen noch viele dazu. Bei Maschen hatte ich ein Heim der Veddeler Gemeinde ausfindig gemacht. Ein Diakon Unverricht war auf diesem Grundstück, Reiherhorst, der Hausvater. Auf dem Gelände stand eine große Baracke mit Waschraum. Dazu gab es ein paar kleine Hütten. Die Küche war in einem festen Bau untergebracht.
Wir waren eine nette Gruppe, die auch äußerlich erkennbar war, durch die grünen Fahrtenhemden mit dem grauen Halstuch. Wir streiften durch die Gegend, einmal nahm uns der Bauer auf seinem Tankwagen mit. Zum Mittag mussten die Jungen Kartoffel schälen und beim Kochen des Essens helfen. Kein Tag verging ohne ein biblisches Wort mit Auslegung. Auch wurde kräftig gesungen.
In der Jugendabteilung ging es auch interessant zu. Für den Sonntag hatten unsere Leiter meistens einen Redner verpflichtet. Einmal war es ein Sachse, der uns mit seinen Geschichten mächtig zum Lachen brachte. Ein anderes Mal berichtete uns ein Vikar Hennig, von seinem Japanaufenthalt. Besonders beeindruckte uns, als er uns erzählte, wie sie den Vulkan Fudschijama auf männliche Weise gelöscht hätten.
Dann kam eines Tages ein Stadtmissionar mit Namen Zeising, der prima aus dem Erzgebirge erzählen konnte. Seine Geschichten hatten Fortsetzungen, und so saß dann wieder einmal der Zeising vor uns und plauderte lustig darauf los. Als er fertig war, sagte er: „Ich bin der Bruder von dem, der vorher hier war.“ Sein Bruder war krank, und er war für ihn eingesprungen. Es waren Zwillinge, und sie glichen sich wie ein Ei dem anderen. Wir hatten nichts gemerkt. Später in der Martinskirche entdeckte ich, dass die Zeisings Diakone des Rauhen Hauses waren und einer von ihnen um 1888 hier Dienst getan hatte.
Jetzt planten wir ein Ferienlager auf dem Schäferhof und der CVJM gab uns einen Zuschuss, damit viele mitkommen könnten. Wir hatten eine schöne Gruppe aus Eppendorf zusammen. Natürlich war es für alle ein großes Erlebnis, nicht nur all die Spiele und das Baden. Man war auch erstaunt über die große Schar, die sich morgens um das Wort Gottes versammelte.
Für die Regentage gab es ein mit Stroh ausgelegtes Tummelzelt. Außerdem hatten wir Glück, einen besonderen Mann vom Reichsverband der Jungmännerwerke zu bekommen. Der Jungschar-Onkel Horch war ein lustiges Haus, der hatte tolle Scherze auf Lager und konnte Geschichten erzählen, so dass die Jungen nicht genug bekommen konnten. Natürlich gab es auch die berühmten Speergefechte und abends am Lagerfeuer Geistergeschichten. Mit meiner Eppendorfer Gruppe gab es noch eine kleine Panne, einige hatten sich daneben benommen, was natürlich wieder ausgebügelt werden musste.
Sonst war es eine erlebnisreiche Zeit. Unsere Jungschar wuchs und wuchs. Wir schafften eine Wanderkluft an, dazu eine Kopfbedeckung. Unsere Gruppe konnte sich schon sehen lassen.
Im Volksheim war unser Bleiben nicht mehr angebracht. So suchte Georg Andresen ein neues Quartier und hatte Glück. Im Lokstedter Weg fand er in der Villa von Fräulein Bertoh eine Unterkunft. Wir konnten uns dort häuslich einrichten. Weil das Haus mit Garten an der Straße lag, musste am Gartenzaun ein Schaukasten angebracht werden. Für den Inhalt, mitsamt Bildern, sorgte ich.
Inzwischen hatte ich mir einen gebrauchten Fotoapparat gekauft, und nun machte ich viele Aufnahmen. Ich bin oft am Flughafen gewesen und habe dort fotografiert. Die Bilder zeigten dort noch Wald und dann die Regulierung der Tarpenbek. Das kostete uns den Zeltplatz, den wir bisher so in der Nähe hatten. Natürlich musste der Flughafen vergrößert werden, denn Hamburg wollte das Kreuz des Nordens für den Flugverkehr werden.
In Deutschland sah es wirtschaftlich mies aus. Die Erwerbslosenzahlen stiegen und stiegen, bald hatte man 6 Millionen erreicht und die Verzweiflung stieg. Man versuchte mit Notverordnungen etwas Ordnung in die Wirtschaft zu bringen, aber dem Reichskanzler Brüning gelang das nicht. Auf den Straßen nahmen die Parteienauseinandersetzungen blutige Formen an. Die Wirtschaft in Deutschland lag danieder, die ehemaligen Feinde verlangten Milliardenbeträge als Kriegsschuld, und so machten sie die Wirtschaft immer mehr kaputt. Es geht aber oft in der Welt so, wo der Sieger meint über den Schwachen zu herrschen, wird er eines Tages die Früchte seines Hasses ernten. Im Deutschen Volk kamen immer mehr radikale Kräfte an die Oberfläche, wer Wind sät, wird Sturm ernten!
Bei uns hier in Eppendorf ging die Jugendarbeit fröhlich weiter. Im nächsten Sommer, wir schrieben das Jahr 1931, gab es auch politische Auseinandersetzungen mit den Jungkommunisten. Sie hatten sich von der Kirche losgesagt. Ihr Wahlspruch hieß: „Wir haben Gott aus den Herzen entfernt, nun erst haben wir lachen und spielen gelernt.“ In der Kegelhofstraße war die Hochburg der Kommunisten. Gegenüber der Tarpenbekstraße, Ecke Lokstedterweg, hatte Ernst Thälmann seine Wohnung. Der Balkon war stets mit kommunistischen Parolen geschmückt.
In diesem Sommer also, nahm ich mir mehrere Tage Urlaub, um als Helfer im Ferienlager Schäferhof mitzumachen. Das waren tolle Tage und Nächte! Mit einem Freund zusammen haben wir das Lager in Atem gehalten.
Wir hatten auch einen jungen Theologen im Lager, der es gut verstand, Gottes Wort zu erklären. Vergessen werde ich nie die Stelle aus dem Korintherbrief, wo Paulus schreibt: „Ihr seid ein Brief Christi.“ Dieser Vikar Halfmann wurde später Bischof in Schleswig Holstein.
Von meiner Arbeit bei Meister Lampe gibt es nicht viel zu berichten. Es wurden nur kleine Aufträge vergeben, die nicht viel einbrachten. Was nötig war, wurde geflickt, sonst hatten die Hauseigentümer kein Geld für große Reparaturen.
Im CVJM war plötzlich eine Änderung für unser Heim eingetreten. Wir mussten das Lokal bei Fräulein Bertoh räumen. Es gelang uns, eine Bleibe im großen Saal auf der Anscharhöhe zu bekommen. Aber das war nicht mehr das, was wir brauchten. Dann kam eine Führungskrise hinzu. Ich musste die Jungschararbeit abgeben, was bei mir zu einem Protest führte, ich blieb dem Verein fern.
Inzwischen lernte ich einen jungen Mann kennen, Heini von Glan. Wir hatten beide unsere Probleme, er wurde mein Freund. Zu Ostern 1932 machten wir uns auf, an die Ostsee, auf den Priwall zu fahren. Dort fanden wir ein Heim, wo wir, trotz schlechtem Wetter unsere weiteren Pläne besprachen. Wir waren beide nicht mehr im CVJM Eppendorf, denn uns gefiel die Art und Weise nicht, wie man mit uns umgegangen war.