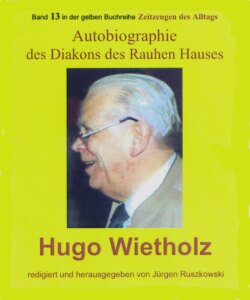Читать книгу Hugo Wietholz – ein Diakon des Rauhen Hauses – Autobiographie - Jürgen Ruszkowski - Страница 8
Die Deutschen Christen und die Bekennende Kirche
ОглавлениеIn der Kirche machte sich eine politische Gruppe mausig, die Deutschen Christen, die auch Handlanger Hitlers wurde. Der hatte ja in seinen Reden immer das Wort von der Vorsehung gebraucht und dann die Fabel vom positiven Christentum. Wie das aussah, bekamen alle zu spüren, die nicht für Hitler waren. Mit Hitlers Gunst wurde ein Reichsbischof gewählt. Jetzt hatten die Deutschen Christen, unter dem „Rei-Bi“ Müller, in der Kirche was zu sagen. Die meisten von ihnen waren dem Hitler verschworen.
Einige Männer mit Rückgrat erkannten, dass der Weg der DC verkehrt war. Sie gründeten unter Niemöller die Bekennende Kirche. Auch bei uns in der Bethlehemkirche habe ich für diese Gemeinschaft geworben. Die Veranstaltungen fanden in der St. Gertrudkirche nahe der Mundsburg bei Pastor Remee statt.
In der Hamburgischen Landeskirche unter Bischof Tügel machten sich die Deutschen Christen mausig und hatten das Ruder an sich gerissen. Jugendpfarrer wurde der Sohn des alten Pastor Wehrmann, der natürlich an der Spitze SA-Mann sein musste.
Wir von der Pfadfinderschaft hatten alle Hände voll zu tun, denn zu uns kamen viele Jungen und wollten bei uns mitmachen, nur nicht in der Hitlerjugend. In den Schulen wurde unsere Pfadfinderflagge gehisst, von der HJ wollte man nichts wissen. Dies alles wurde später natürlich anders. Mit Druck und Rausschmiss wurde viel erreicht.
Dann kam von oben die Anordnung, wer in staatlichem Dienst stehe, dürfe seine Kinder nicht in kirchliche Verbände schicken. Noch aber hatten wir freie Hand und nutzten unsere Freiheit für viele Fahrten.
Die Concordia hatte bei Langenhorn ein Freizeitgelände, wo wir uns oft aufhielten. Eines Tages waren wir wieder draußen und suchten uns Holz für unsere Feuerstelle auf einer nahegelegenen Wiese. Plötzlich tauchte der Bauer auf und pöbelte sehr laut herum. Ich höre noch, wie er der Stadt, Feuer und Schwefel wünschte zu ihrer Vernichtung. Keine 10 Jahre später traf dieser Fluch ein und über 40.000 Menschen mussten ihr Leben lassen. Natürlich haben wir dem Bauern das Holz wieder hingetragen, uns aber war für alle Zeit der Platz, den die Jungen Bundesfarm nannten, vergällt.
Die nächste Pfingstfahrt ging dann an den Schaalsee nach Zarrentin, wo wir wunderschöne Stunden am See erlebten. Auch hier ahnten wir nicht, dass wir hierher erst wieder nach über 55 Jahren fahren durften. Eine andere Fahrt ging nach Bliesdorf an die Ostsee, in der Nähe von Grömitz. Hier war die Concordia schon früher gewesen. Es war eine tolle Stelle am Steilufer. Auf dem Bauernhof in der Nähe, konnten wir unsere Milch kaufen. Bei einem Nachtspiel erlebten wir, wie uns wildgewordene Kühe über die Weide hetzten und wir uns dann auf einen Baum flüchteten. Als wir eine Mittagspause auf dem Bauernhof hielten, kamen einige Jungen auf die Idee, mit einem Futtertrog und einem Holzkübel auf dem Jaucheteich in der Mitte des Hofes zu schippern. Alle anderen der Gruppe sahen vom Ufer aus zu. Ich fürchtete, dass die Sache nicht gut gehen könnte und siehe da, die Dinger kippten um, und man lag in der Jauche. Wir mussten die Bengel erst mal abspritzen und die Klamotten wurden in der Ostsee gewaschen. Die Jungen stanken immer noch 10 Meilen gegen den Wind. Die Hin- und Rückfahrt wurde damals immer mit einem Lastwagen mit Anhänger gemacht. Auf der Ladefläche waren Bänke befestigt und die Seitenwände waren mit Brettern abgesichert. Nur noch kurze Zeit waren diese Fahrzeuge zur Personenbeförderung zugelassen.
Im September bekamen wir eine Einladung vom Rauhen Haus. Dort wurde am 12. September 1933 das 100. Jubiläum gefeiert. Mit einer Hundertschaft nahmen wir mit einem Fackelzug daran teil.
Wenn der Herbst nahte, gingen wir mit einer Meute auf Herbstfahrt. Natürlich wurde unterwegs abgekocht. Der Hordentopf war immer dabei. Eingekauft wurde vorher, meistens leichte Sachen: Reis, Rosinen, Linsen, Pflaumen, dazu eine Schweinebacke, die ein Jungscharler mit Namen Jocki tragen musste. Wir hatten ihm eingeschärft, bei jeder Rast zu melden, dass die Schweinebacke noch da sei. Mittags machten wir Rast auf einem Bauernhof und futterten unser Brot. Plötzlich schrieen die Jungen: „Der Hofhund, der Hund hat die Schweinebacke.“ Der Hund lief mit der Schweinebacke über den Hof. Nun gab es für die Jungen kein Halten. Mit Geschrei ging es hinter dem Hund her, und der ließ aus Angst die Schweinebacke fallen. Von da an hieß unsere Schweinebacke „die mit dem Hundebiss“. Diese Geschichte passierte bei Dersau. Abends landeten wir in der Plöner Gegend auf einem Bauernhof, dort konnten wir im Backhaus abkochen und später im Stroh schlafen. Hier konnten die Jungen auch sehen, wie eine geschlachtete Kuh zerteilt wurde. Das ist für Städter ja nicht gerade alltäglich. Hier hatten wir noch ein aufregendes Erlebnis. Das „Örtchen“ befand sich inmitten eines Jaucheteichs, über einen Steg zu erreichen. Wir waren im Backhaus, als ganz aufgeregt einige Jungen zu uns geeilt kamen. Sie erzählten, einer sei in der Dunkelheit von dem Steg abgerutscht, als er das Örtchen aufsuchen wollte. Wir eilten raus, um zu sehen, was der Unglücksrabe machte. Der war schon aus der Brühe raus, aber er stank fürchterlich. Die Bauersfrau besorgte warmes Wasser, und wir haben den Jaucheheini tüchtig abgespritzt. Sein Zeug wurde gewaschen, doch auch, als es trocken war, stank es immer noch. Dieser Geruch war nachhaltiger als 4711. Solche Abenteuer auf Fahrt sind doch unvergesslich geworden.
Doch nun muss ich mal wieder von meiner Arbeit berichten. Eines hatte der politische Wandel mit sich gebracht, der Arbeitsmarkt wurde langsam lebendig. Es gab wieder mehr Material, manches konnte neu gefertigt werden. Mit der Arbeit ging es langsam aufwärts, die Wirtschaft erholte sich. Dem Hitler war es gelungen, die Großindustriellen auf seine Seite zu ziehen.
In meinem Beruf machte die Arbeit wieder Spaß, denn die Hauswirte ließen mehr arbeiten. Es wurden Dächer neu eingedeckt. Bei so einer Arbeit wäre es durch meine Schuld beinahe zu einem Brand gekommen. Es war Im Gehölz, auf dem Dach kochte der Topf mit der Klebemasse, als der Feuertopf plötzlich umkippte und Klebemasse samt Kohlenglut auf dem Dach lag. Die flüssige Masse fing Feuer und lief die schräge Dachfläche herunter, wie ein glühender Lavastrom. Im Nu brannte die ganze Dachfläche und es gab eine große Rauchwolke, die weithin sichtbar war. Irgendjemand hatte die Feuerwehr alarmiert. Ich behielt die Ruhe und versuchte, mit dem Sand, der immer mit aufs Dach gebracht wurde, die Flammen zu ersticken. Als die Feuerwehrmänner zur Luke herausschauten, hatte ich den Brand gelöscht, und die Männer zogen wieder ab. Es gab noch ein paar Hinweise auf die Vorschriften, sonst nichts. Mein Meister war froh, dass alles noch so gut abgegangen war. Überhaupt muss ich eine gute Hand und Spürnase gehabt haben, denn bei Dachreparaturen hieß es meistens: „Schicken Sie den jungen Gesellen, der kann was.“
Einmal mussten wir in einer Bäckerei die ganze Nacht arbeiten. Im Klo musste der Zementboden aufgeschlagen und die versackte Sielleitung ins rechte Lot gebracht werden. Das konnte nicht am Tag geschehen, weil der Betrieb nicht gestört werden sollte. Am anderen Tag war es mir doch komisch, so ohne Schlaf auskommen zu müssen.
Im Sommer gab es einmal einen Auftrag in der Bornstraße. Dort in der Wohngegend der Juden, mussten wir die Dachrinnen erneuern. Die wurden zunächst in der Werkstatt zu 4-Meter-Stücken zusammen gelötet und dann an Ort und Stelle gebracht. Da es ein sehr heißer Sommer war und man es um 10 Uhr auf dem Schieferdach kaum noch aushalten konnte, verabredete ich mit dem Lehrling, dass wir schon morgens um 4 Uhr anfangen und dann unsere Arbeit vor der großen Hitze beendet haben wollten. So hatten wir ganz früh Feierabend. Der Meister war mit unserer Arbeitszeit einverstanden. Ich durfte mir meine Arbeit oft mit Erlaubnis der Firma so einteilen, wie ich die Zeit brauchte.
Wegen der Jugendarbeit war es nötig geworden, am Donnerstag schon um 17 Uhr frei zu sein. So machte ich an dem Tag keine Mittagspause und konnte früher weggehen.
Bei meiner Meisterin muss ich wohl einen Stein im Brett gehabt haben, sie hatte eine besondere Art, mit mir umzugehen. Einmal brachte sie mir einen Teller mit Roter Grütze in die Werkstatt. Diese Grütze mit Früchten aus ihrem Niendorfer Garten hat mir ganz besonders gut geschmeckt. Ein anderes Mal hatte sie eine Bitte, ich möchte für sie ein Huhn schlachten. Das hatte ich noch nie getan. So wurde mir dann gezeigt, dass ich das Huhn erst mal tüchtig durch die Luft schleudern sollte, damit es besinnungslos sei und dann sollte der Kopf mit dem Beil auf dem Hauklotz abgeschlagen werden. Diese Henkerarbeit musste ich noch mehrere Male tun, bis die Hühner alle in die Pfanne gewandert waren.
Ein neuer Lehrling kam. Er war Jude. Als wir ihn fragten warum er gerade dies Handwerk lernen wollte, antwortete er, dass er später nach Israel auswandern wolle. Er verschwand später heimlich von der Bildfläche, hoffentlich hat er es geschafft, vor Hitlers Judenverfolgung rechtzeitig aus Deutschland herauszukommen.
Man kümmerte sich um die ausländischen Mächte. Mit der neuen Wehrmacht marschierte man ins Ruhrgebiet und hat die Franzosen, die nicht weichen wollten, einfach verdrängt. Ja jetzt ging es also mit der Arbeit voran, Fleischfabriken stellten Konserven mit Fleisch im eigenen Saft her. Wir wurden hellhörig. Ob da nicht etwa Vorrat für einen kommenden Krieg gehortet wurde? Auch die Waffenherstellung begann, und die Autobahnen wurden weiter gebaut, sollten das strategische Mittel beim Vormarsch werden?
Längst hatte Hitler die Hakenkreuzfahne zur nationalen Fahne erhoben und das Horst-Wessel-Lied als ergänzende nationale Hymne zum Deutschlandlied befohlen. Wo waren die nationalen Verbände und die Männer, die gegen Hitler waren? Wer den Mund aufmachte, wurde eingesperrt. Überall gab es 150%ige Nazis, die zu höheren Posten aufsteigen wollten und ihre Mitbürger bespitzelten.
Jetzt wird es wieder Zeit, aus der Jugendarbeit zu erzählen. So langsam machte sich die Hitler-Jugend mausig. Sie wollte Staatsjugend sein und duldete keine kirchlichen Verbände neben sich. Mehrere Male war der Schaukasten am Gemeindehaus eingeschlagen. Wir aber haben immer wieder neue Plakate hineingehängt, zum Ärger der HJ. Immerhin machten wir noch unsere Fahrten.
So langsam wurde es politisch gefährlich. Es wurden Großkundgebungen im Sportpalast in Berlin abgehalten. Hitler und seine Männer mussten sich Gehör verschaffen. Auch die Deutschen Christen melden sich, es sollte eine neue Kirchenverfassung her. Ein Gesetz wurde durchgepaukt: Nichtarier durften nicht mehr Mitglied der Kirchen sein. Und das ließen sich die Bischöfe gefallen, außer Maharens in Würtemberg, Lilje in Hannover und Dibelius in Berlin. Die traten sogar vor Hitler und fordern, er solle seine Hände von der Kirche lassen. Natürlich fand man bei Hitler kein Gehör.
Wir schrieben das Jahr 1935, es wurde ein gefährliches Jahr für uns. Einmal kam der Reichsbischof Müller nach Harburg und sprach in der Stadthalle. Wir fuhren hin: Was für ein Krampf. Er hatte eine Saalwache aus SA-Leuten bestellt und sprach über das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er redete von Gott und dem Volk, das heimkehre und vom Vater-Gott wieder aufgenommen werde. Von Jesus Christus war überhaupt keine Rede. Und dabei ist es doch Jesus Christus, in dem Gott dem Menschen entgegen kommt. Nichts davon bei dem Reichsbischof. In meiner Erinnerung sehe ich diesen Müller nur schweißtriefend auf dem Rednerpult stehen, armer Mann. Nach dem Krieg fand ich in der Zeitung eine kleine Notiz, er habe sich das Leben genommen.
In Hoheluft flatterte mir ein Zettel auf den Tisch, ich solle alle Juden und Halbjuden aus der Jugendarbeit ausweisen. Diesem Befehl von Pastor Clausen, DC-Mann und förderndes Mitglied der SS, konnte ich natürlich nicht folgen. Wenn ich mich nicht für die Bischöfe Müller und Tügel entscheide, müsste ich die Schlüssel für das Gemeindehaus abgeben, die Jugendarbeit würde von Pastor Horn übernommen werden.
Daraufhin haben Herbert Künzel und ich uns mit Luthers Großem Katechismus auf den Weg zu Clausen gemacht. Ich hatte den Schlüssel in der Tasche, aber auch unseren Entschluss, keiner der beiden Bischöfe werde von uns anerkannt. Wir sagten dem Clausen, er solle den Absatz 7 im großen Katechismus einmal lesen, wir beugten uns keinem Diktat, wir gehörten zur Bekennenden Kirche und hofften, ihm, Pastor Clausen, später einmal die Hand geben zu können. Dann zogen wir ab. Noch am selben Tage, holten alle Sippenführer ihre Leute vor dem Gemeindehaus zusammen. Wir erzählten von unserem Entschluss. Wer bei dem neuen Jugendleiter bleiben wolle, solle das gerne tun. Aber was geschah? Alle wollten lieber mit uns ins Abenteuer ziehen, als im Gemeindehaus zu bleiben. Jetzt wurde abgesprochen, wenn wir ein neues Heim gefunden hätten, würde dies durch die Läufer der einzelnen Sippen bekannt gemacht. Nun ging ich auf die Suche und landete im Pfarrhaus der Phillipuskirche in der Bismarckstraße. Dort am Platz gab es einen Konfirmandensaal und ein Kirchenschiff ohne Turm. Mit dem Pastor Jensen kam ich schnell ins Reine. Unsere Concordia durfte im Konfirmandensaal ihre Stunden abhalten. Dies ging eine Zeitlang gut, bis ich eines Nachmittags unsere Leute vor dem Pfarrhaus versammelt antraf. Auf meine Frage, was los sei, hörte ich, dass der Pastor uns nicht mehr in den Saal ließe. Ich hab also nachgefragt und hörte, Pastor Clausen habe angerufen und darauf aufmerksam gemacht, dass ich gegen den Reichsbischof und Tügel sei. Solche Leute seien in der Kirche nicht tragbar und so müssten wir raus. Nun waren wir wieder vogelfrei, und ich lief durch die Straßen, um ein Lokal zu finden. Überall wollte man für die leerstehenden Läden Miete haben, wir aber hatten kein Geld.
Hinter dem Gemeindehaus verlief die Alsenstraße. Dort sah ich auf dem Hof eines Etagenhauses eine Wellblechbaracke, die leer stand. Beim Verwalter fragte ich nach dem Eigentümer und bekam eine Telefonnummer in Rissen. Nach einem längeren Gespräch, in dem ich unsere Lage schilderte, gab der Mann, den ich nie gesehen habe, die Einwilligung, dass wir die Baracke benutzen dürften. Der Verwalter bekam die Anweisung, uns den Schlüssel auszuhändigen. Bei den Jungen war der Jubel natürlich groß. Der Raum musste noch wohnlich hergerichtet werden, auch ein kleiner Kanonenofen wurde beschafft. Die Jungen brachten alles herbei, Hocker und Kohlen für den Ofen. So konnten wir unsere Stunden wieder aufnehmen.
Im Hintergrund versuchte die HJ, uns Schwierigkeiten zu machen. In der Wrangelstraße hatte dieser Verein sein Unterbannbüro. Ein gewisser Hohmann, der sich aufspielte, die einzige deutsche Jugend zu vertreten, verlangte von mir, ich solle mich wegen der Concordia verantworten. Da saßen dann seine Unterführer mit ihm, mir gegenüber und wollten mir klar machen, dass der deutsche Mensch zuerst einmal Nationalsozialist sei. Ich aber entgegnete ihm, durch die Geburt und Gottes Willen sei er Deutscher. Man musste mich ziehen lassen. Unsere Arbeit war nicht illegal. Ich hatte den Leiterausweis vom Jungmännerwerk mit dem silbernen Eichenkreuz. Wenn auch die Kirche nicht ihre Hand über uns hielt, dem Verband, der ja ein kirchlicher war, konnten sie nichts anhaben.
Diesen Hohmann traf ich nach dem Krieg, in einem Gefangenenlager am Rhein, wieder, wo er vor seinem Zelt saß und vergangenen Zeiten nachtrauerte. Zum Gottesdienst, zu dem ich ihn einlud, wollte er nicht kommen. Ja, dass es mal so kommen sollte, damit hatten diese Angeber nicht gerechnet.
Doch zurück zu 1935: Vom Reichsverband der Jungmännerbünde wurde eingeladen, im Sommer ein Bibellager auf Borkum mitzumachen. Mit einer kleinen Gruppe sind wir dann über mehrere Jahre immer zu diesem 14tägigen Lager gefahren.
Wir fuhren mit dem Rad Richtung Emden. Unterwegs konnten wir in Apen in dem Pfarrhaus übernachten. Wir hatten ein herzliches Verhältnis zu Pastor Stöver. Bei der Morgenandacht legte er Texte aus dem Alten Testament so aus, dass das Reich Adolf Hitlers dem Untergang geweiht sei. In Emden sind wir auf die Fähre gestiegen und nach Borkum geschippert. Am Anlegesteg auf Borkum wartete die Inselbahn und brachte uns zur Waterdelle. Dort hatte der CVJM ein Grundstück mit einem Wirtschaftshaus. Ringsum in den Dünen standen die Zelte. Wir hatten berühmte Männer aus dem Werk, die hielten uns die Bibelarbeit. Über 100 junge Männer saßen morgens in den Dünen und lauschten den Worten von Paul le Seur, der es besonders gut verstand, uns das Wort Gottes lebendig auszulegen. Zu bestimmten Zeiten, wegen der Tide, durften wir in der Brandung baden. Ich war der Gruppe der Rettungsschwimmer zugeteilt, denn ich hatte zuvor im Kellinghusenbad die Prüfung zum Rettungsschwimmer abgelegt und dabei die silberne Nadel erworben. Anfangs waren es noch unbeschwerte Stunden. Später musste bei Freizeiten immer erst eine Genehmigung eingeholt werden, denn die Partei wollte wissen, was die evangelische Jugend so trieb.
Inzwischen hatten wir mit unseren Jungen ausgemacht, jeden Morgen treffen wir uns in unserer Baracke zur Morgenandacht, soweit jeder Zeit hatte. Wir waren immer eine kleine Gruppe, die mit Gottes Wort in den Tag ging. Nach einem halben Jahr sah der Kirchenvorstand ein, der Wille der Concorden war nicht zu brechen, und wir durften wieder im Gemeindehaus unsere alten Räume einnehmen. Die Hitlerjugend hatte dabei das Nachsehen.
Zu Pfingsten 1936 wurde vom Reichsverband zu einem Jungmännertreffen nach Danzig eingeladen. Danzig war Freistadt, um dorthin zu kommen, brauchte man einen Pass und musste durch den polnischen Korridor fahren, den die Feinde Deutschlands damals beim Friedensvertrag Polen zugesprochen hatten. Den ersten Pass mit dem polnischen Vermerk und der Quittung über 5 RM habe ich heute noch, wenn er auch jetzt nicht mehr gültig ist. In Danzig haben wir an den Veranstaltungen des Männerwerks teilgenommen, dann aber auch die alte Hansestadt besichtigt, den Artushof, den Dom und den alten Kran. Dabei gab es einen Zusammenstoß mit Führern der HJ, die uns die neuesten Nachrichten um die Ohren schlugen. Es gäbe nur eine Staatsjugend und das sei die Hitlerjugend. Alle anderen Verbände würden aufgelöst werden. So hatten alle Bemühungen, die christliche Jugend zu erhalten, nichts genutzt, es war ja auch nicht anders zu erwarten gewesen.
Jetzt gingen wir harten Zeiten entgegen. Im Heim hatten wir uns Hitlers „Mein Kampf“ vorgenommen. Dieses Machwerk wurde zerpflückt und kritisiert. Das muss wohl auch nach draußen gedrungen sein. Auf Umwegen hörten wir, dass die SA unser Heim stürmen und auseinander nehmen wolle. Also mussten wir auf der Hut sein. Inzwischen begannen die HJ und die SS gegen uns zu hetzen und Lügen zu verbreiten. Wir aber demonstrierten mit Wimpeln und Fahnen in Hamburgs Straßen. Auch durch die Mönckebergstraße ging unser Marsch mit dem Lied: „Es rauscht durch deutsche Wälder...“ Refrain: „Deutsche Jugend heraus!“ Ein Vers lautete: „Erst vom eitlen Wesen und falschem Götzentand, im innersten genesen, sich Herz zu Herzen fand, denn wie in Vätertagen mag für das deutsche Haus, der Freiheit Stunde schlagen: Deutsche Jugend heraus!“ Dieses Lied stand gegen Hitler und seine Meute.
In Hamburg hatte Bischof Tügel für die Eingliederung der Evangelischen Jugend den Pastor Vorrath ernannt. Er hieß bei uns nur Pastor Verrat. Die Kirche ließ sich die Jugend aus der Hand nehmen. Jetzt wurde auch die Überwachung unserer Arbeit von Seiten der HJ immer stärker. Im Hamburger Tageblatt, einem Naziblatt, brachte man unwahre Artikel über die Evangelische Jugend an die Öffentlichkeit. Kurz vor der Eingliederung wurden Flugblätter gedruckt und von Klebekolonnen der HJ und der SS an die Häuserfronten geklebt. Wir überraschten so eine Kolonne, gingen hinterher und rissen die Plakate mit den dicken Lügen wieder ab. Dabei kam es in Eimsbüttel zu Handgreiflichkeiten, wobei mein Schneidezahn ein Stück verlor, was bis heute zu sehen ist.
Dann kam der Sonntagnachmittag, an dem unsere ganze große Gruppe vor dem Gemeindehaus angetreten war. Ich gab vor der versammelten Mannschaft bekannt, was uns erwartete: Die Evangelische Jugend darf nicht mehr in alter Weise auftreten, keine Fahrten machen, auch die Pfadfinderkluft und alle Wimpel und Fahnen seien verboten worden. Man dürfe nur in kirchlichen Räumen christliche Stunden abhalten. Ich habe dann jedem freigestellt, unter diesen Bedingungen bei uns weiter mitzumachen. Für uns galt in dieser Stunde nur eins, die Eingliederung machen wir so nicht mit. Wir sangen nochmals unser Lied: „Deutsche Jugend heraus“, rollten Fahnen und Wimpel ein und traten weg. Wir würden nicht zur HJ übergehen! Wo Eltern meinten, sie müssten ihre Jungen zur Staatsjugend schicken, mochten sie es tun, wir aber stünden gegen diese Art Jugenderziehung.
Am Abend wurden sämtliche Jugendleiter von dem obersten Führer der HJ, Kohlmeyer, ins Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof, eingeladen. In seiner Ansprache wollte er uns vor Augen führen, wie gut doch die Arbeit der Hitlerjugend sei. Unter anderem meinte er, mit den Worten des Alten Fritz, jeder könne ja nach seiner Fasson selig werden. Darauf ging ein ablehnendes Raunen durch den Saal. Nun konnte uns die HJ-Führung den Buckel runterrutschen.
Ein paar Tage später, hatte man mir das Kampfblatt der SS, das „Schwarze Korps“ vor die Bürotür gelegt. In einem Artikel wollte man Pastor Dr. Witte etwas anhängen. Er war früher in Lübeck Diakonissenpastor gewesen, da wäre etwas mit einer Schwester gewesen. So versuchte man auf allen Gebieten, kirchlichen Mitarbeiten etwas anzuhängen, immer mit dem Gedanken, auch wenn das nicht stimmte, etwas werde schon hängen bleiben.
Eines Abends, wir waren in meinem Büro um die Bibel versammelt, klopfte es an der Tür, zwei HJ-Führer mit einer dicken Kordel vor der Brust wollten wissen, was wir so treiben. Natürlich konnten sie an der Bibelstunde teilnehmen. Bald ging man zum Angriff auf Bibel und Kirche über. Natürlich bekamen sie von uns tüchtig Kontra. Dann spielten sie ihren Trumpf aus, wenn das Reich erst ordentlich gefestigt sei, innen wie außen, dann werde es keine Kirchensteuern mehr geben. Wir antworteten darauf, dann würde man sehen, wo die wirklichen Gemeindeglieder sind. Dann wussten sie bald nicht mehr weiter und nahmen die katholische Kirche ins Visier. Ich sagte nur, das sei nicht unser Gebiet. Dann zogen sie bedeppt ab, ob sie klüger geworden waren, wussten wir nicht.
Von nun an, durften wir uns nicht mehr Concordia nennen. Wir legten uns den Namen „Evangelischer Jungendienst Hoheluft“ zu. Es war erstaunlich, wie viele Jungen noch zu uns kamen. Natürlich machten wir jetzt vermehrt Bibelfreizeiten.
Jede dieser Freizeiten musste über das Jugendpfarramt gemeldet werden. Seit einiger Zeit hatten wir ein Kinderheim in Alveslohe als Stützpunkt. Das Haus hatte einen Saal. In der Küche aßen wir mit dem Hausvater Wendt (Sohn Gottfried wurde später Diakon des Rauhen Hauses) und den Kindern unser Mittagessen. Es war immer schön, mit der Kindergemeinschaft und dem Hausvater, der auch die Morgenandacht hielt, zusammen zu sein. An einem Wochenende waren wir wieder draußen in Alveslohe zur Bibelfreizeit, als plötzlich die Saaltür aufgerissen wurde und eine Gruppe von HJ-Führern in den Saal stürmte und unsere Versammlung störte. Natürlich wollte man uns überraschen und feststellen, dass wir keine Bibelarbeit trieben, aber damit hatte man kein Glück, die Bibeln lagen auf dem Tisch. Man brüllte in den Raum, alle HJ-Mitglieder sollten ihre Ausweise zeigen, um zu sehen, ob sie auch berechtigt seien das Koppelschloss zu tragen. Man konnte uns nichts anhaben, und so zogen sie wutschnaubend wieder ab. Geärgert hatte ich mich nur über den Hausvater, er hätte sie wegen Hausfriedensbruch feuern sollen, aber er hatte dazu keinen Mumm.
Wir ließen uns aber nicht verschrecken, sondern fuhren im Sommer weiter ins Bibellager nach Borkum. Auch weiterhin wurden wir in Hoheluft überwacht. Das zeigte sich darin, dass ich eine Vorladung zur Gestapo Stadthausbrücke bekam. Dort sollte ich mich wegen der Jugendarbeit und der Verbreitung unserer Monatsblätter verantworten. In meiner Aktentasche hatte ich mehrere Exemplare dabei. Dem Beamten konnte ich Rede und Antwort stehen. Ich musste meinen Ausweis vom CVJM vorlegen und ebenso die Monatsblätter. Der Beamte hat sich alles aufgeschrieben, um den Bericht weiterzugeben. Wie es weitergehen sollte, habe ich später noch erfahren, denn die Nazis ließen so schnell keinen aus ihren Klauen. Man hatte auch herausgefunden, dass es bei uns in Hoheluft eine Gruppe der Bekennenden Kirche gab.
Natürlich machte sich das Muss zur Staatsjugend bemerkbar. Etliche sprangen ab. Was mich aber besonders wunderte, dass der Werner Landauer, ein Halbjude, eines Tages bei uns in SS-Uniform auftauchte. Von den alten Concorden waren schon damals einige zur SA gegangen. Im Jungendienst waren wir aber immer noch eine Gruppe, die sich sehen lassen konnte. Wir waren eine verschworene Gemeinschaft, die sich treu zur Gemeinde bekannte. Ein Vater eines unserer Jungen, der Maler war, hat uns im Heim einen Vers aus dem Gesangbuch an die Wand gemalt: „Dein Kampf ist unser Sieg, dein Tod ist unser Leben, in deinen Wunden ist die Freiheit uns gegeben.“ Das entsprach ganz unserer Einstellung.
In der Adventszeit 1936 gelang es mir, dass Pastor Dr. Schumacher, der unser persönlicher Freund war, für mich Geld locker machte, damit ich ein Bibelseminar in der Sekretärschule des CVJM in Kassel besuchen konnte. Ich wurde bei meinem Meister von der Arbeit beurlaubt und bekam die Genehmigung am Seminar teilzunehmen. Dafür war ich dem Pastor Dr. Schumacher sehr dankbar. In der Bibelschule gab es einen Kurs über den Korintherbrief, gehalten von Dr. Stange. Oft war nachmittags Sport, denn es gab auch eine Sportschule im Haus. Hero Lüst war für die Verwaltung des Hauses zuständig und hat uns vieles, was zur Jugendarbeit nötig ist, beigebracht. Mein Zimmer teilte ich mit einem Tschechen. Ab und zu wurde auch missionarisch gearbeitet. Ich trug Sonntagsblätter aus, oder wir gingen in ein nahegelegenes Dorf und luden die Jugend zur Sonntagsstunde ein. Eines steht fest, diese 14 Tage haben mir am inwendigen und äußeren Menschen gut getan. Später konnte ich viel von dem brauchen, was ich dort gelernt hatte.
In meinem Beruf durfte ich natürlich nicht schlechter werden. Arbeit war genug da, doch für den Erwerb von Metallen gab es Bezugscheine. Wir konnten uns schon einen Reim darauf machen, Hitler brauchte das Metall für die Rüstung. Weil so schwer Blei zu bekommen war, hatte mein Meister versucht, die angebotenen Plastikrohre zu verkleben, doch wenn der Wasserdruck sich nur wenig änderte, flog alles auseinander.
Eine neue Tätigkeit gab es für mich. Im Sommer mussten die Giebelwände geteert werden, weil sie sonst bei Regen die Feuchtigkeit durchließen. So schwebte ich oft in luftiger Höhe im Fahrstuhl an der Hauswand. Die Arbeit zwischen Himmel und Erde machte mir schon Spaß, nur das Anbringen der Haltetaue war oft schwierig. Wo es ging, wurden die Dachbalken zum Befestigen genommen, aber manchmal waren die Balken nicht in der gewünschten Nähe. Dann mussten Schornsteine her, und die waren nicht immer so standfest, wie man es sich wünschte. Wenn dann alles festgemacht war, wurde mit mehreren Mann die Belastungsprobe vorgenommen. Man stellte sich in den Fahrstuhl und dann wurde tüchtig geruckt. Einer war auf dem Dach und beobachtete, wie sich die Seile verhielten. Es war immer spannend, denn man wollte ja nicht abstürzen, wenn man mal eben in der 5. Etage hing. Oft wurden bei der Pinselei auch die Fenster mit Teer bekleckert. Dann musste ein Lappen mit Petroleum her, und die Fenster wurden gründlich gesäubert.
Nicht nur im Fahrstuhl hing ich in großer Höhe, auch auf den Dächern war ich zu Hause. Oft kam der Ruf: „Hugo, du musst mal wieder auf das Dach der Christuskirche.“ Es hatten sich etliche Schiefer aus der Befestigung gelöst, die mussten wieder eingebunden werden. Also ging es dem Dach mit besonders langen Schieferleitern zu Leibe. Die mussten wir erst durch kleine Erkerfenster ziehen, dann wurden sie auf dem Schieferdach in Dachhaken gehängt, und erst dann konnte die Reparatur beginnen. Beim Bombenangriff wurde diese Kirche auch getroffen und bekam später ein Pfannendach. Noch heute kann man sehen, wie hoch das alte Dach gewesen ist, an der Turmwand sieht man die alte Markierung. Überhaupt hatten wir dort an den drei Pastoraten viel zu tun. Oft waren wir in dem ersten Pastorat an der Fruchtallee. Dort wohnte Pastor Mummsen mit Frau und vielen Kindern. Bei einer Arbeit erlebte ich etwas Unvergessliches. Der Pastor kam nach Haus und rief im Treppenhaus: „Miezi bist du da?“ Von oben kam die Stimme seiner Frau: „Ja, Putzi ich bin hier.“ Wir haben uns über diese Begrüßung köstlich amüsiert. Noch heute brauche ich bei Lisa mal diese Anrede.
Noch etwas aus der Arbeitswelt, was nicht verschwiegen werden soll und sich ja später in einer anderen Gemeinde wiederholen sollte. Vor Weihnachten mussten immer zwei große Christbäume mit elektrischen Kerzen bestückt werden. Ich turnte dann mit einer langen Leiter um die Bäume herum, um sie mit den Kerzenketten zu behängen. Wenn dann alle Kerzen brannten, hatte ich ein stolzes Gefühl des Erfolges.
Eines steht fest, mein Beruf war sehr abwechslungsreich, manches habe ich auf diesen Kundschaftsfahrten erlebt, manches Gespräch geführt und dabei viele Menschen kennen gelernt.
Wie gesagt, unsere Jugendarbeit war trotz der Eingliederungsversuche nicht kaputt zu machen. Wir bekamen oft ältere Jungen, die bei uns mitmachen wollten. Unter anderen drei Brüder Schmidt, deren Mutter später sogar zu unserer Trauung in die Martinskirche kam. Dann war da Helmut Wittmaak, den wir „Langes Hemd“ nannten, der nach mir auch ins Rauhe Haus ging. Und Rudolf Wentorf, der Kirchenmusiker werden wollte und bei uns den Spitznamen „Halbe Note“ bekam. Viel später, so nach 40 Jahren trafen wir uns wieder, da war er Pastor in Seedorf am Schaalsee.
Da das 40ste Jahresfest der Concordia bevorstand, wurde zeitig ein Festprogramm aufgestellt und ein Laienspiel einstudiert. Aus dem Nordbund des CVJM hatte ich Pastor Forck, der auch Pastor in Hamm war, als Festredner gewinnen können. Wir waren mächtig dabei, damit das Fest gut gelingen sollte. Eine Bühne im Saal wurde erstellt, und zum ersten Mal hing die Fahne mit dem Kreuz auf der Weltkugel im Saal. Später wurde dieses Symbol das Zeichen der gesamten Evangelischen Jugend Deutschlands. Wir hatten die Werbetrommel tüchtig gerührt, auch die alten Concorden wurden eingeladen.
Der Abend war gut besucht und alles klappte vorzüglich. Erst am Schluss gab es in der Garderobe eine Auseinandersetzung mit einigen alten Concorden, die in SA-Uniform gekommen waren. Man warf uns vor, wir hätten die Concordia verraten, und es wären staatspolitische Dinge zum Vorschein gekommen, die sich gegen den Staat richteten. Bei ihrem Abgang hieß es, wir würden noch so einiges erleben.
Später, als ich mit Pastor Forck in der Martinskirche zusammenarbeitete, erzählte er mir, auf Grund dieses Jahresfestes und seines Vortrags, sei er zur Gestapo befohlen worden. Mit den Concorden, die heute noch leben, sind wir stolz, dass wir damals solche Feier haben durften. Wir sangen damals das Lied: „Wach auf, wach auf du deutsches Land...“
Im Tausendjährigen Reich wurde man immer kühner, das Rheinland war jetzt frei, nun kam die Tschechoslowakei dran, dann Österreich, und danach begann die Judenverfolgung ganz massiv. Als im Eppendorfer Weg bei einigen Juden, die Geschäfte zertrümmert wurden und die Synagogen brannten, wurden wir hellwach. Hatte nicht Hitler schon in „Mein Kampf“ allerlei Drohungen ausgestoßen. Jetzt hieß es: „Juden raus zum Arbeitseinsatz“. Wie man aber mit den Juden in den KZs umgegangen war, das kam für uns erst bei der Besetzung durch die Amerikaner heraus. Wohl ahnten viele von dem wüsten Treiben der SS etwas, aber das schreckliche Vernichten in den Gaskammern, wurde uns erst zu spät bekannt.
In Hamburg ging die Arbeit ihren gewohnten Gang. Wir schlugen uns recht und schlecht durch und merkten immer mehr, wo die sogenannte Reichspolitik hintrieb. Es roch nach Kriegsvorbereitung. Bischof Lilje und Niemöller hatte man verhaftet und die Deutschen Christen machten sich in der Kirche mausig.
Im Sommer waren wir wieder auf Borkum und erleben schöne Tage. Wir hatten viel inneren Gewinn. In der Freizeit sahen wir uns auch mal auf der Insel um. Borkum entwickelte sich langsam zu einem großen Seebad. Es gab aber auch noch die kleinen Häuser, deren Gärten mit großen Walknochen eingezäunt waren. Hier konnte man sehen, dass die Borkumer früher Walfänger waren, mancher Reichtum zeugt von dem damaligen Erfolg. Wir haben auch mal einen tüchtigen Sturm erlebt, an der Kurpromenade spritzte die Gischt haushoch. Die Nordseite der Insel muss jedes Jahr neu befestigt werden, denn das Meer frisst immer wieder an einigen Stellen. Früher konnte man die Nordseite nicht richtig befestigen und so hat der blanke Hans immer große Teile weggespült und manches Dorf versank.
Unsere Lagerleitung holte manchmal einen bekannten Borkumer Seemann zum Erzählen. Dabei wurde auch Seemannsgarn gesponnen, aber auch manche wahre Begebenheit kam zur Sprache. Wenn ein Schiff auf dem gefährlichen Borkumriff gestrandet war, waren die Borkumer als Strandräuber schnell zur Stelle, ehe der Strandvogt kam, um das angeschwemmte Strandgut zu beschlagnahmen. Wenn eine Zeitlang kein Schiff gestrandet war, war am Strand ein falsches Signalfeuer entzündet worden, um mal wieder Beute machen zu können. Wir waren von diesen Erzählungen des alten Seebären sehr angetan.
Eines Tages wurde mir im Lager gesagt, aus Hamburg käme ein Pastor Wegeleben vom Rauhen Haus. Er sollte mit dem Flugzeug kommen, ob ich ihn wohl abholen würde. Also hin zum Inselflugplatz, gerade war die alte JU gelandet, und der Pastor entstieg dem Flugzeug. Wir machten uns bekannt und gingen zum Lager, wo Pastor Wegeleben später vor der Lagergemeinschaft einen Vortrag über das Rauhe Haus hielt. Er berichtete über die Ausbildung von jungen Männern für den Diakonenberuf in der Kirche. Von den Ausführungen des Redners und dem Prospekt über die Diakonenanstalt war ich ganz angetan, und später kam dann der Entschluss, mich im Büro des Rauhen Hauses zu melden.
Ich schrieb einen Lebenslauf für die Anmeldung im Rauhen Haus und hatte ein Gespräch mit Tilman Frieß, über die beruflichen Möglichkeiten eines Diakons. Er meinte, ich könne auch Beamter werden. Ich aber wollte eine Ausbildung als Gemeindediakon machen und nicht zum Beamten. Ich bat gleichzeitig auch noch um etwas Zeit, um die Arbeit in der Concordia zunächst weiter zu machen. Von 1938 bis 1939 gelang es noch – später musste einer der anderen Concorden ran.
Wir feierten 1938 das Kirchweihfest der Bethlehemskirche mit. Mutter bekam eine Arbeit im Eppendorfer Krankenhaus. Sie war natürlich mit meinem Eintritt ins Rauhe Haus nicht einverstanden. Aber der 31. März 1938 war der Tag, ab dem es kein Zurück mehr gab. Bei Klempnermeister Lampe, Eichenstraße 27, schien mein Schritt kein Unbehagen auszulösen. Ersatz war da. Eine liebe Kundin aus der Alardusstraße wünschte mir Gottes Segen. Meine letzte Arbeit im März hatte ich im Pinneberger Weg. Ich musste eine neue Dachrinne anbringen.