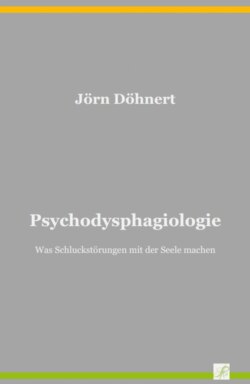Читать книгу Psychodysphagiologie - Jörn Döhnert - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Was bedeutet „Dysphagie“?
Оглавление1. Das Schlucken
Jeder Mensch schluckt täglich mehrere Hundert bis Tausend Male. Die wenigsten Menschen müssen darüber nachdenken – es passiert einfach. Grund dafür ist die Tatsache, dass ein Großteil des Schluckens reflektorisch abläuft. Dies bedeutet, dass in unserem Körper ein bestimmter Reflex ausgelöst wird, der eine bestimmte Aktion zur Folge hat. In diesem Fall das Schlucken – wir sprechen vom Schluckreflex. Dieser bezeichnet aber nur einen Teil des komplexen Vorgangs, der in unserem Kontext unter Schlucken verstanden wird – aus diesem Grund wird auch meist nicht „nur“ von Schlucken, sondern vom Schluckakt gesprochen. Dies weist schon darauf hin, dass es sich um einen größeren, komplexeren Vorgang handelt – einen „Akt“, nicht nur eine „Szene“. Der Schluckakt ist in einzelne Szenen bzw. Phasen unterteilt, die wir nun im Einzelnen betrachten.
Stellen Sie sich zunächst noch ein sehr leckeres Essen vor – und beobachten Sie jetzt, was mit und in ihrem Körper geschieht:
Wahrscheinlich sammeln Sie Speichel im Mund.
Vielleicht bewegt sich die Zunge etwas.
Vielleicht auch der Unterkiefer.
Sie müssen schlucken …
Die orale Phase
In einigen Schriften wird die orale Phase des Schluckaktes weitergehend in zwei Phasen unterteilt: die orale Vorbereitungsphase und die orale Phase. Wir fassen die beiden zusammen, weil sie sich beide im Mund (oral) abspielen.
Als Sie sich gerade vorstellten, zu essen, haben sich drei der vier von mir aufgezählten Reaktionen im Mundbereich abgespielt: die Speichelsammlung und die Bewegungen von Zunge und Kiefer. Dies sind wichtige Aspekte der oralen Phase des Schluckaktes:
Wir bekommen Nahrung in den Mund, im Idealfall nehmen wir sie sogar freiwillig auf. In der Regel befindet sich das Nahrungsstück in diesem Moment nicht in einer solchen Form, dass wir es direkt schlucken möchten – weil es zu groß oder zu „unförmig“ ist. Diese beiden Probleme können wir beheben, indem wir die Nahrung durch Kauen zerkleinern und durch die Zugabe von Speichel geschmeidig machen. Beim Kauen bewegt sich der Unterkiefer seitlich ungefähr kreisförmig, sodass die Nahrung zwischen den Zahnreihen zerdrückt und gemahlen wird. Der Speichelfluss wird durch unterschiedliche Faktoren angeregt: durch die reine Vorstellung des Geschmackes, durch den Geruch der Nahrung, durch den tatsächlichen Geschmack und rein mechanisch durch die Bewegung des Unterkiefers. (Auch dies können Sie ausprobieren: Bewegen Sie den Kiefer einfach auf und ab und Sie merken, wie der Speichel in Ihrem Mund immer mehr wird.)
Während des Kauens bleibt die Nahrung nicht an einem Ort des Mundes, da wir sie durch die seitlichen Bewegungen des Kiefers ständig bewegen. Damit die Nahrung aber weiter zerkleinert werden kann, muss sie zwischen den Zähnen bleiben. Hier helfen die Muskeln des Mundraumes aus: Die Wangen und Lippen sorgen dafür, dass die Nahrung nicht aus dem Mund fällt und auch nicht in den Wangentaschen gesammelt wird, die Zunge sorgt dafür, dass die Nahrung nicht im Innenraum gesammelt wird und zu groß zum Schlucken bleibt.
So wird durch konstante Bewegung und konstantes Hinzufügen von Speichel ein sogenannter Bolus geformt. Hierbei handelt es sich um ein meist ungefähr kugelförmiges Gemisch aus Nahrung und Speichel, das vom Körper als „schluckbar“ erkannt wird. Ist dieser Bolus geformt, wird er auf die Zunge gelegt, die ihn dann nach hinten in Richtung Rachen transportiert.
In der Regel schafft es unser Körper, aus jeder aufgenommenen Nahrung einen Bolus herzustellen, den wir als so angenehm empfinden, dass wir ihn schlucken können. Die letzte „Entscheidung“ hierzu findet in der nächsten Phase des Schluckaktes statt:
Die pharyngeale Phase
Auch diese Phase ist nach dem Ort, in der sie stattfindet, benannt: dem Rachen, griechisch „Pharynx, “. Ab hier, so könnte man meinen, beginnt das eigentlich Schlucken – oder auch nicht. Wie erwähnt, kommt es zunächst zu der Entscheidung, ob der Bolus geschluckt wird oder nicht. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab:
Hat der Bolus tatsächliche eine angenehme Form?
Ist der Bolus tatsächlich klein genug?
Schmeckt mir die Nahrung wirklich?
Ist die Nahrung womöglich giftig?
Hierbei spielen sensorische Fähigkeiten eine Rolle, die sich sowohl um äußere (Größe und Form) als auch um innere Definitionen der Nahrung (Geschmack, Verträglichkeit) kümmern müssen. Der Körper muss fühlen und schmecken, ob er den Bolus schlucken kann und darf. Er tut dies, indem er zunächst die Zunge befragt: Ihre Geschmacksknospen werden mitteilen, ob die Nahrung verträglich ist, ihre Fähigkeit, Formen zu ertasten, teilt mit, ob der Bolus wirklich angenehm geformt ist.
Sie merken schon: Die Zunge soll mehrmals den Bolus kontrollieren. Bereits vorher hat es den Anschein, als habe sie das „Ok“ gegeben, die Nahrung zu schlucken, warum soll sie dies jetzt also nochmals überprüfen? Der Grund ist, dass der Körper dem Verstand nicht vertraut. Während die orale Phase noch bewusst abgelaufen ist (wir können die Phase selbst steuern: beginnen, unterbrechen und abbrechen) kommen nun die Reflexe, also die unbewussten Vorgänge des Schluckaktes ins Spiel. Die bewusste Entscheidung, dass wir einen Bolus schlucken wollen, kann an dieser Stelle unbewusst revidiert werden. Wenn wir z.B. aus Zeitmangel beim Essen hetzen und zu große Stücke schlucken wollen, wehrt sich unser Körper dagegen. Sind wir gesund, werden wir ihn zwar meist dazu bringen, diese Stücke trotzdem zu schlucken, es findet aber unter sehr großer Anstrengung statt.
Lassen wir unseren Körper agieren, wie er will (was meist bedeutet: wie es für ihn am besten ist), entscheidet er mithilfe der Zunge und des im Rachen angebrachten Zäpfchens (als „letztem Wächter“), ob ein Bolus geschluckt wird oder nicht. Je nach Entscheidung werden der Schluck- oder der Würgereflex in Gang gesetzt. Wird der Würgereflex aktiviert, kommt der Bolus erneut in den Mundbereich, sodass wir unser Vorgehen überdenken und verbessern können. Sobald der Schluckakt aktiviert wird, können wir den Vorgang nicht mehr bewusst steuern.
Wo genau die beiden Reflexe ausgelöst werden, ist bei jedem Menschen verschieden. Während manche Menschen schon spätestens beim Putzen der hinteren Zähne Probleme haben, nicht zu würgen, können Schwertschlucker beide Reflexe komplett unterdrücken.
Nach Aktivierung des Schluckreflexes findet einer der, wenn nicht sogar der komplexeste Vorgang im menschlichen Körper statt. Viele verschiedene Muskeln arbeiten zusammen, um die Nahrung sicher in die Speiseröhre zu befördern und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Atemwege vor der Nahrung geschützt sind. Was ist hierzu alles nötig?
Zunächst muss die Nahrung in Richtung der Speiseröhre bewegt werden. Damit sind die Zunge, das Gaumensegel und die Rachenhinterwand beschäftigt: Während die Zunge die Nahrung immer weiter nach hinten schiebt, hebt sich das Gaumensegel, sodass der Durchgang in den Nasenraum verschlossen wird. So gelangt die Nahrung immer weiter in den Rachenraum. Hier schiebt sich nun die Rachenhinterwand nach vorne. Während die Zunge sich weiter nach hinten schiebt, treffen sich die beiden über der Nahrung, um sie gemeinsam nach unten (also in Richtung der Speiseröhre) zu schieben.
Von vorne betrachtet liegt die Speiseröhre direkt hinter der Luftröhre. Da für den Körper über den Tag betrachtet das Atmen die vorrangige Aktivität ist, ist in der Regel die Luftröhre geöffnet, während die Speiseröhre nur zum Schlucken geöffnet wird. Dieser Vorgang ist Aufgabe des Kehlkopfes. Da dieser aber relativ fremdbestimmt ist, ist es genau genommen die Aufgabe der gesamten Halsmuskulatur: angefangen von der Kiefer- und Zungenmuskulatur bis hinunter zur Muskulatur, die am Brust-, Schlüssel- und/oder Schulterbein ansetzt. Alle zusammen halten den Kehlkopf in seiner Position oder bewegen ihn. Beim Schluckvorgang wird der Kehlkopf nach vorne und oben bewegt. Diese Bewegung wird durch das Zungenbein ermöglicht, das – ebenso nur von Muskeln in der Position gehalten – für eine Änderung der Zugrichtung der Muskulatur sorgt.
Die beiden Bewegungsrichtungen haben folgende Wirkung: Bewegt sich der Kehlkopf nach oben, schiebt er sich gegen den Kehldeckel, der ihn somit verschließt. Der Kehlkopf ist dicht und damit die Luftröhre gesichert. Die Bewegung nach vorne öffnet die Speiseröhre. Der obere Schließmuskel der Speiseröhre (oberer Ösophagussphinkter) wird gleichzeitig entspannt, wodurch die Öffnung überhaupt erst möglich wird.
Durch diesen komplexen Bewegungsablauf, der innerhalb von Sekundenbruchteilen abläuft, kann die Nahrung in die Speiseröhre gelangen. Hier beginnt die letzte Phase des Schluckaktes:
Die ösophageale Phase
Die Speiseröhre (griechisch „Ösophagus, “) besteht aus Ringmuskeln. Diese werden in peristaltischen Wellen bewegt, sodass die Nahrung in den Magen geschoben wird.
Auch dieser Vorgang entzieht sich unserem Bewusstsein und läuft automatisch ab. In der Regel spüren wir auch sehr wenig davon. Lediglich an zwei besonderen Engstellen können wir spüren, wo sich die Nahrung befindet (v.a. wenn der Bolus doch einmal zu groß geraten ist): an der Stelle, wo der Aortenbogen die Speiseröhre kreuzt, und beim Eintritt der Speiseröhre in den Bauchraum, wo sie das Zwerchfell durchqueren muss. Ansonsten verläuft der Nahrungstransport meist relativ unbemerkt von unserem Bewusstsein.
Ist die Nahrung durch diese drei Phasen hindurch im Magen gelandet, war der Schluckakt erfolgreich.
2. Die Störung
Der Begriff Störung ist relativ, jeder versteht darunter etwas anderes. Während der eine von einer Verkehrsstörung erst bei 20km Stau spricht, meint der nächste schon die Ampel, die „immer auf Rot“ steht. Gemeinsam ist beiden Ansichten, dass im Straßenverkehr etwas nicht so funktioniert, wie es ideal wäre.
So ist es bei jedem Aspekt unseres Lebens, bei dem wir von einer Störung sprechen. Etwas funktioniert nicht ideal, nicht so, wie wir uns das vorstellen, so, dass es uns stört – so, dass es gefährlich für uns wird. Dies ist jeder Störung gemeinsam. Unterschiedlich ist, woher die Störung kommt und wie sie uns beeinträchtigt.
3. Zusammenführung: Schluckstörungen
Genauso ist es auch bei Störungen die „das Schlucken“ betreffen. Es gibt unterschiedliche Gründe, unterschiedliche Schweregrade und somit unterschiedliche Formen und Grade der Beeinträchtigung.
Das Schlucken besteht – wie beschrieben – aus unterschiedlichen Phasen. Jede dieser Phasen kann in unterschiedlicher Form und mit unterschiedlichen Folgen gestört sein.
Störungen in der oralen Phase sind meist sehr einfach von außen erkennbar. Betroffene kauen sehr lange, weil sie die Nahrung nicht gut zerkleinern können. Nahrung läuft aus dem Mund heraus, weil die Lippenmuskulatur nicht gut genug funktioniert und der Mund nicht komplett geschlossen werden kann (wenn Betroffene diese Muskelschwäche durch „geschicktes Kauen und Verschieben der Nahrung“ kompensieren, schmatzen sie lediglich). Auffällige Bewegungen der Muskulatur zeigen eine große Anstrengung beim Transport der Nahrung nach hinten. Sehr schweres Schlucken kann auf schlechtes Kauen oder zu geringe Speichelproduktion schließen lassen …
All diese Störungen sind Störungen des Schluckaktes. In der Regel handelt es sich – aus medizinischer Sicht – um keine allzu gravierenden Störungen, da sie nicht gefährlich sind. Ob sie für den Betroffenen schlimm sind, ist eine andere Frage, der wir uns später zuwenden…
Aus medizinischer Sicht gefährlicher sind in der Regel die Störungen in der pharyngealen Phase des Schluckaktes. Dies hat den einfachen Grund, dass die Nahrung in diesem Moment in die Atemwege gelangen kann.
Es sollte deutlich geworden sein, dass die pharyngeale Phase des Schluckaktes ein sehr komplexer Vorgang ist. Wie es aus allen Bereichen des Lebens bekannt ist, erhöht die Komplexität eines Vorganges auch die Möglichkeit, Fehler zu machen: „Viele Köche verderben den Brei.“ Die Gefahr, die von der Schluckstörung ausgeht, hängt von der Wahrscheinlichkeit ab, dass Nahrung in die Atemwege gelangt und vor allem dort bleibt.
So werden Probleme bei der Hebung des Gaumensegels zunächst nicht allzu problematisch sein: Die Nahrung kommt wahrscheinlich nicht komplett in die Speiseröhre, weil ein Teil nach oben in den Nasenraum gedrückt wird. Dort entsteht vielleicht ein unangenehmes Gefühl, vielleicht auch ein Niesreiz, aber das ist zunächst noch nicht lebensgefährlich. Erst wenn die Nahrung, die im Nasenraum ist, später unbemerkt und unkontrolliert doch noch in den Rachenraum hinabfließt, können Probleme auftauchen. Da der „normale“ Weg der Nahrung nicht eingehalten wird, kann der Schluckreflex nicht adäquat reagieren, sodass es zum Eintritt der Nahrung in den Kehlkopf kommt.
Zu diesem kann es auch durch viele andere Faktoren kommen: mangelhafter oder fehlender Schluckreflex und somit mangelhafte oder fehlende Schluckauslösung, mangelhafter oder zu kurzer Verschluss des Kehlkopfes, mangelhafte oder zu kurze Öffnung des obersten Muskels der Speiseröhre (oberer Ösophagussphinkter).
Diese Probleme können sensorische und motorische Ursachen haben: Entweder bekommt das Gehirn die falschen Reize geliefert, es bekommt sie zu spät geliefert, es reagiert zu spät oder es übersetzt die gelieferten Reize in falsche Bewegungen. In allen Fällen wird die Nahrung früher oder später in den Kehlkopf eintreten. Dies kann zu jeder Zeit passieren: vor Auslösung des Schluckaktes, wenn z.B. Flüssigkeit zu schnell nach hinten gelangt, während des Schluckvorganges durch die genannten Fehlreaktionen im Gehirn oder nach dem eigentlichen Schluckvorgang durch das Überbleiben von Nahrungsresten im Rachenbereich (sog. Residuen).
Beim Eintritt der Nahrung in den Kehlkopf spricht man von Penetration – je nach Zeitpunkt von prä-, intra- und postdeglutitiver Penetration („vor, während oder nach dem Schlucken“). Penetration an sich ist noch nicht lebensgefährlich, da der Körper einen weiteren Schutz eingebaut hat: den Hustenreflex. Dieser wird durch Berührung der Schleimhäute in den Atemwegen ausgelöst. Auf diesen Schleimhäuten befinden sich kleine Härchen (Flimmerepithel), die für die Reinigung der Atemwege zuständig sind. In jedem Moment transportieren sie den in der Lunge produzierten Schleim nach oben, wir räuspern uns, husten oder schlucken ihn einfach unbemerkt ab. Kommt ein Fremdkörper in die Atemwege, reagieren die Härchen mit einer stärkeren Bewegung nach oben, sodass Husten entsteht. Da diese Härchen bereits im Kehlkopf angesiedelt sind, reagiert der Körper normalerweise auf eine Penetration von Nahrung mit einem Husten, der die Nahrung wieder nach draußen befördert und die Gefahr vorbeiziehen lässt. (Jeder kennt diesen Vorgang vom alltäglichen Verschlucken, weil das Essen mal wieder nicht konzentriert genug aufgenommen wurde.)
Findet dieser Husten nicht oder zu spät statt, gelangt Nahrung in die Lunge, was ebenso zu den drei genannten Zeitpunkten geschehen kann. In diesem Moment sprechen wir von einer prä-, intra- oder postdeglutitiven Aspiration („Einatmung“) der Nahrung. Auch wenn jetzt der Husten einsetzt, können Reste der Nahrung ggf. nicht vollständig aus der Lunge befördert werden. Nachdem der Husten sich beruhigt hat, führen diese Reste dann in der Regel zu Infektionen bis hin zur Lungenentzündung. Nahrungsstücke, die im Kehlkopf stecken bleiben oder zu groß zum Abhusten sind, können zum Erstickungstod führen.
Ein weiteres großes Problem ist die sogenannte stille Aspiration. Hierbei gelangt Nahrung in die Lunge, ohne dass ein Hustenreiz ausgelöst wurde. Von außen sieht es so aus, als hätte der Betroffene alles gut geschluckt, bis dann Tage, Wochen oder Monate später die ersten Symptome einer Lungeninfektion auftreten (meistens, aber nicht immer, beginnend mit erhöhter Temperatur).
Störungen der ösophagealen Phase äußern sich darin, dass die Nahrung nicht in den Magen gelangt. Die Muskulatur der Speiseröhre arbeitet nicht angemessen, sodass ein Rückstau entsteht. Der Betroffene hat ständig ein Völlegefühl, wobei gleichzeitig keine Sättigung eintritt. Je nach Höhe des Rückstaus gelangt Nahrung wieder in den Rachen- oder sogar in den Mundraum. Häufig kommt es aber auch zu stiller Aspiration, wenn die Nahrung langsam aus der Speiseröhre von hinten in die geöffnete Luftröhre fließt.
Medizinisch betrachtet bedeutet eine Dysphagie also immer eine Einschränkung, die bis zur Lebensgefahr führen kann. Grundsätzliche Symptome gehen von einer großen Anstrengung beim Kauen und Schlucken über häufiges Husten beim Essen bis hin zu häufigen und/oder schweren Erkrankungen der Atemwege.