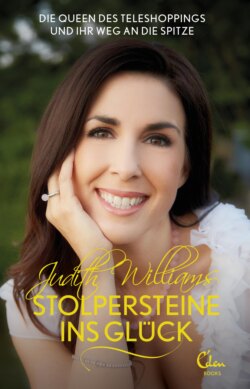Читать книгу Stolpersteine ins Glück - Judith Williams - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1 Von Pudeln und Opern
ОглавлениеAls meine Eltern Anfang der Siebzigerjahre von Salt Lake City nach München zogen, war die Stadt gerade dabei, sich als Gastgeberin der Olympischen Spiele und Ausrichterin des Endspiels um die Fußballweltmeisterschaft mächtig herauszuputzen. Der Stadtteil Schwabing wurde zum Zentrum der Freizügigkeit und Lebenslust. Jimi Hendrix rockte den Club »Big Apple«, während sich Mick Jagger und Keith Richard um das Groupie Uschi Obermaier balgten. Meine Eltern waren so jung wie die Leute, die Schwabing zum Partynabel Deutschlands machten, trotzdem konnte man sie hier nicht finden. Sie hatten anderes im Sinn, mit einem klaren Ziel vor Augen: Daddy würde in München ein Hochschulstudium zum Opernsänger absolvieren, während Mommy ihn dabei tatkräftig unterstützen wollte, obgleich sie selbst schon Erfolge auf der Theaterbühne gefeiert hatte. Soweit der Plan. Mein Vater wollte sein Ziel ohne finanzielle Unterstützung seiner Eltern schaffen. Als sie arm wie Kirchenmäuse in Deutschland ankamen – außer hundert Dollar und einer schwangeren Katze hatten sie nichts zu bieten –, hieß es erst einmal: Geld verdienen. Daddy nahm einen Job als Verkäufer in einem Hi-Fi-Geschäft auf dem amerikanischen Kasernengelände an, was meine Eltern dort zu einer günstigen Unterkunft berechtigte. Von Hi-Fi-Geräten hatte Daddy keine Ahnung, doch er hatte jede Menge Charme und seine Bassstimme. Damit verdreifachte er den Umsatz des Geschäftes in kürzester Zeit. Nach ein paar Monaten bot sich meinen Eltern eine überraschende Gelegenheit: Sie zogen nach Solln, den südlichsten Stadtteil Münchens. Dort gab es einen historischen Dorfkern und eine Villenkolonie aus der Gründerzeit, und in einer Villa bot ihnen die Besitzerin eine Wohnung an. Sie war kürzlich überfallen worden und daher überzeugt, dass ein »starker Mann« im Haus nicht schaden könne. Wie viele Bassisten ist Daddy ein Schrank von einem Mann. Trotzdem hätte er mögliche Einbrecher eher mit seinem tiefen »C« als mit seinen Muskeln in die Flucht schlagen können. Dann kam ich, am 18. September 1971. Neben dem Stolperstein »Welchen Namen geben wir dem Kind?« gab es ein weitaus schwerwiegenderes Ereignis: Beinahe wäre Mommy bei meiner Geburt gestorben. Sie hatte viel Blut verloren und ihr Kreislauf brach zusammen. Die Ärzte waren nicht in der Lage, eine Infusion zu legen. Daddy war im Kreißsaal. Seine donnernde Stimme wird heute noch zittrig und dünn, wenn er sich an den Vorfall erinnert.
»Plötzlich schrien Krankenschwestern und Ärzte um die Wette. Doch anstatt Gaye zu helfen, war es das Wichtigste, mich aus dem Raum zu bugsieren«, erzählte er mir neulich wieder unter Tränen, als ich ihn bat, meine Kindheitserinnerungen aufzufrischen. »Draußen flehte ich Gott im Himmel an, mir meine Liebste zu lassen. Ich hatte furchtbare Angst um Gaye und um dich. Sie mussten Mommy die Galle entfernen, was dazu führte, dass sie im ersten Jahr deines Lebens zu schwach war, dich in den Armen zu halten.«
Wer weiß, vielleicht führte diese Aufregung dazu, meinen Namen acht Tage später in Judith zu ändern. Judith bedeutet »Die Gepriesene« und sicher priesen Mommy und Daddy Gott dafür, dass am Ende alles gut ausgegangen war. Vielleicht hing es auch mit meiner extravaganten Patentante Judith zusammen. Die Schwester von Daddy flog aus London ein, um die nächsten sechs Monate als Ersatzmutter tätig zu sein. Heute wundert mich das nicht mehr: In der Familie Williams lässt man stets alles stehen und liegen, wenn irgendwo Not am Mann ist.
Als Mommy wieder auf dem Damm war, hatte Daddy eine gute Neuigkeit. Zu dieser Zeit lebte einer der berühmtesten Operntenöre der Welt in der Stadt, der Amerikaner James King. Der Sohn eines Sheriffs aus Dodge City im Bundesstaat Kansas gehörte zu den ersten Ausländern, die an der Deutschen Oper Berlin auftreten durften. Später sang er den Bacchus in Ariadne auf Naxos an der Wiener Staatsoper und gehörte als Siegmund in der Walküre zu den umjubelten Stars der Bayreuther Festspiele. King besaß ein Haus in Forstinning, dreißig Kilometer östlich von München, am Rand des Ebersberger Forstes. Seine Sehnsucht nach Wasser zog ihn jedoch an den Starnberger See und da tat er etwas Außergewöhnliches: Er vermietete sein Haus zu einem äußerst günstigen Preis an einen Bekannten von Daddy. Der war völlig überraschend Witwer geworden und hatte sechs Kinder zu versorgen. Natürlich war der Mann froh über diese einmalige Gelegenheit. Weil das Haus von James groß genug war, zogen wir gleich mit ein. So bekam ich von einem Tag auf den anderen sechs Geschwister und meine Mommy übernahm die Mutterrolle. Zum Glück war sie wieder voll bei Kräften und strotzte nur so vor Energie. Auch für mich konnte es nichts Besseres geben. Auf einen Schlag hatte ich ein halbes Dutzend Geschwister. Herrlich! Im Nachhinein kann ich nur staunen, wie meine Eltern bei all dem Trubel nie ihr Ziel aus den Augen verloren: Daddy sollte schließlich Opernsänger werden und im Haus eines Opernstars zu wohnen bedeutet noch lange nicht, auf seinen Spuren zu wandeln. So übte er weiterhin unverdrossen seine Arien, lernte Italienisch, trainierte die Fechtkunst und finanzierte alles als Angestellter des Hi-Fi-Ladens.
Familiensinn wurde bei uns Williams stets großgeschrieben – was meine eigene Patchworkfamilie, bestehend aus meinem Mann Alexander und unseren vier Kindern, bezeugt – und diesen Familiensinn durfte ich in den beiden fröhlich-chaotischen Jahren im Haus von James King ausleben. Ich schlief bei der ältesten Tochter im Bett, was mir ein wunderbar behütetes Gefühl gab. Tagsüber unterhielt ich die Kinder mit Geschichten und sang ihnen Arien vor, die ich von Daddy aufschnappte. Ein wunderbares Publikum – immer aufmerksam und fordernd! Ich kann mich an keinen Nachmittag erinnern, an dem wir Fernsehen schauten. Auch wenn ich heute selbst in dieser Branche tätig bin, bin ich mir sicher: Für Kinder ist ein Leben ohne Fernseher ein Segen.
Als Daddys Bekannter wieder heiratete und eine neue Mutter ins Haus kam, war es an der Zeit, weiterzuziehen. Ich tat das äußerst ungern und konnte mich am Anfang nicht an unsere neue Bleibe in einem anderen Haus der amerikanischen Armee gewöhnen. Doch blieb uns keine Wahl. Die deutsche Nationalmannschaft hatte dank eines Treffers von Gerd Müller die Fußballweltmeisterschaft gewonnen und nach der Olympiade und diesem Ereignis entwickelte sich München zur heimlichen Hauptstadt der Republik. Für eine abgebrannte amerikanische Kleinfamilie war es schwer, Unterschlupf zu finden. Schließlich zogen meine Eltern in einen kargen Altbau im Stadtteil Giesing. Kaum dort angekommen, eröffnete Daddy nicht weit entfernt einen Pudelsalon. Er liebt Hunde so sehr wie die Musik und von nun an gehörten waschen, föhnen, Fell scheren, Krallen schneiden und Ohrenpflege genauso zu seinen täglichen Arbeiten wie der Verkauf von Hi-Fi-Anlagen, die Gesangsausbildung, die Formenlehre und das Einstudieren neuer Lieder. Der Pudelsalon wurde mein Kinderzimmer. Als sei es gestern gewesen, erinnere ich mich an die beiden Räume im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Vorn befand sich der Verkaufstresen mit allen Arten von Produkten, die Hunde und ihre Herrchen und Frauchen glücklich machen: Kauknochen, Shampoo, Spielzeug, Körbchen – und Hundeschokolade, die vor allem mir sehr gut schmeckte! Im hinteren Raum stand eine Riesenbadewanne, dazu ein Tisch mit einem überdimensionalen Föhn, den ich heute sehr vermisse, denn so schnell sind meine langen Haare nie wieder trocken geworden. Dort wurden die Hunde gewaschen und gestriegelt und geföhnt, und bald hatte sich Daddy einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Er richtete Hunde, die in einer Show auftraten, immer besonders prächtig her. Verließen die stolzen Besitzer dann unser Geschäft, verkaufte ich ihnen noch ein Shampoo oder ein Spielzeug. So machte ich bereits als Dreikäsehoch erste Erfahrungen mit dem, was später mein Leben bestimmen sollte: mit Verkauf und Musik. Denn diese kam auch nie zu kurz, weil Daddy rund um die Uhr übte, zu Hause genauso wie im Pudelsalon. Kein Wunder, dass ich schon in jungen Jahren eine Menge Opernarien auswendig wusste.
Neben der Arbeit mit den Hunden züchtete Daddy Perserkatzen. Er hatte ein fotografisches Gedächtnis, wenn es um ihre Stammbäume ging. Seine Katzen waren heißbegehrt und immer, wenn Ebbe in der Haushaltskasse herrschte, verkaufte er eine. So kamen wir mit Ach und Krach über die Runden. Heute weiß ich, dass wir arm waren, aber damals empfand ich es genau andersherum: Meine Eltern jammerten nie über den Mangel an Geld, stattdessen wurde gesungen, gespielt und gelacht. Es gab nichts, was ich vermisste. Im Gegenteil, ich dachte immer, dass wir reich sein mussten, schließlich hatten wir ein Dach überm Kopf und sogar ein Auto. Bis mir eines Tages auffiel, dass mein Wintermantel von Jahr zu Jahr kürzer wurde und meine Handgelenke immer eiskalt waren. Selbst das empfand ich nicht als unangenehm, denn sicher gab es gleich wieder was zu lachen und das wog alles auf. Zum Beispiel die Sache mit unseren Papageien: Der eine konnte sprechen, der andere hatte seinen Lieblingsplatz auf meinem Kopf und der dritte – um Himmels Willen, der flog gerade zum offenen Fenster hinaus! Daddy war außer sich und rief die Münchner Feuerwehr. Die rückte an und Daddy kletterte zu ihnen in den Wagen. Dort war am Dach ein Megafon befestigt, aus dem sein Opernbass mit amerikanischem Akzent durch die Straßen von Giesing dröhnte: »Liebe Mitbürger! Haben Sie meinen geliebten Papagei gesehen? Er ist groß und grün und hört auf den Namen Aladin! Aladin, wo bist du? Komm zu Daddy!« Auf meinem kleinen rosa Fahrrad strampelte ich hinter dem Feuerwehrauto her und lauschte Daddys Lockrufen. Mittlerweile wusste das ganze Stadtviertel, dass »die Amerikaner« ihren Vogel vermissten. Sogar im Radio kam die Durchsage: »Wer hat einen Papagei gesehen?« Daraufhin kam der Hinweis, Aladin habe es sich in einer Baumkrone gemütlich gemacht. Das Feuerwehrauto machte sich auf den Weg, ich trat in die Pedale und kurz darauf sah ich Daddy auf einer Drehleiter immer höher schweben, dem Himmel und Aladin entgegen. Wenig später betrat er mitsamt dem Vogel wieder festen Boden und seine Stimme dröhnte über den Platz, als er sich bei jedem Feuerwehrmann für den Einsatz bedankte. Im Amerikanischen gibt es den Ausdruck »They are the talk of the town« – das sind die Leute, über die man immer spricht. In Giesing erfüllten wir diese Aufgabe locker. Der Opernsänger mit seinem Pudelsalon verlieh dem Stadtviertel eine sympathische Note.
Noch immer war bei uns Schmalhans Küchenmeister und die einzigen Möbel, die wir in unsere Wohnung stellen konnten, waren ein Geschenk von James King. Dafür hatten wir die Fantasie von Mommy: Unsere Toilette verschönerte sie mit farbintensiven Dschungelmotiven. Von diesem Augenblick an lebte ich in ständiger Furcht, dass mich ein Krokodil in den Po beißen könnte, wenn ich auf dem Klo saß. Ich war mittlerweile vier Jahre alt und für eine Vierjährige kann so eine Vorstellung sehr real sein. Eines Nachts wachte ich auf und stellte fest, dass ich allein war. Ich hatte nicht mitbekommen, dass Mommy und Daddy nochmals in den Pudelsalon gefahren waren, weil sie die Kasse mit den Tageseinnahmen vergessen hatten. Dafür wusste ich umso besser, dass mein nächtlicher Gang zur Toilette mit großen Gefahren verbunden war. Also beschloss ich, Reißaus zu nehmen, da schließlich ein Krokodil in der Wohnung lauerte. Gedacht, getan: raus aus der Wohnung, raus aus der Haustür, hinaus auf die dunkle, verlassene Straße. Die sah aber auch nicht gefahrlos aus, daher machte ich kehrt und verkroch mich im dunklen Treppenhaus. Neben uns wohnte die Vermieterin, Frau Huber, eine waschechte Münchnerin mit großem Herzen, und bei ihr klingelte ich. Im Nachthemd öffnete sie die Tür und da stand ich, einsam und verlassen. Inzwischen hatte mich die Angst mächtig durchgeschüttelt und ich hatte mich nass gemacht. Frau Huber erkannte das Dilemma sofort. »Jo mei, wen hamma den hier, sapperlot?«, sagte sie im schönsten bayerischen Dialekt. Sie nahm mich mit in ihre Wohnung und half mir, mich sauber zu machen. Danach tischte sie zum Trost Erdbeerkuchen auf, und das mitten in der Nacht. Ich verdrückte gerade das dritte Stück, als ihr feines Gehör Schritte im Treppenhaus vernahm. Frau Huber öffnete die Tür.
»Frau Williams«, sagte sie. »Ich hätte da ein Päckchen für Sie abzugeben.«
Mommy und Daddy fielen aus allen Wolken, als sie mich mit erdbeerverschmiertem Mund an Frau Hubers Küchentisch sitzen sahen. Aufgeregt erzählte ich von dem Krokodil. Wahrscheinlich machten sie sich schreckliche Vorwürfe, taten jedoch so, als sei es das Normalste der Welt, nachts allein aufzuwachen. Schließlich sahen sie meine Selbstständigkeit als wichtiges Ziel an. Mich ständig zu betütteln war nicht ihr Ding. In dieser Zeit lernte ich zwei Dinge kennen und lieben: Das gemütliche Chaos bei uns zu Hause, das meine Fantasie befeuerte, und die Perfektion und die Ordnung unserer Nachbarn, die in der Lage waren, mitten in der Nacht Erdbeerkuchen auf feinem Porzellangeschirr herbeizuzaubern. Noch heute ruft der Geruch frischer Bettwäsche, ein tadellos gebügeltes Tischtuch oder perfekt ausgerichtetes Porzellan in einem Glasschrank Kindheitserinnerungen in mir wach, als ich in unserer nächsten Umgebung deutsche Tugenden schätzen und bewundern lernte.