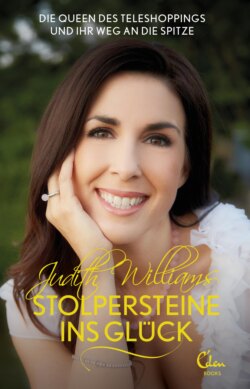Читать книгу Stolpersteine ins Glück - Judith Williams - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3 Pioniergeist
ОглавлениеDavon wusste ich nichts. Ich hatte leider nur wenig Kontakt zu meinen Großeltern. Stattdessen waren der gefeierte Opernstar Kurt Böhme und seine Frau Inge Ersatzgroßeltern geworden. Kurt schenkte mir meine erste Puppe, als ich fünf Jahre alt war, weil er nicht glauben konnte, dass ich nicht eine einzige besaß. Meine echten Großeltern dagegen bekam ich kaum zu Gesicht, denn Flüge in die USA waren zu teuer, als dass wir sie uns häufig leisten konnten. Im Alter von sechs Jahren lernte ich zum ersten Mal meine Großeltern väterlicherseits in ihrem Haus in Montana kennen. Ein Jahr später besuchte uns die Mutter von Daddy, als Elisabeth auf die Welt kam. Ich muss gestehen, dass sie mir ein bisschen unsympathisch war. »Das ist doch keine Oma«, dachte ich. Weder backte sie Plätzchen noch las sie mir Geschichten vor, wie es die Großmütter in meinen Kinderbüchern taten. Also pflanzte ich mich vor ihr auf und stellte meine Forderungen. Oma verzog keine Miene. »Eine Geschichte willst du hören?«, gab sie zurück. »Na gut.«
Ich war gespannt und setzte mich zu ihr.
»Filifu«, begann sie, »hatte keinen Schuh. Daher ging er barfuß. Damit ist die Geschichte zu Ende. Jetzt zurück an die Arbeit.«
»Wie bitte? Das ist alles? Also Oma, das ist die blödeste Geschichte, die ich je gehört habe!«
Oma beharrte darauf, dass die Geschichte zu Ende sei, und da ich schon damals recht energisch sein konnte, gab ein Wort das andere. Schließlich sagte sie: »Wenn du die Dinge so siehst, musst du auch nicht zu meiner Beerdigung kommen.«
»Abgemacht«, gab ich zurück. In diesem Augenblick kam Mommy ins Zimmer. Die letzten Sätze hatte sie mitbekommen. Sie erstarrte. Vielleicht war das der Grund, weshalb sie mir jetzt das Leben meiner Großeltern näherbringen wollte?
»Zu deinen Urahnen gehört ein gewisser Samuel Fuller«, begann sie. »Er segelte auf dem Schiff Mayflower von England nach Amerika. Über zwei Monate dauerte diese Fahrt. Am 21. November 1620 kam er auf Cape Cod an, nahe dem heutigen Ort Provincetown. Den harten Winter überlebte er nicht. Er starb, wie viele andere, an den Folgen der Tuberkulose. Das ist eine Krankheit, gegen die man damals nichts ausrichten konnte. Doch er hatte einen Sohn, der im folgenden Frühling nach Virginia ging.«
Ich erinnere mich, wie ich an Mommys Lippen hing. Sicher konnte ich damals nicht erfassen, was es bedeutete, dass meine Vorfahren zu den berühmten Pilgervätern gehörten, das wurde mir erst später klar. Die Pilgerväter waren zwar nicht die ersten Siedler Amerikas – schon 1607 gab es welche in Virginia und einige Spanier landeten bereits 1530 auf den Galveston Islands im Golf von Texas –, aber sie prägten die Geschichte Amerikas wesentlich mit. Diese Prägung lässt sich am besten in einem Satz zusammenfassen: harte Arbeit und unbändiger Wille. Nur damit konnten sie in der Wildnis überleben. Ich kann mich glücklich schätzen, dass Mommy ihren Stammbaum und den von Daddy so gut kennt. Nur deshalb weiß ich, dass ich indianische Vorfahren habe. Bereits 1625 tauchte in unserer Genealogie ein Indianer vom Stamm der Wampanog mit dem Namen No Pee auf. Er war der Sohn von No Took Salt und heiratete in die Fuller-Familie ein. Wenn ich mich heute im Spiegel betrachte, wird mir klar: Das indianische Erbe meiner Familie lässt sich bis zu mir verfolgen.
Natürlich hatte das Leben der Ureinwohner Amerikas sowie der weißen Siedler wenig mit dem zu tun, was wir in Deutschland vor allem über die Bücher von Karl May wissen: Bis Anfang des 19. Jahrhunderts war der sogenannte »Wilde Westen« tabu für die Einwanderer. Alles, was westlich des Missouri River lag, eine Fläche so groß wie Zentraleuropa, war unbekanntes Land. Erst 1804 wagten sich die Pioniere Meriwether Lewis und William Clark über den Fluss. Ihre mehrere Jahre dauernde Expedition führte sie über die Rocky Mountains bis zum Pazifik. Daneben gab es nur eine Handvoll verwegener Männer, die sich Mountain Men nannten und als Trapper in den Jagdgründen der Lakota-, Sioux-, Blackfoot- und Ree-Indianer im heutigen South Dakota, Wyoming und Idaho lebten. Für den Rest der europäischen Einwanderer bedeutete West Virginia das Ende der Welt. Das änderte sich erst nach der Lewis-und-Clark-Expedition. Sie öffnete den Weg nach Westen und schon bald zogen die ersten Siedler in Planwagen dorthin. Stützpunkte wie Fort Kearny am Platte River in Nebraska und Fort Bridger am Bitter Creek entstanden. Fort Bridger war das Nadelöhr über die Rocky Mountains in Richtung Utah und genau diesen Weg nahmen meine Vorfahren. Ich kann nur erahnen, welche Strapazen sie auf sich nehmen mussten. Mommy berichtete mir von Urahn John T. R. Hicks. Er kam im Alter von dreißig Jahren 1856 nach Amerika und machte sich sofort auf, die endlosen Steppen zu durchqueren. Die Siedler in seinem Treck litten an Kälte und Hunger, und Johns Frau Harriet war so krank, dass sie im Planwagen liegen musste. Als John eines Tages als Kundschafter vorausritt, fanden einige Mitreisende, dass Harriet eine zu große Belastung für alle war. Sie zogen die hilflose Frau aus dem Wagen und ließen sie am Wegesrand liegen. Am Abend kehrte John zurück und fand heraus, was geschehen war. Ganz allein ritt er den weiten Weg zurück. Mit viel Glück fand er seine Frau vor Einbruch der Dunkelheit und konnte sie retten. Doch ist überliefert, dass sie sich von diesem Zwischenfall nie vollständig erholen konnte. Aus dieser Geschichte lernte ich: Egal was passiert, ich darf niemals jemanden zurücklassen.
»Die Hicks-Familie«, erklärte Mommy, »waren Mormonen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage.« Wir gingen sonntags zur Kirche wie die meisten Leute in unserer Nachbarschaft, aber ein großes Thema war das nicht für mich. Doch was Mommy mir nun erzählte, war so spannend, dass ich alles um mich herum vergaß.
»Das Mormonentum«, sagte sie, »wurde 1830 von Joseph Smith gegründet, einem Bauernsohn aus Vermont. Am Anfang waren es nur sechs Anhänger, doch das änderte sich rasch. Als Smith 1844 für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidierte, gab es bereits ein paar Tausend Kirchenmitglieder. Im selben Jahr wurde er getötet – der erste US-amerikanische Präsidentschaftskandidat, der während des Wahlkampfs ermordet wurde.«
»Wow«, sagte ich. »Erzähl weiter!« Ich wollte unbedingt mehr hören. Das war nicht »Filifu hatte keinen Schuh. Daher ging er barfuß«, denn ich spürte, dass dies alles auch etwas mit mir zu tun hatte. Also zappelte ich herum, bis Mommy fortfuhr: »Es gab einen Mann namens Brigham Young, der von Beruf Schreiner war. Als Nachfolger von Joseph Smith tat er etwas, das vor ihm nur Moses getan hatte: Er führte seine Anhänger in ein neues Land, über viele Tausend Kilometer hinweg, in Planwagen, auf Pferden und mit bloßen Handkarren.«
Mommy machte erneut eine Pause. Ich hatte glühende Ohren und konnte es kaum erwarten, mehr zu hören.
»Nie zuvor waren Siedler in Richtung der Wüstengebiete von Utah gezogen«, fuhr sie fort, »auch Meriwether Lewis und William Clark nicht. Das Land galt als unbewohnbar. Außerdem war es gefährlich, die Rocky Mountains zu überqueren. 1846, als Brigham Young aufbrach, war die Donner Party, eine Gruppe von 87 Siedlern, östlich der Sierra Nevada vom frühzeitigen Einbruch des Winters überrascht worden. Vier Monate lang steckten die Menschen in meterhohen Schneewehen fest. Die wenigen Überlebenden kamen nur durch, weil sie die Toten aßen.«
»Wie grässlich«, dachte ich, »wie verzweifelt muss ein Mensch sein, um so weit zu gehen?«
Heute wachsen die Kinder mit Harry Potter & Co. auf und gruseln sich über diese Geschichten, so wie ich mich damals gruselte. Nur wusste ich, dass es sich um wahre Ereignisse handelte. Als Mommy sagte, den Siedlern um Brigham Young sei bewusst gewesen, was auf sie zukomme, biss ich mir vor Aufregung die Fingernägel ab.
»Brigham Young traf auf den berühmtesten Mountain Man dieser Zeit, einen Mann namens Jim Brigder«, erzählte sie weiter. »Dieser lebte 45 Jahre lang unter den Indianern und kannte die Sprachen der Snake, Bannock, Crow, Flathead, Nez Percé, Ute und Pend Oreille. Das war überlebenswichtig, denn dadurch konnte er zwischen den Ureinwohnern und den Siedlern vermitteln. Er war der erste Weiße, der die Geysire von Yellowstone mit eigenen Augen sah und die versteinerten Bäume rund um Tower Junction. Davon berichtete er einem Reporter aus New York: ›Dort sitzen versteinerte Vögel in versteinerten Bäumen und singen versteinerte Lieder.‹ Dieser Jim Bridger kannte einen Weg in die Salzwüsten von Utah, den heutigen Bridger Pass. Außerdem vertrat er die Ansicht, dass man dort Korn anbauen könne – es also ein Platz zum Leben sei. Nun, ich habe deinen Daddy in der Stadt kennengelernt, die Brigham Young am Ende der Reise mit den Worten ›This is the place‹ gegründet hat: Salt Lake City. Selbst heute, wo die Parkanlagen der Stadt immer grün und frisch sind, kann man sich noch gut vorstellen, welche heroische Leistung es war, an diesem Ort eine Siedlung zu errichten. Für mich war das immer der Beweis, wie der Glaube Berge versetzen kann, denn nur wenige Kilometer außerhalb der Stadt beginnen bereits die Großen Salzseen.«
Als der Treck von Urahn John T. R. Hicks acht Jahre später Salt Lake City erreichte, war von einer Stadt noch nichts zu sehen. Es war eine bescheidene Siedlung, welche die Pioniere errichtet hatten. Nun waren sie dabei, das salzige Land urbar zu machen.
»Durch harte Arbeit, unbändigen Willen und großen Fleiß schafften sie es«, sagte Mommy. »Kein Wunder, dass sie später Bienenkörbe als Symbol ihres Staates auswählten.«
Während ich das heute niederschreibe, wandern meine Gedanken zurück zu meinen Urgroßeltern. Sie hatten selbst viel Pioniergeist bewiesen. Von Mommy weiß ich, dass meine Urgroßmutter väterlicherseits an der London Academy of Music Gesang studiert hatte und eine sehr schöne Stimme besaß, »eine, die man nie vergessen konnte, wenn man sie einmal hörte«, wie sie erzählte. Meine Urgroßmutter mütterlicherseits wuchs in Salt Lake City auf. Ihr Vater besaß eine Zeitung und arbeitete später in der Bergbauindustrie. Dort war er so erfolgreich, dass er sich eines der ersten Autos im Staat Utah leisten konnte. Seine Karriere setzte er als Präsident der New York Mining Stock Exchange in New York City fort. Hautnah erlebte er den »Schwarzen Donnerstag« am 24. Oktober 1929 mit, als der Dow-Jones-Index in den Keller fiel und Panik unter den Anlegern ausbrach.
»Dein Uropa sah, wie verzweifelte Anleger aus den Fenstern der Büros in der Wall Street sprangen«, erzählte Mommy. »Es war schrecklich und in den Jahren, die folgten, wurde es nicht besser.«
Der »Schwarze Donnerstag« läutete eine Wirtschaftsdepression ein, die überall auf der Welt zu spüren war.
»Als ob das nicht genug wäre, wurde Amerika von einer furchtbaren Naturkatastrophe heimgesucht«, erzählte Mommy weiter. »Der ganze Mittlere Westen – ein Gebiet, das ein Dutzend Bundesstaaten umfasst – wurde von einer Dürre getroffen, die mehrere Jahre dauerte. Die ganze Region verwandelte sich in eine Dust Bowl, eine riesige Staubschüssel. Abertausende Bauern mussten ihre Farmen aufgeben und fliehen. Auch die Familie von deinem Uropa besaß dort eine Farm. Irgendwie schaffte er es, sie schuldenfrei zu halten und nebenher für das Studium seiner Brüder und Schwestern aufzukommen.«
»Was für tapfere Menschen«, dachte ich. Ein Gefühl kroch in mir hoch: Ich würde niemals solch enorme Fußstapfen ausfüllen können. Bis heute bewundere ich die Leistungsfähigkeit dieser Generationen, deren Früchte wir heute ernten. Jahre später, während als ich als Halbwüchsige Bücher verschlang, stieß ich auf den Roman Früchte des Zorns von John Steinbeck. Damals wurde mir das Ausmaß von Uropas Leistung noch einmal bewusst. Sicherlich hing es mit diesen Ereignissen zusammen, dass Urgroßvater am Ende seiner Berufslaufbahn nach Arizona ging, um sein Leben in den Dienst der Indianer im Maricopa Reservat zu stellen.
»Zu dieser Zeit war mein Vater auf dem Weg nach England«, sagte Mommy. »Er war gerade mal 21 Jahre alt und wollte sich nach einer Stelle umsehen. Da bekam er mit, wie sehr die Engländer an indianischen Kulturen interessiert waren. Er schrieb Uropa einen Brief, worauf dieser ihm eine riesige Kiste schickte. Darin waren traditionelle Kleidung der Maricopa Indianer, geweihte Puppen, Musikinstrumente, Haarschmuck, Masken, Töpferwaren. Wie durch ein Wunder hatte alles die lange Reise heil überstanden. Uropa hatte einen Brief beigelegt, in dem er beschrieb, wie die Kleidung anzulegen war, welche Gesänge angestimmt wurden, welche Tänze die Maricopas kannten. Von da an zog dein Großvater kreuz und quer über die britische Insel, um als Indianer verkleidet den Engländern die Tradition und Kultur der Maricopas nahezubringen.«
An dieser Stelle musste Mommy lachen: »Beim ersten Auftritt war die Halle genagelt voll. Dein Großvater hatte eine tolle Stimme und als er auf die Bühne kam, ausstaffiert wie ein Indianerhäuptling, und ein Kriegsgeheul anstimmte, fielen die Frauen reihenweise in Ohnmacht. ›Ups‹, dachte er, ›ich muss wohl die Sache ein bisschen langsamer angehen.‹ Das tat er und daraufhin wurde die Show ein Riesenerfolg. Ich erinnere mich, wie er später in Amerika die Kiste immer wieder öffnete, um mir die Schätze zu zeigen und von seinen Erlebnissen zu berichten.«
Zurück aus England zog Großvater nach Washington und begann, für die Marriott Corporation zu arbeiten. Er begann als Berater für sogenannte »Hot Shops«, wie man damals Fast-Food-Restaurants nannte. Er war dafür verantwortlich, den neuesten Milchshake herzustellen und Produkte so in Displays zu platzieren, dass sie jeder haben wollte. Darin war er sehr talentiert und wer weiß, vielleicht hat er mir ein wenig von diesem Talent vererbt. Muss ich heute geschäftliche Entscheidungen treffen, denke ich häufig: Was hätte Opa gemacht? Er war ein ruhiger und besonnener Mann, ein guter Ratgeber. Oma dagegen war ein Energiebündel, arbeitete vollzeit und gehörte damit zu den Vorreiterinnen in Amerika. Trotz ihres Berufs als Chefsekretärin in einem großen Konzern zog sie fünf Kinder auf. Meine Mommy war die Älteste und übernahm schon früh die Stelle der Mutter. Mit zehn Jahren kochte sie das Mittagessen für ihre vier Geschwister unter der telefonischen Anleitung von Großmutter aus dem Chefsekretärinnenbüro. Wie sich Geschichte doch wiederholt! Als meine Schwestern Elisabeth und Katharina auf die Welt kamen, schlüpfte auch ich nahtlos in diese Rolle.
Im Laufe der Jahre stieg Großvater bei Marriott auf. Am Ende war er einer der Vizepräsidenten des Konzerns, doch dann gab er seine Aktien zurück und verließ das Unternehmen. Noch heute höre ich die Seufzer von Großmutter: »Was diese Papiere heute wert wären. Ein Vermögen! Wir hätten reich sein können!« Doch Großvater hatte nicht vergessen, wie er als Indianer durch England gezogen war, und es war ihm ein Anliegen, alles über die Kultur der Maricopa zu lernen. Deshalb zog er mit Oma zurück in ihre Heimat nach Scottsdale, Arizona, und freundete sich mit den Indianern im Reservat an – ganz so, wie es sein Vater getan hatte.
Von meinen Großeltern väterlicherseits sind mir vor allem Erzählungen über ihre Ranch in Montana in Erinnerung. Sie war riesig, vierzigtausend Acres, also über sechzehntausend Hektar. Ich weiß noch, dass meine Großeltern ständig eingeschneit waren und uns das Jahre später bei einem Besuch ebenfalls passierte. Um sie zu unterhalten, musste ich damals Arien vorsingen und tanzen. Großvater lachte mit seinen strahlend blauen Augen und sagte: »Wenn du uns noch eine Vorstellung gibst, kriegst du von mir einen Dollar.« Das war mein erstes selbst verdientes Geld! Doch mehr zählte die Anerkennung der Erwachsenen. Keiner sagte: »Kind, gib endlich Ruhe.« Alle lachten und hatten ihre Freude an dem, was ich tat, was mir einiges an Selbstbewusstsein verlieh. Auch lernte ich in diesen frühen Tagen, dass es nichts Verwerfliches war, wenn man mit seinem Talent ein wenig Geld verdient.
Bei diesem Besuch kam ich zum ersten Mal mit Kosmetik in Berührung. Großmutter Hicks – die den schönen Namen Lavada trug, was »brennender Fels« bedeutet – war verrückt nach Kosmetik – anders als Mommy, die aus Geldmangel so gut wie keine Kosmetik besaß. Bei Oma standen auf der Anrichte im Schlafzimmer Batterien von Töpfchen, Tiegeln, Tuben und Pülverchen. Wie diese den Weg in die Einsamkeit von Montana gefunden hatten, konnte ich mir nicht erklären. Dafür wusste ich etwas anderes: Das ist mein Reich! Wenn ich nicht für die Verwandtschaft Liedchen trällerte und dazu Pirouetten drehte, verzog ich mich in Großmutters Schlafzimmer und vertiefte mich in mir völlig unbekannte Düfte. Ich öffnete hier etwas, schnupperte dort; ich puderte mich ein und probierte jede Creme aus. Natürlich tun das viele Mädchen im Alter von sechs Jahren – aber in meinem Fall war es ein wenig anders: Ich hatte das Gefühl, in meine ureigene Welt einzutauchen, die mir auf eine seltsame Art vertraut schien. Dabei verlor ich jedes Zeitgefühl und nach einer Weile wussten alle, wo sie mich zu suchen hatten, wenn ich wieder einmal abgetaucht war.
Während des Aufenthalts kam auch Großmutters eineiige Zwillingsschwester zu Besuch. Ich fand es lustig, dass sich die beiden nicht nur sehr ähnlich sahen, sondern fast identische Namen hatten: Statt Lavada hieß Großmutters Schwester Laveda. Dass »Lavada« altenglischen Ursprungs war, »Laveda« jedoch aus dem Lateinischen stammt und »unschuldig« bedeutet, entging mir. Für mich hatte man einfach aus Versehen einen Buchstaben ausgetauscht. Dabei war Großtante Laveda ganz und gar nicht unschuldig. Sie hatte einen schwerreichen Mann geheiratet, der durch Patente auf Verschlusskappen für Kosmetikflaschen Millionen verdient hatte. Laveda genoss das Leben in vollen Zügen. Als sie älter wurde, unterzog sie sich einem Facelifting. Das war zu dieser Zeit eine Ungeheuerlichkeit und sie kokettierte gern damit. Meine Großmutter war entsetzt, denn auf einmal sah ihre Schwester jünger aus als sie! Das wollte sie nicht auf sich sitzen lassen. Weil sie wusste, dass in dieser Zeit noch keine ihrer Cremes diese phänomenale Wirkung hervorrufen konnte, sie andererseits den operativen Eingriff aber ablehnte, wählte sie die Methode »Selbst ist die Frau«. Sie nahm eine Haarklammer, bog einen Haken zurecht, wählte einen Gummi im selben Farbton wie ihre Haut und steckte sich das Ganze so über die Ohren, dass die Gesichtshaut grotesk nach oben gezogen wurde. Zur Krönung des Ganzen steckte sie sich eine aufgefächerte Rose aus Tüll ins Haar. Das tat sie, weil der Haargummi durch seine Spannkraft eine Schneise über ihren Kopf zog und ihre voluminöse Frisur in zwei Hälften teilte. Dann schminkte sie sich und betrat derart aufgetakelt das Wohnzimmer. Ihr Mann, ihre Schwester, ihre Tochter, Oma Williams, Opa Williams, alle Tanten und Großtanten und natürlich auch ich fielen aus allen Wolken. Ich erinnere mich, dass Todesstille herrschte, was ihr zu gefallen schien. So einen Auftritt hat man schließlich nicht alle Tage. Sie lächelte zufrieden, doch offenbarte ihr Geheimnis nicht, auch wenn die Blüte auf ihrem Kopf ein deutliches Zeichen dafür war, dass etwas nicht stimmte. Daddy war charmant wie immer: »Lavada«, sagte er. »Du siehst um Jahre jünger aus. Und diese hübsche Rose in deinem Haar, das ist ja wunderbar! Meinst du, sie würde mir auch stehen und mir helfen, von meinem Doppelkinn abzulenken?« Ich dagegen war nicht ganz so liebenswürdig.
»Oma, dein Gesicht ist ja schief«, hörte man mich rufen. Damit konnte ich eine Frau, die in der Wüste von Arizona geboren war, nicht erschüttern.
»Findest du, Schätzchen?«, sagte sie. »Nun ja, die Sache ist noch nicht ausgereift. Aber ich glaube, ich sehe jetzt wieder jünger aus als Laveda.« Sie warf ihrer Schwester einen kecken Blick zu und erklärte mir, wie das Wunder zustande gekommen war. Auf einmal war ich Feuer und Flamme. Ich ließ mir von ihr Haarklammern und Gummis geben und hatte im Handumdrehen zehn Prototypen gebastelt, die ich an die weibliche Verwandtschaft verkaufte.
»Wenn ihr kein Geld für ein Facelifting habt«, sprach ich die Frauen an, »macht es wie Oma!«
Ich muss lächeln, wenn ich das heute niederschreibe. Unbemerkt von allen tat sich schon damals ein Talent auf, das keiner realisierte, am wenigsten ich selbst: Ich war schon damals eine gute Verkäuferin und freute mich über die paar Dollars, die meine Tanten für die Methode »Facelifting nach Großmutters Art« springen ließen.