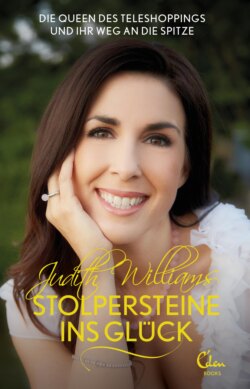Читать книгу Stolpersteine ins Glück - Judith Williams - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 5 Bei den Ursulinen
ОглавлениеDie bleierne Zeit lautet der Titel eines Spielfilms der deutschen Regisseurin Margarethe von Trotta, der Anfang der Achtzigerjahre Furore machte. Damals hatte ich von ihm keine Ahnung, denn wir gingen nicht ins Kino, doch später konnte ich ihn sehen und bewundern. Sein Titel ist die beste Umschreibung der nächsten Jahre meiner Schulzeit. Bleiern war die Zeit, unendlich langsam tickten die Zeiger der Uhr: Noch eine Stunde und noch eine Stunde und noch eine Stunde musste ich ausharren. Ich litt darunter, dass meine Energie und Kreativität durch die strengen Regeln und dem Zwang, stundenlang stillzusitzen, gekappt wurden. Wenn ich heute an diese Jahre zurückdenke, sehe ich mich teilnahmslos zum Fenster hinausstarren und mich an den Ort träumen, der mir Trost war: das Opernhaus. Als Daddy in Trier anfing, nahm er mich wann immer möglich mit zu den Proben und Auftritten. War in München der Pudelsalon mein Kinderzimmer gewesen, wurde es nun die Künstlergarderobe. Dort saß ich zwischen den Akteuren und half ihnen beim Schminken. Allein der Geruch – ja, ich bekenne: Ich bin süchtig danach! Alles ist ein bisschen modrig, während sich die vielfältigen Düfte der Theaterschminke darüberlegen. Für mich war es das Parfüm der Freiheit: eine Freiheit, die ich einatmen konnte. Der Höhepunkt kam, wenn Daddy auf der Bühne stand und sang. Da quetschte ich mich in die erste Reihe zu den Feuerwehrleuten, die zum Brandschutz in die Oper abkommandiert worden waren. Die kannten mich bereits. Stieß ein neuer Kollege dazu und beschwerte sich, dass dieses Kind um diese Zeit ins Bett gehöre und nicht ins Opernhaus, stießen ihn die Kameraden an:
»Das ist doch die Tochter des Bassisten«, sagten sie. »Die gehört zum Inventar.« Eines konnte selbst diesen Höhepunkt noch toppen: wenn mich Frau Friederich unter ihre Fittiche nahm. Frau Friederich bekleidete das Amt der Souffleuse. Im Theater und an der Oper bezeichnet man damit Leute, die sich während der Aufführung im Souffleurkasten in der Mitte der Bühne aufhalten, vom Zuschauerraum nicht einsehbar, um von dort aus alle Rollen mitzulesen. Vergisst einer der Darsteller seinen Einsatz, gibt ihm die Souffleuse einen Hinweis und flüstert ihm die richtigen Worte zu. Frau Friederich war eine sehr zuverlässige Souffleuse, präzise wie das Werk einer Schweizer Uhr. Doch sie hatte eine kleine Schwäche und das war ich. Wann immer es ging, nahm sie mich mit an ihren Arbeitsplatz. Dort kauerte ich neben ihr, sah die ganze Bühne ein und flüsterte die Rollen ebenfalls mit. Hob ich im Eifer des Gefechts meine Stimme, legte Frau Friederich einen Finger auf ihren Mund. Traf uns die feuchte Aussprache, die vielen Sängern zu eigen ist, sagte sie: »Das gehört zum Berufsrisiko.« Obwohl ich zu dieser Zeit die vielen ungeschriebenen Regeln im Leben eines Opernsängers noch nicht verstand, wurde mir im Laufe der Zeit klar, dass Daddy häufiger auf der Bühne zu sehen war als seine Kollegen. Der Grund war: Noch immer fiel es ihm schwer, die ständig wachsende Familie zu ernähren. Aus diesem Grund nahm er Rollen an, die nicht durch seinen Vertrag abgedeckt waren. Reichte das Geld trotzdem hinten und vorne nicht, trennte er sich schweren Herzens von einer der fünfzehn bis zwanzig Zuchtkatzen, die unser Haus bevölkerten. Trotzdem blieb Bargeld immer knapp. Eines Tages versprach er mir zu Weihnachten Schlittschuhe. Kurz vor der großen Bescherung nahm er mich zur Seite.
»Schätzchen«, sagte er. »Ich weiß, ich wollte dir Schlittschuhe kaufen. Das klappt leider nicht. Sie kommen ein bisschen später.«
Natürlich erzählte er mir nicht, dass der Intendant ihm einen Bonus für die Zusatzrollen versprochen hatte, sich aber nicht mehr an seine eigenen Worte erinnern konnte. Davon sprach er erst später, als ich selbst mit den Unzulänglichkeiten des Gedächtnisses mancher Theaterleiter zu kämpfen hatte.
»Wir hatten das per Handschlag ausgemacht«, sagte Daddy. »Bei uns in Montana gilt das als Ehrenwort. Doch er meinte: ›Bonus, was für einen Bonus? Haben Sie das schwarz auf weiß? Nein? Dann tuts mir leid.‹ Daher, Schätzchen: Hier in Deutschland brauchst du ein Papier, um etwas beweisen zu können, also kümmer dich stets darum.« Von da an folgte ich seinem Rat und ließ mir alles schriftlich geben.
Als das Opernhaus Bremerhaven an Daddy herantrat, um ihm einen Vertrag mit besseren Konditionen anzubieten, stand außer Frage, dass er die Stelle annahm. Leider liegt die Stadt an der Wesermündung sechshundert Kilometer von Trier entfernt. Von nun an sahen wir ihn nur noch drei Monate im Jahr und ich musste Mommy noch mehr helfen. Ich kümmerte mich um Elisabeth und Katharina, grub den Garten um, jätete Unkraut und lernte, wie man mit einer Schnur perfekte Sälinien legt. Danach versorgte ich unsere Tiere: die unzähligen Katzen, den Pudel Susi, die englischen Bulldoggen Auntie, Mam und Mäuschen, das Meerschweinchen und den neuen Hasen, von dem wir dachten, er sei ein Minischlappohr, bis er sieben Kilogramm auf die Waage brachte und sich als Deutscher Riese entpuppte. Machte im Sommer das Opernhaus Urlaub, kam Daddy nach Hause. Am liebsten ging er dann mit seinem Freund, dem Tierarzt, auf Tour. Ich konnte am Anfang nicht glauben, dass dieser Mann tatsächlich Doktor Fisch hieß – ich dachte, das sei mal wieder einer von Daddys Späßen. Aber es stimmte. Doktor Fisch half den Landwirten in der Umgebung bei der Viehzucht und Daddy hatte viel Freude daran, Doktor Fisch darin zu unterstützen. Endlich konnte er seinen heimlichen Berufswunsch Tierarzt ausleben – und wenn die Bauern ihn als Doktor Williams ansprachen, freute er sich wie ein Schneekönig. Ich fragte mich nur, weshalb Mommy ihn ausschimpfte, als er eines Tages nach Hause kam und damit prahlte, dass Bauer Pfanz allen Leuten erzähle, »der Doktor Williams hat erstklassig meine beste Kuh besamt«.
Als ich Daddy in Bremerhaven besuchen durfte, wurde ich völlig zum Opernkind. Jetzt gehörte ich tatsächlich zum Inventar, denn ich verbrachte die ganze Zeit in der Maske und auf der Bühne. Anderen Kindern wäre das vielleicht langweilig geworden, aber ich liebte es, Perücken zu bürsten und Abschminkschwämme zu putzen. Ich half, den Fundus zu pflegen – Kulissen, Requisiten, und Kostüme – und fertigte mit der Maskenbildnerin Glatzen aus Latex an, bevor ich den Inhalt der Schminkkoffer neu ordnete. Am Abend brachte mir Daddy bei, wie man sich bei Premierenfeiern verhält und bei Empfängen die Sponsoren mit Knicks begrüßt.
»Da darfst du nicht rumhüpfen«, sagte er und ich nahm mir das zu Herzen. »Nicht hüpfen«, dachte ich, während ich zwischen den Damen und Herren in Abendgarderobe stand. Dabei hätte ich das am liebsten getan, denn das Herz schlug mir bis zum Hals. Wenn aber Daddy der Ansicht war, dass ein hüpfendes Mädchen den Abend ruinierte, stand für mich außer Frage, auch nur den allerkleinsten Hopser zu tun. Stattdessen senkte ich würdevoll den Kopf, wie er es mir gezeigt hatte – »nicht zu sehr, nur mit einem kleinen Ansatz, schau mal, so macht man das« –, und machte einen Knicks. Dazu trug ich ein grünes Kleid, das Mommy aus einer alten Samtgardine geschneidert hatte. Ähnlich wie der Wintermantel wurde es im Lauf der Jahre kürzer und kürzer, trotzdem machte ich darin eine reizende Figur, denn Daddy wurde mit Komplimenten überhäuft und war stolz wie Oskar. In den Jahren, die folgten, begleitete ich ihn überall hin: nach Kiel und Weimar, nach Leipzig und Dresden, Hamburg und Berlin und schließlich ins Ausland, nach Nancy, Marseille, Cagliari, Palermo, Genua, Venedig und Rom. Stets lernte ich in den Städten nur die Opernhäuser kennen und den Zoo, sofern es ihn gab. Dort verbrachte Daddy am liebsten seine Freizeit, wenn er auf Tournee war, und Mommy wusste das zu schätzen. Schließlich gibt es genügend Opernsänger, die wie die Matrosen leben: mit einer anderen Braut in jedem Hafen. Daddy hingegen kokettierte nur, dass man mich für seine Frau hielt. Das passierte, als ich älter wurde und das Kleid aus Gardinenstoff längst abgelegt hatte. »Sie haben aber eine hübsche Frau«, sagte ein Premierengast, während ein anderer Daddy kumpelhaft mit dem Ellbogen anstieß: »Ihre Freundin ist aber noch sehr jung.« Das ließ ich nicht auf mir sitzen. »Ich bin die Tochter«, sagte ich mit Nachdruck, während Daddy sein dröhnendes Lachen erschallen ließ, das alle peinlichen Missverständnisse in Schall und Rauch auflösen konnte.
Das alles geschah aber Jahre später. Jetzt hieß es erst einmal wieder Schulbank drücken. Schon Tage davor dachte ich mit Grauen daran. Auf einmal sah man die ansonsten so fröhliche Judith mit Leichenbittermiene durchs Opernhaus huschen. Ich konnte und wollte mich nicht an den Gedanken gewöhnen, dass mir in Kürze wieder ein Jahr zwangsverordnetes Stillsitzen und völlige Anpassung drohten. Noch immer sah ich mich selbst als Totalversagerin.
»Daddy, kann ich nicht bleiben? Kann ich nicht die Schule schwänzen?«, bettelte ich.
Da stieß ich auf Granit. »Du brauchst deinen Abschluss, Schätzchen«, antwortete er. »Egal, was du später machen willst, ohne ihn kommst du nicht weit. Denk daran, dass diese kurze Zeit einen sehr großen Teil deines späteren Lebens bestimmen wird.«
Er versprach, mit Mommy über meine Situation zu sprechen. Die beiden kamen überein, dass es besser sei, wenn ich auf eine andere Schule wechselte. Das Auguste-Viktoria-Gymnasium war kein Ort, an dem ihre Tochter glücklich wurde. Viele Möglichkeiten bot Trier zu dieser Zeit nicht. Am Ende einigten sich meine Eltern darauf, dass ich aufs Bischöfliche Angela-Merici-Gymnasium gehen sollte. Dieses war 1856 gegründet worden und heute, während ich das alles zu Papier bringe, staune ich über diese Zahl. Immerhin kam im gleichen Jahr Urahn John T. R. Hicks nach Amerika und machte sich auf seinen langen und mühseligen Weg nach Utah. Schon damals wurden in Trier Mädchen an einem Gymnasium unterrichtet!
Das Angela-Merici-Gymnasium wurde vom Orden der Gesellschaft der Heiligen Ursula geführt. Die Ursulinen sind eine Frauengemeinschaft zu Ehren der Ursula von Köln, im Jahr 1535 von Angela Merici ins Leben gerufen. Ehrlich gesagt hielt sich meine Begeisterung in Grenzen bei der Aussicht, von Nonnen unterrichtet zu werden. Ich vertrat ohnehin die Ansicht, dass ich zu dumm sei, um in einer Schule erfolgreich zu sein, egal in welcher. Dafür sprach, dass ich das Jahr wiederholen musste, denn außer in Englisch war ich in allen Fächern schlecht. Ohne meinen Eltern etwas zu sagen, machte ich mich auf den Weg zum schulpsychologischen Dienst. Er befand sich in der Trierer Bahnhofstraße. In einem Prospekt hatte ich gelesen: »Hier bekommst du Beratung bei Problemen wie Schulangst, Über- und Unterforderung, mangelnden Lerntechniken, Konflikten« – alles Dinge, die auf mich zutrafen.
»Ich bin zu dumm fürs Gymnasium«, sagte ich dem Pädagogen, nachdem er mich ins Zimmer gebeten hatte. »Können Sie mit mir einen IQ-Test machen?«
Ich hatte Glück, er nahm sich einen ganzen Nachmittag lang Zeit. Wir machten eine ganze Reihe von Tests und am Ende sagte er: »Du bist alles anderes als zu dumm. Du könntest überall eine Eins haben.«
Wahrscheinlich ahnte er nicht, welche Größe der Stein hatte, der mir vom Herzen fiel. Von nun an kam ich einmal die Woche und er brachte mir Lerntechniken bei und wie man seine Hausaufgaben angeht. Damals tat ich einen Schwur: »Wenn ich selbst mal Kinder habe, schicke ich sie auf die beste Schule.« Diesen Eid habe ich nie vergessen und ihn, soweit das möglich ist, in die Tat umgesetzt.
Das leidige Stillsitzen konnte mir aber auch der Pädagoge nicht abnehmen, das war noch immer meine größte Herausforderung. Inzwischen weinte ich jeden Morgen, wenn ich zur Schule gehen musste. Das einzige Gefühl, das sich dort bei mir regte, war mein Gerechtigkeitssinn. Als unser Chemielehrer zu einer Mitschülerin sagte: »Du bist zu blöd für dieses Fach; mach das Fenster auf und spring raus!«, erhob ich mich.
»Das können Sie nicht sagen!«, schrie ich ihn an.
»Was geht dich das an?«, konterte er. »Außerdem bist du von der gleichen Sorte. Raus, und melde dich beim Rektor.«
Auf dem Rektorat gehörte ich – und das ganz ungewollt – auch schon zum Inventar. Ständig musste ich aufkreuzen, ständig wurden meine Eltern einbestellt. Diesmal brachte es das Fass zum Überlaufen und Mommy und Daddy zur der längst fälligen Entscheidung: Judith soll die Schule wechseln.
Als ich jetzt am ersten Schultag das Angela-Merici-Gymnasium betrat, blieb ich ehrfurchtsvoll im Atrium stehen. Es war nicht nur der wunderbare Klang, der mich hier immer aufs Neue beeindrucken sollte. Es war auch die perfekte Sauberkeit, die mich fast blendete. Niemals zuvor hatte ich einen reinlicheren Ort gesehen, geradezu ein Gegenentwurf zum Chaos der Künstlergarderoben oder zu unserem Zuhause. Nirgendwo lag auch nur ein Krümelchen; in den Waschräumen blitzten die Armaturen, selbst die Mülleimer schienen stets leer zu sein. Es gab viel Platz auf dem Pausenhof, die Räume waren licht und hell, die Lehrer streng, aber menschlich, und die Direktorin, Schwester Dorothea, strahlte eine Güte aus, die mir guttat. Ich war ihr das erste Mal in Begleitung meiner Eltern zum Vorgespräch begegnet. Sie hatten sich nicht mit wehenden Fahnen für diese Schule entschieden.
»Schwester Dorothea«, sagte Daddy. »Wir sind weder katholisch noch evangelisch, wir sind Mormonen aus Amerika.«
Ich erinnere mich, wie Schwester Dorothea lächelte. »Ist das so?«, fragte sie. »Und an was glauben Sie?«
»An Gott, an Jesus, an die Nächstenliebe«, zählte Daddy auf.
In den Augen der Schwester blitzte Schalk. »Dann haben wir doch einiges gemeinsam«, antwortete sie.
So war es auch. Vom ersten Tag an fühlte ich mich bei den Ursulinen angenommen. Es unterrichteten auch Lehrer, die nicht dem Orden angehörten, doch die Schwestern brachten uns Mathematik, Chemie und Physik bei. Auch auf anderem Gebiet waren sie nicht untätig. Als wir zu Besinnungstagen nach Rom fuhren, warnte uns Schwester Paula: »Wenn ihr nachher aus dem Bus steigt, werden jede Menge junger Italiener um euch herumscharwenzeln. Passt auf: Die wollen ihren Arm um euch legen und euch einen Kuss geben.«
Dagegen hätten wir gar nicht so viel einzuwenden gehabt, doch die Warnung führte dazu, dass wir jetzt ganz besonders auf der Hut waren. Kurz darauf hörte ich die aufgeregte Stimme meiner Mitschülerin Corinna: »Schwester Paula, da ist einer, der will was von mir! Was soll ich nur tun?«
Offenbar war Schwester Paula bei Mommy in die Lehre gegangen, denn sie rief: »Treten! Treten!«
Der gute Rat kam nicht wie gewünscht bei Corinna an.
»Was hilft denn da noch beten?«, wollte sie wissen. Natürlich haben wir sie danach immer wieder liebevoll auf den Arm genommen. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, durchströmt mich ein warmes Gefühl. Ich wurde zwar auch bei den Ursulinen nicht zu einer guten Schülerin, aber wenigstens fühlte ich mich aufgehoben und geschützt, auch als ich in die Pubertät kam.
Fragte mich damals jemand: »Judith, was willst du werden?«, war meine Antwort: »Ein Clown!« Auf den ersten Blick passte das nicht zu mir, denn ich war weder der Klassenclown noch das Mädchen, um das sich alle scharten. Seit wir aber in München zum ersten Mal den Zirkus Krone besucht hatten, war ich fasziniert von der Kraft, die in der Figur des Clowns steckte. Vor allem seine Fähigkeit, die Dinge anders zu sehen, hatte es mir angetan. Dabei wusste ich noch gar nichts von den vielen Clowns, die das Theater bevölkern, wie der Harlekin aus der italie-nischen Commedia dell’Arte. Noch weniger ahnte ich, dass alle indigenen Kulturen ihre eigenen Clownsfiguren besitzen, auch die indianischen Stämme Nordamerikas. Bei ihnen war Wakan, der mythische Clown, untrennbar mit dem spirituellen Kult Heyoka verbunden: Er beschreibt den Weg zur Glückseligkeit, der allein über die Freude zu finden ist. Dafür hatte ich schon einmal das wunderbare Sprichwort aus dem alten Persien gehört: »Kommt ein Clown in die Stadt, ist das mehr Wert als eine Wagenladung Medikamente.« Diese heilende Kraft des Lachens konnte ich selbst spüren; sie wurde für mich eine Waffe, die jedes bittere Gefühl besiegen kann. Auch wenn aus mir dann doch kein Clown wurde – wer meine Sendungen kennt, weiß, wie häufig ich humoristische Einlagen einbaue. Ich kann gar nicht anders, als mich manchmal auch selbst auf die Schippe zu nehmen.