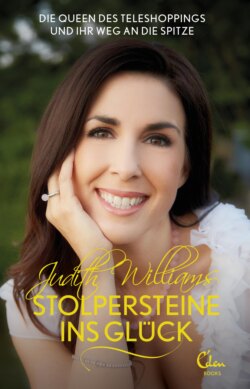Читать книгу Stolpersteine ins Glück - Judith Williams - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 4 Schule – gibt es Schlimmeres auf Erden?
ОглавлениеKam in Konz ein Handwerker ins Haus, betrachteten wir ihn wie das achte Weltwunder. Daddy selbst konnte keinen Nagel in die Wand schlagen, ohne sich zu verletzen. Das machte ihm allerdings nichts aus, er hatte keinen falschen Stolz. Im Gegenteil, hatte der Handwerker seine Sache gut gemacht, lobte ihn Daddy in höchsten Tönen. Es waren kernige Menschen, die in unserer Gegend lebten, die geprägt war vom Weinbau und der Landwirtschaft. Für sie waren wir eine exotische Familie. Stets wurde bei uns gesungen und getanzt, auch wenn Fremde im Haus waren. Ich hatte schon mit drei Jahren meine ersten Ballettschuhe bekommen und übte unter Anleitung von Mommy fleißig. Als wir das kalte und zugige Haus an den Bahngleisen verließen, um uns in Oberemmel niederzulassen, kam für mich die Zeit, so richtig mit Tanzen anzufangen. Auch dieses Haus verdankten wir Helmut Philipp, der bei der Bank bürgte, weil diese einem armen Opernsänger niemals einen Kredit für einen Hauskauf gegeben hätte. Mama erzählte mir das damals mit Dankbarkeit und zugleich Scham in der Stimme.
Oberemmel ist ein schnuckeliges Dorf mit alten Häusern, verwinkelten Gassen, grünen Innenhöfen – der Traum jedes Amerikaners. Außerdem ist es eine Hochburg des Karnevals und das bedeutete für mich: Ab zu den Gardemädchen des »Emmeler Carnevals Clubs«! Hier konnte ich mich so richtig austoben. Unter der Woche trainierte ich in Trier in der Ballettschule und am Wochenende übten wir für die nächste Karnevalsaison. Für Mommy begann eine Zeit, die jede Mutter nur zu gut kennt – wie ich heute auch: die Zeit als Privattaxi. Dreimal die Woche fuhr sie mich nach Trier, was eine Dreiviertelstunde dauerte. Dort musste sie warten, bis mein Unterricht zu Ende war, dann kutschierte sie mich zurück. Zu Hause warteten schon meine beiden Schwestern und wollten ebenfalls bemuttert werden. Später nahmen sie genauso selbstverständlich wie ich Mommys Taxidienste in Anspruch. Erst seit ich das selbst tue, ist mir klar geworden, wie viel Zeit und Energie Mommy in uns Kinder investiert hat. Zum Glück tat sie es gern. Nicht, weil sie dachte, aus ihrer ältesten Tochter werde bestimmt eine Primaballerina, sondern weil sie merkte, wie glücklich mich das Tanzen machte.
Ganz anders erging es mir in der Schule. Dort blies ich von Anfang an nur Trübsal. Ich konnte nichts mit dem üblichen Frontalunterricht anfangen; stundenlang dazusitzen und zuzuhören fiel mir schwer. Außerdem merkte ich in der Schule ganz besonders, wie anders unsere Familie war. Und ich kam nun in ein Alter, wo man nicht »anders« sein will, sondern »gleich«.
Es begann damit, dass Mitschüler mich fragten, welchen Beruf mein Daddy ausübte. Vor Kurzem hätte ich noch mit Inbrunst »Er ist Opernsänger!« gerufen, nun wollte ich lieber eine andere Antwort geben: Postbeamter vielleicht, oder Kaufmann; ebendas, was die Väter meiner Mitschülerinnen waren. Die waren auch immer zu Hause, bei Daddy war das nicht der Fall. Als seine Karriere in Schwung kam, wurde er oft zu Gastspielen eingeladen. Ich war es mittlerweile gewohnt, häufiger mit ihm am Telefon zu sprechen als von Angesicht zu Angesicht. War er hier, wurden zwar gleich wieder Möbel zur Seite geschoben, damit wir tanzen konnten, singen und lachen. Das war toll, aber – und dieses Aber wurde von Woche zu Woche größer – ich begann, das Leben meiner Mitschüler zu beneiden: Bei denen ging es nicht so laut zu wie bei uns, sondern anständig und gesittet. Da war auch keine Mommy, die vor lauter Hektik zwei verschiedene Schuhe an den Füßen hatte und in den Hausschuhen zur Kirche ging. Bei den anderen stand pünktlich um zwölf Uhr das Mittagessen auf dem Tisch, bei uns wurde mal um vierzehn Uhr gegessen, dann wieder um sechzehn Uhr. Mommy sagte: »Du hast zwei Hände, dann lern kochen«, und in mir wuchs das Gefühl, dass ich eigentlich nirgendwo richtig hineinpasste. Das war seltsam, denn gleichzeitig fühlte ich mich frei und wusste mit jeder Faser meines Körpers, dass ich alles erreichen konnte. Heute kann ich nachvollziehen, dass ich dieses Gefühl meiner Erziehung verdanke, da meine Eltern zu jeder Tages- und Nachtzeit predigten: »Judith, du kannst alles erreichen – wenn du es willst!« In dieser Zeit träumte ich davon, fliegen zu können. Das machen viele Kinder, aber nur wenige tun, was ich tat: Ich übte. Ich übte monatelang täglich mehrere Stunden, mich Kraft meiner Gedanken in die Lüfte zu erheben. Obwohl es nicht klappen wollte, gab ich nicht auf. Das Wort »aufgeben« existierte nicht in meinem Wortschatz. Ich wollte, dass die Leute sagen mussten: »Jetzt schaut euch mal die Judith an. Sie hat davon geträumt, fliegen zu können, nun kann sie es.« Leider musste niemand in Oberemmel, Konz oder Trier diese Worte jemals aussprechen. Judith Williams, die Tochter des Opernsängers, konnte mittlerweile zwar ganz anmutig als Ballerina für ein paar Millisekunden die Schwerkraft überlisten. Aber fliegen konnte sie nicht.
Inzwischen durfte ich jeden Samstag in der Trierer Ballettschule bei den Profis mitmachen. Die Trainerin war Frau Kabos. Sie war schon über sechzig Jahre alt, aber noch so fit, geschmeidig und elegant, dass sie zu meinem Vorbild wurde. Ich war das einzige Kind unter lauter Erwachsenen und sie sagte zu mir: »Judith, mach einfach alles mit.«
Diese Anweisung musste man mir nicht zweimal geben. Ballett schenkt einem jungen Mädchen Selbstbewusstsein, ein Gefühl für den eigenen Körper und vor allem: Disziplin. Meine Großeltern waren diszipliniert gewesen, weil es die Umstände verlangten. Meine Disziplin – manche sagen, meine eiserne Disziplin – bekam ich durchs Ballett. Heute denke ich, sie wurde meine Rettung. Doch damals in der Schule half mir das wenig. Stundenlang starrte ich aus dem Fenster, während durch meinen Kopf Fragen wirbelten: Warum muss ich hier sitzen? Warum darf ich nicht aufstehen und mich bewegen? Warum darf ich nicht tanzen, wenn mich das glücklich macht? Außerdem war ich mir sicher, dass ich zu einer schrecklichen Prügelliese verkommen würde, weil ich erst kürzlich den Klassenrowdy niedergestreckt hatte. Es war um eine Hänselei gegangen, das Opfer war meine Nebensitzerin Silke. Sie war zu dieser Zeit ein moppeliges Mädchen und Zielscheibe der gemeinsten Bemerkungen von Andreas, dem Lautsprecher der Klasse. Was mich völlig aus der Fassung brachte, war die Tatsache, dass er uns Mädchen immer anspuckte. Empört ging ich nach Hause und erzählte Mommy davon.
Sie sagte: »Okay, Judith. Du bist jetzt alt genug, um zu lernen, was das hier ist.« Sie simulierte einen Faustschlag, der gewiss nicht mit einer rechten Geraden der Klitschko-Brüder konkurrieren konnte. Ich fühlte mich trotzdem inspiriert. Am nächsten Tag trat Andreas an unseren Tisch, spuckte mir ins Gesicht und nannte Silke eine fette Kuh.
»Hör auf damit!«, sagte ich. »Sonst haue ich dir eine runter.«
Haha, wie komisch. Die Balletteule haut mir eine runter. Andreas war wenig beeindruckt, sondern spuckte mich erneut an. Im nächsten Augenblick hatte er meine Faust auf der Nase und ich muss sagen, ich machte das überzeugender als Mommy. Blut lief heraus und Andreas fiel auf den Rücken wie ein Käfer und heulte hemmungslos. Einer der Lehrer kam angerannt und wollte wissen, was los sei. Silke antwortete und ich erwartete, dass er mich ausschimpfen würde. Stattdessen sagte er: »Das wurde auch mal Zeit.« Mommy reagierte allerdings anders. Als ich ihr stolz erzählte: »Du, ich habe dem Andreas voll eine reingehauen«, war sie bestürzt. »Aber du hast mir doch gezeigt, wie ich es machen soll«, wehrte ich mich. Doch sie meinte: »Ja schon. Aber doch nicht so doll! Nicht, dass er blutet!«
Zwei Jahre später schwang ich nochmals die Fäuste. Wieder war Silke der Grund. Sie war nicht schlanker geworden und weil auch meine Eltern immer dicker wurden, bezog ich die Hänseleien der Mitschüler auf sie. Dieses Mal war der Angreifer ein Mädchen und sie hatte bei Weitem mehr Kampfgeist als Andreas. Büschelweise riss sie mir die Haare aus, aber ich blieb ihr nichts schuldig. Am Ende hockte ich auf ihren Schultern und schrie sie an: »Du nimmst alles zurück und entschuldigst dich bei Silke!«, während meine Klassenkameraden um uns herumstanden und applaudierten. Doch ich fühlte mich schlecht dabei und es war zum Glück das letzte Mal, dass ich meine Argumente mit Schlägen unterstreichen musste.
Kurze Zeit später wurde ich krank. In dem kalten, feuchten Haus in Konz waren meine Bronchien stets angegriffen gewesen, die Nebenhöhlen immer entzündet. Nun gesellte sich zu meiner permanenten Erkältung eine schwere Neurodermitis. Meine Haut juckte wie verrückt, ich bekam überall rote Ausschläge. Psychischer Stress ist ein nicht zu unterschätzender Auslöser dieser Hautkrankheit. Ob unser Hausarzt das auch so sah, weiß ich nicht, aber er traf eine gute Entscheidung: sechs Wochen lang sollte ich zur Kur fahren. »Klasse«, dachte ich einerseits, »dann brauche ich nicht mehr zur Schule.« Andererseits: »Was wird aus meinem Ballettunterricht? Und aus Elisabeth?« Denn kaum war der Unterricht aus, sauste ich nach Hause. Daddy war unterwegs und Mommy hatte alle Hände voll zu tun mit ihren Klavierschülern, deshalb hieß es: »Um Elisabeth musst du dich kümmern, du musst auf deine Schwester aufpassen.« Für mich war das kein Muss, ich tat es gern. Am liebsten setzte ich sie in den Kinderwagen und trällerte ihr stundenlang Bass-arien von Daddy in meinem Kindersopran vor. Gingen mir die Lieder aus, kamen selbst erdachte Theaterstücke an die Reihe. Weil wir kein Spielzeug besaßen, musste ich erfinderisch sein. Zum Glück war Elisabeth ein Publikum, von dem man nur träumen konnte: Begeistert klatschte sie in ihre kleinen Hände und lachte aus vollem Hals. Dabei trug sie einen Klopapierüberzug als Mütze, was wiederum mich zum Lachen brachte. Zu dieser außergewöhnlichen Kopfbedeckung war sie beim Kirchenbasar gekommen. Ein paar ältere Damen der Gemeinde verkauften dort neben vielen anderen Dingen selbstgehäkelte Klopapierüberzüge. So etwas hatten die Leute zu dieser Zeit in der Heckablage ihrer Autos. Es muss eine deutsche Erfindung gewesen sein; Mommy kannte sie jedenfalls nicht.
»Oh, wie nett. Ein Hütchen für Elisabeth!«, juchzte sie und kaufte den Überzug. Von nun an trug ihn meine Schwester auf dem Kopf, während ich sie mit meinem Unterhaltungsprogramm bei Laune hielt. Das Hütchen hat ihr nicht geschadet, anders als ein paar Streiche, die ich ihr spielte. Zwar wurde ich zur Furie, wenn ein fremder Lausebengel einen Wurm in ihre Windel stopfte. Das hielt mich aber nicht davon ab, selbst eine tote Fliege vom Fensterrahmen zu picken, sie in eine Banane zu stecken und Elisabeth erst davon zu berichten, nachdem sie Frucht und Fleischeinlage verputzt hatte. Das kriege ich heute noch zu hören: Bei jedem Familienfest kommt mindestens einmal das Thema »Tote Fliege in meiner Banane« auf den Tisch. Allen meinen Streichen zum Trotz entwickelte ich ein großes Verantwortungsbewusstsein. Ich fühlte mich verpflichtet, für ihr Glück zu sorgen und schlüpfte hundertprozentig in die Rolle einer Mutter. Und die sollte ich jetzt aufgeben wegen einer Kur?
Mommy tröstete mich: »Dafür geht es dir danach besser«, versprach sie. »Und Borkum gefällt dir bestimmt.«
Borkum? Wo war das denn? Wir waren noch nie irgendwohin in Urlaub gefahren, geschweige denn ans Meer. Das konnte vielleicht wirklich aufregend werden! Und auch noch auf eine Insel! Ich wog ab und gewöhnte mich an den Gedanken, sechs Wochen in der Fremde ganz ohne Familie auszukommen. Kürzlich habe ich gehört, dass Borkum mittlerweile Europas erste allergikerfreundliche Insel ist, zertifiziert von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung. Als ich im Jahr 1982 dort Nordseeluft schnupperte, war das noch nicht der Fall. Doch die Kur zeigte auch so Wirkung und als ich nach Hause zurückkehrte, ging es mir besser. Zwar machte die Schule weiterhin keinen Spaß, aber ich kämpfte mich von einer Klasse zur nächsten. Dann wurde meine damals beste Freundin Andrea krank. Im Gegensatz zu mir hatte sie alle schulischen Talente, die man sich wünschen konnte. Dazu war sie bildhübsch. Sie war oft bei mir zu Hause, ich war oft bei ihr zu Hause. Ihr Papa arbeitete als Lastwagenfahrer, ihre Mama war Putzfrau und ich liebte das wohlgeordnete Leben, das ihre Familie führte. Nun war sie krank und danach sollten sich unsere Wege trennen: Ich wechselte aufs Auguste-Viktoria-Gymnasium, eine altehrwürdige Schule, die 1879 gegründet worden war, während sie auf ein anderes Gymnasium gehen sollte. Es nahm mich total mit, dass wir uns aus den Augen verloren. Viele Jahre später hörte ich, dass Andrea in einer psychiatrischen Klinik behandelt worden war. Ihre Talente und ihr Ehrgeiz hatten sich in einer Magersucht niedergeschlagen. Ich rief sie an, als sie die Klinik verlassen durfte, doch ruhiggestellt durch Medikamente konnte sie kaum sprechen. Wieder blieben wir getrennt, bis eines Tages das Telefon läutete. Ich hatte gerade meine Gesangskarriere begonnen und jetzt war meine alte Freundin Andrea am Telefon und erzählte im Überschwang, dass sie in Kürze heiraten werde.
»Singst du auf meiner Hochzeit?«, bat sie mich. Es sollte nicht so weit kommen. Eine Woche später sprang sie aus einem Fenster des Krankenhauses, wo sie erneut behandelt worden war. Als ich davon erfuhr, war ich wochenlang am Boden zerstört und frage mich immer wieder: Wäre ihr Freitod nicht zu verhindern gewesen? Vielleicht hätte ich etwas ausrichten können?
Das Ballett und eine Begegnung, die mein späteres Leben prägen sollte, waren ein Rettungsanker. Mitten in der Innenstadt von Trier gab es eine kleine Parfümerie. Schon häufig war ich daran vorbeigegangen, ohne mich zu trauen, einzutreten. Manchmal blieb ich stehen, wenn sich die Tür öffnete und eine Kundin herauskam. Dann sog ich die Düfte ein, die plötzlich in der Luft lagen. Ich weiß nicht mehr, was mich dazu bewog, einen dieser Augenblicke zu nutzen und einfach einzutreten. Schon im nächsten Moment kam es mir vor, als habe ich das Paradies betreten. Eine kleine zarte Frau fragte nach meinen Wünschen. Das war Irma Bohn, die Inhaberin. Wünsche hatte ich keine, zumindest nicht solche, die sie erfüllen konnte. Ich hatte kein Geld, um mir etwas zu kaufen, trotzdem kam ich immer wieder. Nachdem ich meine anfängliche Scheu überwunden hatte, nutzte ich jede Gelegenheit zu einem kleinen Abstecher. Nach und nach freundete ich mich mit Irma Bohn an. Manchmal gab sie mir einen Tester mit und einmal eine hübsch eingepackte Geschenkschachtel mit Cremes, Lippenstift und Wimperntusche. Was war das für ein Fest, als ich am Wochenende meine Freundinnen, Mommy und mich selbst schminkte. Mommy war mittlerweile aufgefallen, dass ich mehr und mehr Zeit in der Parfümerie zubrachte. Sie selbst hatte kaum Kosmetik zu Hause, aber neugierig geworden, begleitete sie mich beim nächsten Besuch. So freundete auch sie sich mit Irma Bohn an. Nun gab es bei uns zu Weihnachten eine alte Familien-tradition: Nie feierten wir nur unter uns, sondern luden am Heiligabend einen Menschen ein, der allein war. Das war bei Irma Bohn der Fall. Sie war Witwe und hatte keine Angehörigen in Trier und so kam es, dass sie das Weihnachtsfest bei uns verbrachte. Damals trat mein Herzenswunsch ans Tageslicht, Frauen verwöhnen zu wollen – doch war das nicht mehr als eine nebulöse Idee, die von meinen Schulsorgen bald wieder in den Hintergrund gedrängt wurde.