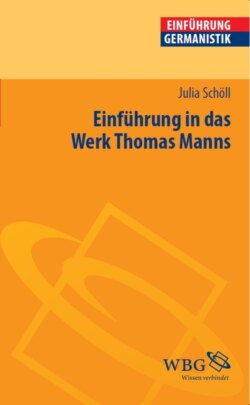Читать книгу Einführung in das Werk Thomas Manns - Julia Schöll - Страница 10
2. Erster Weltkrieg und Weimarer Republik
ОглавлениеZustimmung zum Ersten Weltkrieg
Thomas Mann selbst leistet im Jahr 1900 nur wenige Wochen Wehrdienst und wird dann wegen einer Sehnenscheidenentzündung aus der Armee entlassen, auch am Ersten Weltkrieg wird er nicht als Soldat teilnehmen. Umso enthusiastischer stimmt er vom Schreibtisch aus in die allgemeine Kriegsbegeisterung ein, um als Ausgemusterter wenigstens einen geistigen Beitrag zu leisten. Ab 1914 entstehen die Aufsätze Gedanken im Kriege und Gute Feldpost sowie eine Reihe weiterer essayistischer Schriften, in denen sich der Autor für den Krieg ausspricht, ihn gar zum heiligen Mittel der Reinigung und Befreiung der Nation stilisiert und als Versöhnung von Geist und Leben feiert – eine aus heutiger Perspektive ebenso kurzsichtige wie irritierende Position (Kurzke 1999, 236ff.).
Politische Konfrontation mit Heinrich
Zwar hatten die Brüder um 1900 nationalkonservative Ansichten geteilt – beide hatten in Das Zwanzigste Jahrhundert publiziert –, doch nun erkennt Heinrich, was dem Bruder im kriegstreiberischen Pathos entgeht: die Gefährlichkeit der Geisteshaltung, die diesem Krieg zugrunde liegt und die sich bis zum Beginn des Dritten Reiches radikalisieren wird. Im Gegensatz zu seinem Bruder spricht sich Heinrich Mann explizit und deutlich gegen Krieg und Nationalismus aus. Eine erneute Konfrontation der Brüder ist somit vorprogrammiert, zumal die Rolle als dichterischer ‚Soldat‘ Thomas Mann die Möglichkeit gibt, sich als deutscher Nationalschriftsteller in Stellung zu bringen. Der Aufsatz Betrachtungen eines Unpolitischen, an dem Thomas Mann von Herbst 1915 bis Frühjahr 1918 arbeitet und für den er die Arbeit am Zauberberg unterbricht, wächst sich zu einem Monumentalessay und zur großen Abrechnung mit Heinrich, dem „Zivilisationsliteraten“, aus. Der Text ist, so Hermann Kurzke, das Zeugnis eines „Bruderkriegs“ (Kurzke 1999, 252). Ein Versuch der Annäherung 1917 scheitert. Erst 1922, nach Thomas Manns Bekenntnis zur Weimarer Republik, erfolgt die Versöhnung.
Schaffen nach 1918
Auf Seiten der literarischen Arbeit entstehen 1918/19 die Idylle Herr und Hund sowie der lyrische Text Gesang vom Kindchen. Im April 1919 nimmt Thomas Mann nach vierjähriger Unterbrechung die Arbeit am Zauberberg wieder auf. Außerdem entstehen 1921 der Vortrag Goethe und Tolstoi und der Aufsatz Zur jüdischen Frage. Bis zum Herbst 1924 arbeitet Thomas Mann am Roman Der Zauberberg, der noch im gleichen Jahr erscheint; es folgen 1925 die Erzählungen Unordnung und frühes Leid und 1929 Mario und der Zauberer. Nach einer Ägyptenreise 1925 – eine weitere unternimmt er 1930 – beginnt Thomas Mann 1926 mit den Vorbereitungen zum Roman Joseph und seine Brüder, der ihn viele Jahre begleiten wird.
Karrieren der Kinder
Während 1918 und 1919 die Kinder Elisabeth und Michael geboren werden, sind die älteren Kinder schon fast flügge. Erika arbeitet in der Zeit der Weimarer Republik als Schauspielerin, Autorin und Journalistin und gründet kurz vor dem Exil das Kabarett Die Pfeffermühle. Klaus Mann wird ebenfalls Autor und Publizist, Golo Wissenschaftler und später Professor. Auch Monika Mann wird sich, wenn auch wenig erfolgreich, als Schriftstellerin versuchen; Elisabeth wird Meeresbiologin, der Jüngste, Michael, als Musiker arbeiten.
Aufstieg zum ‚Nationalschriftsteller‘
Die Bekanntschaft Thomas Manns im Jahr 1927 mit dem jungen Klaus Heuser mündet in eine neue homoerotische Leidenschaft; auch sie beschränkt sich auf die Phantasie. 1923 stirbt Thomas Manns Mutter, 1927 Schwester Julia. Thomas Mann selbst avanciert in dieser Zeit tatsächlich zum ‚Nationalschriftsteller‘: 1919 verleiht die Universität Bonn ihm, dem Autodidakten ohne Abitur, die Ehrendoktorwürde. 1925 begeht Thomas Mann, begleitet von privaten wie öffentlichen Ehrungen, seinen 50. Geburtstag. Im Dezember 1929 wird ihm in Stockholm die höchste literarische Auszeichnung, der Nobelpreis für Literatur verliehen.
Bekenntnis zur Weimarer Republik
Hermann Kurzke weist darauf hin, dass Thomas Manns Bekenntnis zur Weimarer Republik und der damit verbundene Abschied von der nationalkonservativen Haltung natürlich nicht über Nacht erfolgen, sondern das Ergebnis eines langwierigen und schwierigen Prozesses darstellen (Kurzke 1999, 272). Spätestens mit dem Essay Kultur und Sozialismus von 1927 tut Thomas Mann seine neue Haltung auch öffentlich kund. Es folgen wichtige politische Auftritte, in denen er sich für Demokratie und republikanische Vernunft einsetzt, unter anderem im Vortrag Deutsche Ansprache (1930), Rede vor Arbeitern in Wien (1932) und Bekenntnis zum Sozialismus (1933).
Warnungen vor dem Nationalsozialismus
Die polemische Gegenreaktion der ‚Völkischen‘, die Thomas Mann in seinen Texten scharf angreift, erfolgt prompt (Kurzke 1999, 362f.). Am 17. Oktober 1930 hält er im Berliner Beethovensaal die Rede mit dem Titel Deutsche Ansprache. Ein Appell an die Vernunft, in der er zu einer Vereinigung sozialdemokratischer und konservativer Kräfte aufruft, um den Nationalsozialismus zu bekämpfen. Ein Trupp von intellektuellen (u.a. Arnolt Bronnen und Ernst Jünger) und paramilitärischen Störern evoziert daraufhin einen Eklat und erzwingt das vorzeitige Ende des Vortrags (Prater 1995, 256f.). Trotz dieser bedrohlichen Zeichen hält Thomas Mann den Nationalsozialismus zu diesem Zeitpunkt noch für ein vorübergehendes, wenn auch gefährliches Phänomen; wenig später wird ihn Hitlers Regime um Heimat und Besitz bringen.