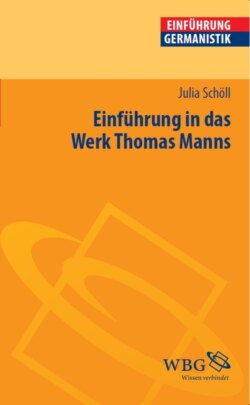Читать книгу Einführung in das Werk Thomas Manns - Julia Schöll - Страница 12
4. Nachkriegszeit und Rückkehr nach Europa
ОглавлениеKriegsende
Am 7. Mai 1945 erfolgt die Kapitulation Deutschlands. Thomas Manns Freude ist jedoch verhalten. Im Tagebuch notiert er an diesem Tag: „Ist dies nun der Tag, korrespondierend mit dem 15. März 1933, als ich diese Serie von täglichen Aufzeichnungen begann, – also ein Tag feierlichster Art?/Es ist nicht gerade Hochstimmung, was ich empfinde. Natürlich ist die gegenwärtige deutsche Regierung nur episodisch, Instrument der Kapitulation […]. Übrigens aber/wird dies oder das mit Deutschland, aber nichts in Deutschland geschehen,/und bis jetzt fehlt es an jeder Verleugnung des Nazitums, jedem Wort, daß die ‚Machtergreifung‘ ein fürchterliches Unglück, ihre Zulassung, Begünstigung ein Verbrechen ersten Ranges war.“ (TB 1944–1.4.1946, 200)
Kontroverse mit Walter von Molo
Thomas Mann war von einer Schuld aller Deutschen an den nationalsozialistischen Verbrechen überzeugt – eine Haltung, die bereits zuvor in den Debatten mit anderen Exilanten zu Konflikten geführt hatte. Die Distanz zu Deutschland blieb entsprechend groß, wie an Thomas Manns Brief nach Deutschland vom September 1945 deutlich wird, der unter dem Titel Warum ich nicht nach Deutschland zurückgehe bekannt wurde. Mit diesem Text antwortete Mann auf einen offenen Brief Walter von Molos, in dem dieser ihn zur Rückkehr aufgefordert hatte. Das „Herzasthma des Exils, die Entwurzelung, die nervösen Schrecken der Heimatlosigkeit“, so Thomas Manns Erwiderung, hätten die zuhause Gebliebenen nicht gekannt (GKFA 19.1, 73). Der Brief enthält, neben dem Bild des „Herzasthmas“, noch eine weitere berühmt gewordene Aussage Thomas Manns, nämlich die Äußerung seines Abscheus gegenüber der während des Dritten Reichs in Deutschland erschienenen Literatur: „Ein Geruch von Blut und Schande haftet ihnen [diesen Büchern] an; sie sollten alle eingestampft werden.“ (GKFA 19.1, 76) Der Exilant traf auf wenig Verständnis auf Seiten der Beschuldigten, vielmehr erklärten sich bald die Autoren der so genannten „Inneren Emigration“ gegenüber den Emigrierten zu den ‚besseren Deutschen‘. Auch Molos offener Brief an Thomas Mann, so die These von Hans Rudolf Vaget, war von Anfang an mit dem Ziel verfasst und publiziert worden, die in Deutschland Verbliebenen vom Vorwurf der Kollektivschuld frei zu sprechen (Vaget 2011, 484ff.).
Goethejahr 1949
Nach schwerer Krankheit und einer Lungenkrebsoperation im Jahr 1946 schließt Thomas Mann im Januar 1947 die Arbeit an Doktor Faustus ab. Im gleichen Jahr unternimmt er eine erste Reise nach Europa, wobei er Deutschland allerdings nicht besucht. Erst im Goethejahr 1949 reist er in die alte Heimat und hält den Vortrag Ansprache im Goethejahr 1949 zunächst in Frankfurt am Main, anschließend in Weimar, wobei die Tatsache, dass er auch die Sowjetische Besatzungszone besucht, zum Anlass neuer Anfeindungen gegen den vermeintlichen „Deutschenhasser“ (GKFA 19.2, 765) wird (Kurzke 1999, 541ff.).
Spätwerk
Neben der Rede zu Goethes zweihundertstem Geburtstag entsteht 1949 auch der Essay Goethe und die Demokratie. Bereits seit Anfang 1948 arbeitet Thomas Mann zudem am Roman Der Erwählte, den er im Oktober 1950 abschließt. Im Dezember 1950 greift er den Stoff des Felix Krull wieder auf und schreibt den Roman ab Januar 1951 weiter. Der erste Teil war 1922 erschienen, die Fortsetzung wird 1954 veröffentlicht. 1952 erscheint neben dem Essayband Altes und Neues der Aufsatz Der Künstler und die Gesellschaft, ab August 1954 arbeitet Mann an dem umfangreichen Essay Versuch über Schiller. Ab dem Jahresbeginn 1955 beschäftigt er sich mit den Vorarbeiten zu einem geplanten Drama mit dem Titel Luthers Hochzeit, das nicht mehr vollendet wird.
Rückkehr in die Schweiz
In den Jahren 1950 und 1951 reist Thomas Mann wieder nach Europa; nach einer erneuten Reise 1952 entschließen sich Thomas und Katia Mann spontan, in Zürich zu bleiben. Zu unwirtlich war das politische Klima in den seit 1950 vom McCarthyism geprägten Vereinigten Staaten geworden. Unter anderem hatte sich Thomas Mann mit dem Besuch der Goethe-Feier in Weimar einer zu großen Nähe zum Kommunismus verdächtig gemacht. Das FBI lässt ihn, wie fast alle prominenten Emigranten, akribisch überwachen (Vaget 2011, 391ff.). Schließlich verweigert ihm sogar die Library of Congress, an der Thomas Mann seit 1941 den von Agnes Meyer gesponserten Ehrenposten eines Beraters versah, seinen jährlichen Vortrag zu halten. Zu diesen politischen Gründen, der Angst vor einem amerikanischen Faschismus, kommen persönliche, vor allem der Wunsch Thomas Manns, sein Leben in Europa zu beenden und auch dort begraben zu werden. Das Thema Tod rückt ihm näher: 1949 hatte sich Sohn Klaus das Leben genommen, ebenfalls 1949 stirbt der Bruder Viktor, 1950 Heinrich Mann.
Tod am 12. August 1955
1954 bezieht das Ehepaar Mann sein letztes Wohnhaus in Kilchberg bei Zürich. Eine Niederlassung in Deutschland kommt für die Familie nicht in Frage. Neben den Ehrungen zum achtzigsten Geburtstag begehen Katia und Thomas Mann 1955 auch ihre Goldene Hochzeit. Am 12. August stirbt Thomas Mann im Züricher Kantonsspital nach kurzer Krankheit an den Folgen einer Thrombose. Entsprechend seinem Wunsch wird er auf dem Kilchberger Friedhof bestattet.