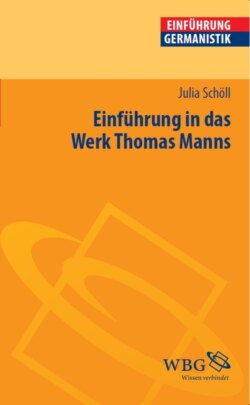Читать книгу Einführung in das Werk Thomas Manns - Julia Schöll - Страница 6
I. Der Mythos Thomas Mann
ОглавлениеDer Autor als Mythos
Thomas Mann ist ein Mythos, als Mensch wie als Autor. Die Anekdoten über seine Person und die Pauschalurteile über sein Werk, die immer und immer wieder kolportiert werden, sind vom realen Autor oder der tatsächlichen Gestalt seiner Texte längst abgekoppelt. Der Mythos beruht auf Wiederholung, doch er verändert sich auch im jeweiligen zeitgeschichtlichen Kontext. Es gab Zeiten, in denen es kaum möglich war, in Deutschland als Kulturschaffender keine Meinung zu Thomas Mann zu haben. Man verehrte ihn, betrachtete ihn als Vorbild – oder suchte sich so weit und so öffentlich wie möglich von ihm zu distanzieren. Mittlerweile, da Thomas Mann und seine Texte im kulturellen Gedächtnis der Deutschen fest verankert sind (Marx 2007, 114), hat sich die Lage entspannt. Doch bis heute geraten Menschen, nicht zuletzt Autoren, in Rage oder ins Schwärmen, spricht man sie auf Thomas Mann an.
Prozess der Mythenbildung
Es sind verschiedene Faktoren, die zur Mythenbildung um Autor und Werk beitragen: angefangen bei dem Umstand, dass Thomas Mann mit seinem ersten Roman Buddenbrooks (1901) einen Text von solch kompositorischer Raffinesse und sprachlicher Kraft vorlegt, dass man ihn einem 25-jährigen Autor nicht zutrauen würde, über die Verleihung des Nobelpreises im Jahr 1929 – der Nobelpreis selbst ist ein Mythos – bis hin zu späten Texten wie dem Roman Doktor Faustus, der den Deutschen im Bezug auf die Naziherrschaft den Spiegel vorhält. Die Tatsache, dass Thomas Mann selbst sich ab 1933 im Exil befindet und dort zu einem der wichtigsten Sprecher der deutschen Emigranten, zum Repräsentanten eines anderen, besseren Deutschlands avanciert, hat nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass die Deutschen sich gegenüber ihrem ‚Nationalschriftsteller‘ immer wieder positionieren müssen. In den 1920er Jahren hatte bereits Thomas Manns Abwendung vom Konservatismus und seine explizite Befürwortung der Weimarer Republik die Gemüter erregt. Später, im Goethejahr 1949, wird die Tatsache, dass Thomas Mann seinen Festvortrag sowohl in der BRD als auch in der DDR hält, zu Debatten und Anfeindungen führen. Auch wegen seiner Weigerung, nach 1945 nach Deutschland zurückzukehren, werden dem Exilanten Ressentiments entgegengebracht. Es sind immer wieder die „politischen Gesten“ Thomas Manns, so Hans Rudolf Vaget, welche die Deutschen zur Auseinandersetzung mit ihrer ‚Ikone‘ Thomas Mann nötigen (Vaget 2007, 151). Die These, Thomas Mann sei letztlich zeit seines Lebens ein ‚Unpolitischer‘ geblieben – auch das ein Teil des Mythos –, erscheint heute unhaltbar. Gerade Hans Rudolf Vagets Forschung hat in jüngerer Zeit immer wieder deutlich gemacht, in welch hohem Maß auch die kulturtheoretischen Äußerungen Thomas Manns politisch kodiert sind (u.a. Vaget 2006, 2007).
Projektionen
Inzwischen begeht man in Deutschland Thomas-Mann-Gedenkjahre. Das Jahr 2005, zum Anlass des 50. Todestages, bot Gelegenheit, sich mit den Vorurteilen und Urteilen über Thomas Mann ausführlich auseinanderzusetzen. Manfred Dierks etwa erinnerte sich daran, dass der Autor bereits in den 1950er Jahren „ein Standbild – ein Denkmal“ gewesen sei: „als der Antifaschist, der Demokrat, vor allem aber der Bewahrer, Aufbewahrer der deutschen Kultur in der Fremde. Als Schriftsteller: der letzte deutsche Autor, der sich noch auf ein geschlossenes Werk verstanden hat.“ (Dierks 2007, 77) Auch dieses Bild vom „geschlossenen Werk“ hat inzwischen, nicht zuletzt durch die Dekonstruktion, Risse bekommen. Hermann Kurzke bringt den ‚Mythos Thomas Mann‘ 1977 auf die Formel: „der letzte Deutsche, der letzte Bürger und der letzte Universalschriftsteller.“ (Kurzke 1977, 13) Sowohl Dierks als auch der spätere Biograph Thomas Manns, Hermann Kurzke, sind sich bei ihren Aussagen natürlich bewusst, dass dieser Mythos auf Projektion beruht – dass die Deutschen in Thomas Mann sehen, was sie jeweils sehen wollen. Die aktuelle Thomas-Mann-Forschung zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass sie diese Projektionen nicht nur in ihre Überlegungen einbezieht, sondern sie explizit zu ihrem Gegenstand macht.
Selbstinszenierungen
Auffallend ist, dass bei der Verklärung oder Verteufelung Thomas Manns zumeist er selbst, nicht seine Literatur im Vordergrund steht. An dieser Fixierung auf seine Person ist Thomas Mann nicht ganz unschuldig, hat er doch in zahlreichen autobiographischen Essays immer wieder die eigene Existenz – als Autor, aber auch als Bürger, Lübecker, Bruder, Ehemann, Familienvater, Exilant, politischer Repräsentant etc. – in den Fokus gerückt (siehe v.a. GW XI). Diese Texte sind Zeugnisse der Selbststilisierung wie der Selbstkritik, sie dokumentieren das ironische Spielen mit der eigenen Rolle ebenso wie das ernsthafte Bemühen, das eigene Dasein im Kontext der Zeitgeschichte zu verstehen. In dem frühen autobiographischen Text Im Spiegel (1907) etwa findet sich die viel zitierte Selbsteinschätzung des jungen Autors, der Dichter sei „ein auf allen Gebieten ernsthafter Tätigkeit unbedingt unbrauchbarer, einzig auf Allotria bedachter, dem Staate nicht nur nicht nützlicher, sondern sogar aufsässig gesinnter Kumpan“, ein „anrüchiger Charlatan, der von der Gesellschaft nichts anderes sollte zu gewärtigen haben […] als stille Verachtung.“ (GKFA 14.1, 184) Das ist Spiel, Selbstironie, posing, auch wenn die Verachtung des Bürgers für den Künstler, die hier referiert wird, wohl auch die eigene Selbstverachtung kaschieren soll. Ganz anders liest sich die Autoreflexion des Autors in einem späten Essay wie Meine Zeit (1950), in dem er von seiner Person abstrahiert und das eigene Leben bewusst im Spiegel der Geschichte betrachtet. Die Selbstskepsis wird hier nicht mehr ironisch kommuniziert, sie gibt sich demütig: „[…] selten wohl ist die Hervorbringung eines Lebens – auch wenn sie spielerisch, skeptisch, artistisch und humoristisch schien – so ganz und gar, vom Anfang bis zum sich nähernden Ende, eben diesem bangen Bedürfnis nach Gutmachung, Reinigung und Rechtfertigung entsprungen, wie mein persönlicher und so wenig vorbildlicher Versuch, die Kunst zu üben.“ (GW XI, 302)
Jenseits der Masken
Die Bilder Thomas Manns sind so verschieden wie seine Selbstbilder. Was ‚authentisch‘, was Stilisierung ist, lässt sich nicht auseinander dividieren. Theodor W. Adorno, der Berater Thomas Manns in musikalischen Fragen während der Arbeit am Roman Doktor Faustus, hat schon 1962 davor gewarnt, den Autor Thomas Mann mit dem Nimbus seiner Texte oder seinen öffentlichen Masken zu verwechseln: „Das Verständnis Thomas Manns: die wahre Entfaltung seines Werkes wird erst anfangen, sobald man um das sich kümmert, was nicht im Baedeker steht.“ (Adorno 1973, 20) Eine Einführung in das Werk Thomas Manns kann hierzu allenfalls einen kleinen Beitrag leisten.