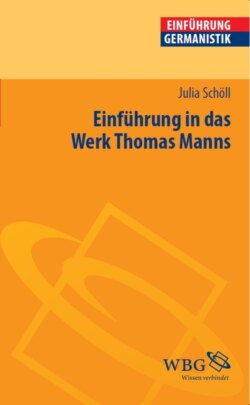Читать книгу Einführung in das Werk Thomas Manns - Julia Schöll - Страница 7
II. Die Thomas-Mann-Forschung
ОглавлениеReges Forschungsinteresse
Das wohl Erstaunlichste, was es von der Thomas-Mann-Forschung zu berichten gibt, ist die Tatsache, dass das wissenschaftliche Interesse an den Texten des Autors nicht nachlässt; im Gegenteil. Heute, fast sechzig Jahre nach seinem Tod, ist diese Forschung lebendiger denn je. Die Texte haben von ihrer Faszinationskraft nichts verloren. Jede neue Generation von Wissenschaftlern entdeckt neue Lesarten und neue theoretische Zugänge – und schafft sich auf diese Weise auch ein je neues Bild des Autors Thomas Mann. Die Forschungsliteratur ist bis heute in einem Maße angewachsen, dass sie überblicken zu wollen, ein vermessenes Ziel wäre. Hermann Kurzke spricht bereits 1977 von der „kaum noch überschaubaren Literatur zu Thomas Mann“ (Kurzke 1977, 23). Was den Umfang des wissenschaftlichen Outputs betrifft, ist die Thomas-Mann-Forschung allenfalls mit der Goethe-Forschung vergleichbar. Vielen Doktorarbeiten zu Thomas Mann ist die Verzweiflung über die schier unbewältigbare Flut an Sekundärtexten anzumerken, die sich nur schwer in Forschungsberichten zusammenfassen lässt. Dennoch sind in der Thomas-Mann-Forschung natürlich Tendenzen auszumachen, die im Folgenden umrissen werden sollen.
Forschung zu Lebzeiten
Die Forschung zur Literatur und Person Thomas Manns beginnt schon zu Lebzeiten. Zu vielen Texten erscheinen bereits kurze Zeit nach ihrem Erscheinen wissenschaftliche Beiträge, die Thomas Mann – davon zeugen seine Korrespondenz sowie die Tagebücher – jeweils aufmerksam zur Kenntnis nimmt, oft auch brieflich kommentiert. Fast keine dieser Interpretationen spielt im aktuellen Forschungszusammenhang noch eine Rolle. Dieser Umstand ist zum einen der Tatsache geschuldet, dass diese Arbeiten den jeweiligen Text noch nicht im Kontext des Gesamtwerks beleuchten konnten, zum anderen war vielfach die Nähe zum Autor noch zu groß. Der erste Biograph etwa, Peter de Mendelssohn, ist ein enger Freund der Familie Mann. Seine Biographie erscheint zwar erst 1975, zwanzig Jahre nach dem Tod Thomas Manns (und umfasst dann nur die Jahre bis 1918; siehe Kapitel III.), doch ist ihr die große Verehrung, die Mendelssohn dem Autor entgegenbrachte, noch deutlich anzumerken.
Selbstdeutungen
Für die Forschung bis 1975 stellt Hans Wißkirchen fest, sie habe sich weitgehend in den „Spuren der Selbststilisierung Thomas Manns“ bewegt (Wißkirchen 2005, 23). Solche „Spuren“ hat der Autor sehr zahlreich gelegt. Wie kaum ein anderer Schriftsteller hat Thomas Mann das eigene Werk immer wieder selbst interpretiert und seine eigene Lesart auch anderen angetragen. Schon bei seinem ersten Roman Buddenbrooks gibt er seinem Freund Otto Grautoff detaillierte Anweisungen für zu schreibende Rezensionen. Selbst den Grundtenor der Besprechung versucht er dem Rezensenten vorzugeben: „Ein paar Winke noch, Buddenbrooks betreffend. Im Lootsen sowohl wie in den Neuesten betone, bitte, den deutschen Charakter des Buches. […] Tadle ein wenig (wenn es Dir recht ist) die Hoffnungslosigkeit und Melancholie des Ausganges.“ Und er schließt seinen Brief vom 26. November 1901 an den Freund: „Damit genug! Mach Deine Sache recht gut und verschiebe sie nicht zu lange.“ (SK BB, 20)
Geschichte der Thomas-Mann-Forschung
Thomas Manns Deutungen des eigenen Werks lassen sich komprimiert in den Bänden der Reihe Thomas Mann Selbstkommentare nachlesen, die im Fischer Taschenbuchverlag erscheinen. Die frühe Thomas-Mann-Forschung folgt den Vorgaben des Autors zwar nicht ausschließlich, allerdings bezieht sie ihre Quellenforschung und Archivarbeit doch auffallend auf die von Mann eingespurten Themen (Wißkirchen 2005, 24). Doch muss man diesen Arbeiten zugutehalten, dass sie eine solide Basis für die weitere Forschung erarbeiteten und sich auch der Themen annahmen, die heute kaum noch behandelt werden, zum Beispiel der dezidierten Sprachanalysen der literarischen Texte Manns. Mit der antiautoritären Bewegung der späten 60er Jahre, die deutlich in die Germanistik hineinwirkte, hätte sich auch die Thomas-Mann-Forschung von der Ikone des Autors emanzipieren können. Doch der als bürgerlich deklarierte Thomas Mann trifft auf nicht allzu viel Interesse bei den jungen Vertretern der Studentenbewegung. Gleichwohl lässt sich ein verstärktes Interesse an der politischen Rolle Thomas Manns für diese Zeit konstatieren (Kurzke 1977, 10).
Forschung seit 1975
Das Jahr 1975 stellt insofern eine Zäsur innerhalb der Thomas-Mann-Forschung dar, als sich mit der Öffnung der Tagebücher zwanzig Jahre nach dem Tod des Autors neue Perspektiven eröffneten (siehe Kapitel III.). Auch die Tatsache, dass immer weniger der forschenden Wissenschaftler Thomas Mann persönlich gekannt hatten, vergrößerte die sachliche Distanz zum Gegenstand. Im Jahr 1977 kritisierte Hermann Kurzke, dass die Thomas-Mann-Forschung bei hoher Detailverliebtheit zu wenig Gesamtdeutungen und Kontextanalysen liefere (Kurzke 1977, 18f.). Dieses Urteil trifft auf die aktuelle Forschung nicht mehr zu. Die Forschungsergebnisse für den Zeitraum 1976 bis 1983 fasst erneut Hermann Kurzke in einem Überblicksband zusammen (Kurzke 1985). Ein 2008 erschienener Band von Heinrich Detering und Stephan Stachorski stellt „neue Wege der Forschung“ für den Zeitraum 1977 bis 2004 vor (Detering/Stachorski 2008). Die jährlichen Herbsttagungen der Deutschen Thomas Mann-Gesellschaft (sowie die alle zwei Jahre stattfindenden Davoser Literaturtage) haben mittlerweile zahlreiche Verbindungen zwischen Thomas Manns Literatur und den Diskursen der Zeit sowie den Texten anderer Autoren erschlossen. Zu nennen wären hier etwa die Tagungsthemen „Thomas Mann und das Judentum“ (2002), „Thomas Mann und das Theater“ (2007), „Thomas Mann und die Medien“ (2009), „Der Zauberer und die Phantastik“ (2010) oder „Thomas Mann und das Mittelalter“ (2011). Die Ergebnisse der Tagungen werden jeweils im Thomas Mann Jahrbuch publiziert.
Aktuelle Tendenzen
Die jüngste Forschung widmet sich neuen Aspekten im Werk Thomas Manns, analysiert dessen Texte auf der Grundlage aktueller Literatur- und Kulturtheorien und stellt sie in historische, gesellschaftliche, politische, kulturelle und dezidiert literarische Zusammenhänge, die bislang wenig oder nicht erschlossen wurden. Es werden etwa die Körper- und Geschlechterbilder der Literatur Thomas Manns ergründet, der Bezug zu den Naturwissenschaften und der Medizin hergestellt, die politischen und kulturtheoretischen Texte in den Fokus gerückt, moderne Text-und Bildtheorien auf das Werk angewandt oder Neuinterpretationen aus der Perspektive der Dekonstruktion unternommen.
Institutionen der Thomas-Mann-Forschung
Zentrale Bedeutung für die Erforschung des Werks Thomas Manns kommt bis heute den Archiven und Gesellschaften zu. Bereits ein Jahr nach Manns Tod entstand die erste literarische Gesellschaft, die sich seines Werks annahm: die bis heute bestehende Thomas Mann Gesellschaft Zürich. 1965 wurde die Deutschen Thomas Mann-Gesellschaft gegründet, die ihren Sitz in Lübeck hat und seit 2008 bzw. 2012 Ortsvereine in Bonn und Berlin unterhält. 1999 wurde außerdem der Thomas-Mann-Förderkreis München gegründet. Das Herz der Thomas-Mann-Forschung bildet nach wie vor das Thomas-Mann-Archiv an der ETH Zürich, das den Nachlass Thomas Manns hütet. Neben rund 30.000 Seiten an Manuskripten, Briefen, unveröffentlichten Notizen etc. finden sich hier auch Sekundärliteratur, Werkausgaben aus aller Welt und Presseausschnitte. Zudem ist in den Räumen des Züricher Thomas-Mann-Archivs die Ausstattung des letzten Arbeitszimmers des Autors ausgestellt, so auch die Nachlassbibliothek, in der man die Anstreichungen und Notizen einsehen kann, die Thomas Mann in seinen Büchern vornahm. Neben Zürich gibt es in Düsseldorf mit der Sammlung Dr. Hans-Otto Mayer und in Augsburg mit der Sammlung Jonas umfangreiche Bestände mit Publikationen von und zu Thomas Mann. Ein Ort der Forschung und des Austauschs ist auch das Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum des Buddenbrookhauses in Lübeck, das zudem den Sitz der Deutschen Thomas Mann-Gesellschaft beherbergt. Außerdem finden sich Manuskripte und Autographen in den USA, wo Thomas Mann lange lebte, so etwa in der Beinecke Rare Book & Manuscript Library an der Yale University.
Große kommentierte Ausgabe
Seit dem Jahr 2000 erscheint die neue und maßgebliche Große kommentierte Frankfurter Ausgabe (GKFA), die sukzessive die Gesammelten Werke als zitierfähige Ausgabe ablöst. Sie wird – wie alle Texte Thomas Manns – im Frankfurter S. Fischer Verlag publiziert, der seit 1897 der Verlag des Autors ist und über die Publikationsrechte wacht. Die GKFA, die von einem Konsortium internationaler Forscher ediert wird, ist auf 38 Bände angelegt, die jeweils aus einem Text- und einem umfangreichen Kommentarband bestehen. Sie folgt modernen Editionsprinzipien, ist aber keine historisch-kritische Ausgabe, da die meisten Texte zweifelsfrei überliefert sind und man sich auf Handschriften und autorisierte Erstausgaben stützen kann.