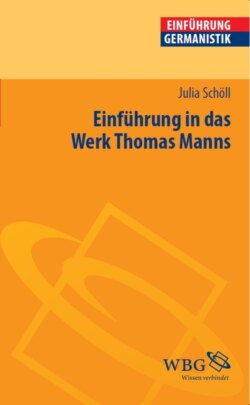Читать книгу Einführung in das Werk Thomas Manns - Julia Schöll - Страница 11
3. Exil in der Schweiz und den USA
ОглавлениеBeginn des Dritten Reichs
Hitler wird am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt. Am 10. Februar 1933 hält Thomas Mann in der Münchner Universität zum 50. Todestag Dritten Reichs Wagners den Vortrag Leiden und Größe Richard Wagners. Am folgenden Tag verlässt er Deutschland, um den Vortrag in Amsterdam, Brüssel und Paris zu widerholen. Es schließt sich ein bereits zuvor geplanter Urlaubsaufenthalt in der Schweiz an. Am 15. März 1933 beginnt er in Arosa die privaten Aufzeichnungen, die wir heute als sein Exiltagebuch kennen.
Exil
Gewarnt von seinen erwachsenen Kindern kehrt Thomas Mann mit Ehefrau Katia und den jüngeren Kindern nicht nach München zurück – unversehens und ungeplant verwandelt sich der Urlaubsaufenthalt in ein Exil. Nach mehreren Reisen und einem langen Sommeraufenthalt im französischen Sanary-sur-mer, wo sich bereits eine ganze Reihe exilierter deutscher Intellektueller versammelt hat, kehrt die Familie im September 1933 in die Schweiz zurück und lässt sich – nun im Bewusstsein, dass die Abwesenheit aus Deutschland länger währen wird – in einem Haus in Küsnacht bei Zürich nieder, wo sie bis zu ihrer Übersiedlung in die USA im Herbst 1938 wohnen wird. Bereits im März 1933 tritt Thomas Mann aus der gleichgeschalteten Sektion Dichtkunst der Akademie der Künste aus, am 4. April 1933 wird er aus dem Rotary Club ausgeschlossen. Viele Einträge im Tagebuch zeugen von der anfänglichen Unfähigkeit Manns, die neue Situation und den Status des Exilanten zu akzeptieren. Noch im März 1934 notiert er: „Daß ich aus dieser Existenz hinausgedrängt worden, ist ein schwerer Stil- und Schicksalsfehler meines Lebens, mit dem ich, wie es scheint, umsonst fertig zu werden suche, und die Unmöglichkeit seiner Berichtigung und Wiederherstellung, die sich immer wieder aufdrängt, das Ergebnis jeder Prüfung ist, frißt mir am Herzen.“ (TB 1933–1934, 356)
Protest der Richard-Wagner-Stadt München
Am 16. April 1933 erscheint in den Münchner Neusten Nachrichten der zuvor bereits über Radio München verbreitete Protest der Richard-Wagner-Stadt München gegen Thomas Manns Wagner-Vortrag, in dem er – das löste den Skandal vor allem aus – Wagners Schaffen, in Anlehnung an Nietzsche, als einen genialen „Dilettantismus“ bezeichnet hatte (GW IX, 375f.). Der gegen Thomas Mann gerichtete Protest wird von fünfundvierzig Personen des Münchner öffentlichen Lebens unterzeichnet, darunter viele Intellektuelle und Kunstschaffende, die ihr Einverständnis mit den neuen nationalsozialistischen Machthabern offenbar auch öffentlich bekunden wollen (Schirnding 2008, 83f.). Selbst vermeintlich befreundete Kollegen Thomas Manns aus den Münchner Künstlerkreisen sind beteiligt, so setzen unter anderem die Komponisten Hans Pfitzner und Richard Strauss, der Münchner Generalmusikdirektor und Initiator der Aktion Hans Knappertsbusch sowie der Maler und Karikaturist Olaf Gulbransson ihre Namen unter den Protest.
Schutzhaftbefehl und Enteignung
Das Pamphlet kommt einer „nationalen Exkommunikation“ gleich (Abel 2003, 43). In der Poschingerstraße wird das Haus der Familie durchsucht, zunächst das Auto, später auch das Haus beschlagnahmt und weitervermietet. Der SS-General (und spätere zentrale Organisator des Holocaust) Reinhard Heydrich lässt Ende Mai die in Deutschland verbliebenen Vermögenswerte der Familie einziehen und erwirkt einen sogenannten „Schutzhaftbefehl“ gegen Thomas Mann; bei einer Rückkehr nach Deutschland wäre der Autor umgehend verhaftet worden (Kurzke 1999, 392). Alle Verhandlungen über die Rückgabe der in Deutschland verbliebenen Habe und Vermögenswerte, die die Familie mit Hilfe eines Anwalts anstrengt, scheitern an der Intervention Heydrichs. Woher dessen Hass auf Thomas Mann stammt, ist unbekannt (Kurzke 1999, 402). Insgesamt büßt Thomas Mann durch die Emigration etwa die Hälfte seines Vermögens ein, darunter auch die Hälfte des Nobelpreisgeldes; ein Teil war bereits zuvor in der Schweiz deponiert worden (Kurzke 1999, 400f.). Dennoch werden Thomas Mann und seine Familie niemals ernsthafte finanzielle Probleme im Exil haben – ganz anders als der Großteil der europäischen Emigranten.
Anfängliches Schweigen im Exil
Obwohl Thomas Mann nicht zurückkehrt, bleibt sein Verhältnis zu Deutschland zunächst in einer Art Schwebezustand. Die ersten beiden Bände der Romantetralogie Joseph und seine Brüder können noch in Berlin erscheinen (Die Geschichten Jaakobs 1933, Der junge Joseph 1934). Und lange hofft Thomas Mann auch noch auf die Rückgabe seines Hab und Gut. Die ersten drei Jahre des Exils sind von Depressionen, Zögern und Zweifeln geprägt, wie an den Tagebüchern und Briefen deutlich wird – und vom politischen Schweigen Thomas Manns. Der Autor, der sich in der Weimarer Republik bereits früh und explizit gegen den Nationalsozialismus positioniert hatte und der sich nun im Tagebuch und in privaten Briefen immer wieder deutlich ablehnend über die NS-Machthaber äußert, enthält sich in den Jahren 1933 bis 1935 jeglicher öffentlichen politischen Äußerung gegen das Hitlerregime; über die Gründe ist damals wie heute viel spekuliert worden (Schöll 2004, 43ff.). „Heute ist um ihn ein Raum des Schweigens“, so äußert sich 1935 Theodor Heuss zu Thomas Manns Verhalten (Schröter 1969, 251). Mit diesem Schweigen stößt Mann nicht nur die eigene Familie vor den Kopf, vor allem Erika und Klaus, die sich im Exil politisch engagieren, sondern auch die Exilgemeinschaft der Künstler und Intellektuellen, die aus Deutschland fliehen mussten.
Politisches Bekenntnis 1936
Erst zum Jahresbeginn 1936 wird sich Thomas Mann öffentlich gegen das Dritte Reich äußern. Am 3. Februar 1936 publiziert er einen offenen Brief in der Neuen Zürcher Zeitung, in dem er sich klar und deutlich auf die Seite des politischen wie literarischen Exils stellt (Schöll 2004, 49ff.). Der Staatenlosigkeit durch die Ausbürgerung aus Deutschland, die daraufhin im Dezember 1936 erfolgt, kommt Thomas Mann zuvor, indem er im November 1936 die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft annimmt. Er wird tschechoslowakischer Staatsbürger bleiben, bis er am 23. Juni 1944 die US-amerikanische Staatsbürgerschaft erhält.
Exilromane
Zu Thomas Manns Erleichterung emigriert im Frühjahr 1936 endlich auch sein Verleger Gottfried Bermann Fischer mit Teilen des Verlags aus Deutschland. Thomas Manns Exilromane Joseph in Ägypten (1936) und Lotte in Weimar (1939) erscheinen im S. Fischer Verlag in Wien, Joseph, der Ernährer schließlich 1943 in Stockholm, wohin Bermann Fischer zu diesem Zeitpunkt den Verlag transferieren musste. Die ersten beiden Bände des Romans Joseph und seine Brüder sind bereits abgeschlossen, den dritten Band hat Thomas Mann gerade begonnen, als er Deutschland verlassen muss. Der Horizont des Textes ändert sich mit den neuen privaten und politischen Verhältnissen. Vor allem wird der Roman nun, angesichts der Judenverfolgung in Deutschland, als pro-jüdische Deklaration und Verbeugung vor der jüdischen Kulturgeschichte wahrgenommen.
Das andere Deutschland
Nach Abschluss des dritten Bandes unterbricht Thomas Mann die Arbeit an dem Projekt, um sich seinem zweiten großen Exilroman Lotte in Weimar zu widmen, an dem er von 1936 bis 1939 schreibt. Auch die Bewertung der Figur Goethes – der hier explizit als europäischer, nicht so sehr als deutscher Autor präsentiert wird – ist deutlich durch das Exil geprägt. So lässt Thomas Mann seine Goethefigur im Roman über die Deutschen sagen: „[…] ihre Besten lebten immer bei ihnen im Exil […].“ (GKFA 9.1, 335) Diese Bemerkung ergibt wenig Sinn, wenn man sie aus der Perspektive des Jahrs 1816 rezipiert, in dem der Roman spielt. Sie werden indes verständlich, wenn man sie als Deklaration eines Exilautors in der Zeit des Dritten Reichs liest. Thomas Manns öffentliches Bekenntnis zum Exil vom Februar 1936 wirkt wie ein Befreiungsschlag. Nicht nur betrachtet sich der Autor von da an als Teil der deutschen Exilgemeinde, er proklamiert auch immer wieder öffentlich, dass sich mit den Emigranten der bessere Teil der deutschen Nation, das eigentliche Deutschland im Exil befinde. Er selbst inszeniert sich immer wieder, vor allem in den USA, als Gegenspieler Hitlers – nicht zuletzt im Essay Bruder Hitler vom April 1938, in dem er neben der vermeintlichen Nähe auch die größtmögliche Distanz zu Hitler konstruiert.
Politisches Engagement im Exil
Mit dem Bekenntnis zum Exil beginnt die umfangreiche politische Tätigkeit Thomas Manns, sein Kampf in Reden, Vorträgen und Aufsätzen gegen Hitler und das nationalsozialistische Regime. Hermann Kurzke zählt von 1937 bis 1945 über dreihundert nicht-dichterische Beiträge aus der Feder des Exilanten und konstatiert: „Kein deutscher Autor im Exil hat auch nur annähernd eine so ausgedehnte publizistische Tätigkeit entfaltet.“ (Kurzke 1999, 445) Im Mai 1936 hält Thomas Mann in Wien die Festrede Freud und die Zukunft; 1937 publiziert er unter dem Titel Ein Briefwechsel seine Antwort auf die Aberkennung der Bonner Ehrendoktorwürde, ein Text, der zu einem zentralen politischen Statement des Exils avanciert. Von 1937 bis 1940 erscheint in Zürich im Verlag Emil Oprecht Thomas Manns Exilzeitschrift Mass und Wert, außerdem entstehen die Texte Dieser Friede (1938) und Dieser Krieg (1939) sowie die wichtigen Vorträge Schicksal und Aufgabe (1943), Deutschland und die Deutschen (1945) und Die Lager (1945). Von Oktober 1940 bis Ende 1945 schreibt Thomas Mann für die BBC insgesamt 58 Reden, die – zunächst von einem Sprecher verlesen, später vom Autor selbst gesprochen – per Rundfunk in Deutschland verbreitet werden.
Auswanderung in die USA
Nach Reisen in die USA in den Jahren 1934, 1935 – während der ihm die Ehrendoktorwürde der Harvard University verliehen wird –, 1937 und im Frühjahr 1938 siedelt Thomas Mann mit Frau und Kindern im Herbst 1938 ganz in die USA über, wo ihm eine Stelle an der Universität Princeton angeboten wurde. Das Angebot kam durch die Vermittlung seiner amerikanischen Gönnerin Agnes E. Meyer zustande, Ehefrau eines großen Zeitungsmagnaten und glühenden Bewunderin Thomas Manns, die ihm während seiner Exiljahre in den USA zahlreiche Türen öffnen und sein Leben und Arbeiten finanziell großzügig unterstützen wird. Obwohl Thomas Mann sich im Tagebuch oft genervt äußert ob der Ansprüche, die ihm aus dieser Freundschaft entstehen, nimmt er Agnes Meyers Großzügigkeit immer wieder selbstverständlich in Anspruch.
US-amerikanisches Publikum
Neben der politischen Tätigkeit unternimmt Thomas Mann zahlreiche Lesereisen durch seine neue Heimat. Sein Werk wird in den USA in Übersetzung publiziert und öffentlich wahrgenommen, wenn es auch nie die Popularität erlangt, die etwa die Romane Vicki Baums, Franz Werfels oder Lion Feuchtwangers in den USA genießen. Im Vergleich zum Großteil der anderen Exilautoren, die in den USA kein Publikum finden, sieht sich Thomas Mann somit immer in der komfortablen Lage, sein Einkommen durch das Schreiben sichern zu können. Auch die Honorare für die politische Vortragstätigkeit tragen nicht unwesentlich zum Einkommen der Familie bei – auf das sich auch die erwachsenen Kinder immer wieder verlassen. Den größten Ruhm erntet Thomas Mann in den USA nicht als literarischer Autor, sondern als politischer Repräsentant des deutschen Exils. Umgekehrt identifiziert sich Thomas Mann vor allem auf politischer Ebene mit seinem neuen Gastland, nicht zuletzt aufgrund seiner tiefen Bewunderung für den amerikanischen Präsidenten Franklin Delano Roosevelt (1882–1945), von dem er sich ein entschlossenes Vorgehen gegen Hitler-Deutschland erhofft. Der Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg im Dezember 1941 wird von Thomas Mann entsprechend begrüßt, an einen schnellen Erfolg der Alliierten glaubt er zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr (Schöll 2004, 137ff.).
Leben und Schaffen ab 1940
Nach Abschluss der Arbeit an Lotte in Weimar entsteht 1940 die Erzählung Die vertauschten Köpfe. Im August 1940 greift Thomas Mann den Stoff des Josephsromans wieder auf und beginnt mit der Arbeit am vierten und letzten Band, Joseph, der Ernährer, den er im Januar 1943 abschließt. Nach einem kurzen Einschub durch die Erzählung Das Gesetz folgt das nächste große Romanprojekt, die Arbeit an Doktor Faustus (1943–1947). Im Frühjahr 1941 verlegt die Familie Mann ihren Wohnsitz von der Ostküste an die Westküste der USA. Sie lässt sich im kalifornischen Pacific Palisades nahe Los Angeles nieder, wo sie eine nach ihren Vorstellungen entworfene Villa im Stil des amerikanischen Bauhaus bezieht, deren Errichtung durch die finanziellen Unterstützung von Agnes Meyer möglich wird.
Präsident Roosevelt
Thomas Mann verfolgt das europäische Kriegsgeschehen sehr genau. Keine Person des US-amerikanischen öffentlichen Lebens verkörpert für Thomas Mann so sehr die Hoffnung eines baldigen Endes des Naziregimes wie Präsident Roosevelt (zu Manns Verhältnis zu Roosevelt siehe ausführlich Vaget 2011, 67ff.). Nach seiner zweiten Einladung ins Weiße Haus 1941 – die erste war 1935 nach der Verleihung des Ehrendoktors von Harvard erfolgt – schreibt Thomas Mann an Agnes Meyer: „Diese Mischung von Schlauheit, Sonnigkeit, Verwöhntheit, Gefalllustigkeit und ehrlichem Glauben ist schwer zu charakterisieren, aber etwas wie Segen ist auf ihm, und ich bin ihm zugetan als dem, wie mir scheint, geborenen Gegenspieler gegen Das, was fallen muss.“ (Brief vom 24. Januar 1941; Mann/Meyer 1992, 254) Während des Wahlkampfes 1944 setzt sich Thomas Mann öffentlich für Roosevelts Wiederwahl ein. Dessen Tod am 12. April 1945 erschüttert ihn, wie der Eintrag im Tagebuch offenbart: „Empfingen nachmittags mit tiefer Bewegung die Nachricht vom/Tode Franklin Roosevelts./[…] Hörten im Lauf des Abends viel dem Radio zu, ergriffen von Huldigungen und Trauerkundgebungen aus aller Welt./Die Erschütterung ist groß.“ (TB 1944–1.4.1946, 187f.)
Politische Rolle in der Öffentlichkeit
In der Forschung wurde und wird immer wieder angezweifelt, dass das antifaschistische Engagement Thomas Manns ‚authentisch‘ gewesen sei; auch Hermann Kurzke geht in seiner Biographie davon aus, dass dem Autor ein innerer Vorbehalt gegen die eigene politische Tätigkeit geblieben sei (Kurzke 1999, 449). Tatsächlich bietet das Tagebuch einige Hinweise darauf, dass Thomas Mann sich zum politischen Engagement immer wieder selbst motivieren muss, vor allem angesichts des zeitlichen Aufwands – Zeit, die ihm für das literarische Arbeiten fehlt. Trotz dieser Zweifel findet sich jedoch kein ernsthafter Hinweis dafür, dass Thomas Mann zeitlebens ein ‚Unpolitischer‘ geblieben sei. Er übernimmt im Exil eine neue, öffentliche politische Rolle, die ihm im Verlauf der Jahre immer vertrauter wird und die nicht mehr oder weniger ‚authentisch‘ ist als die anderen Rollen, die Thomas Mann im Lauf seines Lebens erfüllt.
Hilfe für die Flüchtlinge
In den Jahren des Exils entwickelt sich das Heim der Familie Mann zu einer Art Exil-Büro, das zahlreichen Flüchtlingen aus Europa als erste Anlaufstelle dient. Thomas, Katia, Erika und später auch Golo Mann beantworten unzählige Hilfsgesuche und stellen logistische wie finanzielle Hilfe zur Verfügung. „Thomas Mann“, so schreibt Hermann Kurzke, das sei in dieser Zeit „ein Kollektiv“ gewesen (Kurzke 1999, 472). Der prominente Exilant unterstützt verschiedene Hilfsorganisationen, sammelt Spenden, vermittelt Jobs und nutzt seine Stellung in der amerikanischen Öffentlichkeit immer wieder, um auf die Not der Geflüchteten aufmerksam zu machen. Er interveniert bei den amerikanischen Behörden, als die deutschen Emigranten durch den Kriegseintritt der USA über Nacht zu enemy aliens werden – ein Umstand, der ihn als tschechoslowakischen Staatsbürger nicht selbst betrifft. Hinzu kommt die Sorge um Golo und Heinrich Mann, die nach dem Einmarsch der Deutschen in Frankreich festsitzen und erst nach einer spektakulären Flucht in die USA entkommen. Heinrich Mann lässt sich mit seiner Frau in der Nähe in Los Angeles nieder. Der räumlichen Nähe entspricht jedoch keine persönliche; bis zum Tod Heinrich Manns im Jahr 1950 bleibt das Verhältnis der Brüder freundlich, aber distanziert.