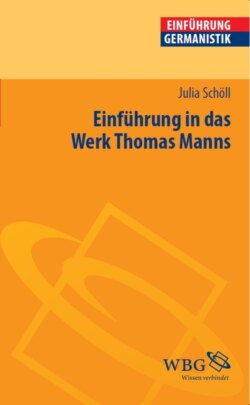Читать книгу Einführung in das Werk Thomas Manns - Julia Schöll - Страница 8
III. Thomas Mann im zeithistorischen Kontext
ОглавлениеTagebücher
Die biographische Aufarbeitung des Lebens Thomas Manns teilt sich in ein ‚Vor‘ und ein ‚Nach‘ der Publikation seiner Tagebücher. Der Autor hatte seine „daily notes“, wie er das Paket beschriftete, vor seinem Tod verpackt, versiegelt und mit einer Sperrfrist sowie dem Vermerk „Without any literary value“ versehen. Das Paket wurde erst zwanzig Jahre nach seinem Tod, am 12. August 1975, geöffnet und sein Inhalt für die Forschung ausgewertet. Es enthielt, in Form dicker Wachstuchhefte, die Tagebücher ab dem Jahr 1933 bis zu Thomas Manns Tod sowie drei Hefte aus den Jahren 1918 bis 1921. Alle anderen Tagebücher hat der Autor selbst zu verschiedenen Zeitpunkten in seinem Leben vernichtet.
Entmythologisierung
Der Publizist, Autor und Freund der Familie Mann, Peter de Mendelssohn (1908–1982), publizierte 1975 seine Biographie Der Zauberer. Das Leben des deutschen Schriftstellers Thomas Mann, die nur die Jahre 1875 bis 1918 behandelt und dennoch bereits fast zweitausend Seiten umfasst; es erschienen später zudem einige Kapitel zu den Jahren 1919 und 1933 aus Mendelssohns Nachlass. Es ist die letzte „naive“ Biographie, wie Klaus Harpprecht anmerkt (Harpprecht 1995, 18), denn nur wenig später ist es Mendelssohn selbst, der die Publikation der Mann’schen Tagebücher beginnt (nach Mendelssohns Tod wird die zehnbändige Edition der Tagebücher Thomas Manns ab 1986 von Inge Jens weitergeführt und 1995 zu Ende gebracht). Mit dieser Einsicht in die persönlichen Aufzeichnungen des Autors begann ein Prozess der „Entmythologisierung“ der Ikone Thomas Mann, der nicht zuletzt auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass nach der Lektüre der Tagebücher an der Homosexualität Thomas Manns kein Zweifel mehr bestand – für einige immer noch ein Skandal, obwohl der aufmerksame Rezipient aus den literarischen und essayistischen Texten Manns auch zuvor bereits unschwer seine Schlüsse hatte ziehen können.
Biographien
Neben der Tatsache, dass Mendelssohns Biographie die Tagebücher noch nicht berücksichtigen konnte und zudem unvollendet blieb – die weiteren Notizen zeugen davon, dass es ein ausuferndes Unternehmen geworden wäre –, krankt seine Darstellung an der zu großen Nähe zum verehrten Objekt seiner Forschung. Der Journalist und Publizist Klaus Harpprecht (geb. 1927) legt 1995 die mit mehr als 2000 Textseiten bislang umfangreichste abgeschlossene Biographie vor, die noch Teil jenes Prozesses der „Entmythologisierung“ ist, von dem Harpprecht eingangs selbst berichtet. Dies äußert sich vor allem in der Tatsache, dass sich Harpprecht mit suggestiven Anmerkungen und persönlichen Wertungen nicht zurückhält und vielfach seine triumphierenden Überlegenheitsgefühle nicht verbergen kann, es besser zu wissen als Thomas Mann (z.B.: „Er hatte nichts von der neuen Realität verstanden, die Europa zu formen begann.“ Harpprecht 1995, 1813). Ärgerlich ist neben der Tatsache, dass sich der Leser seiner Biographie kein eigenes Bild machen kann, der eklatante Mangel an Belegen. Zu viel wird berichtet, dessen Quelle völlig offen bleibt. Ebenfalls 1995 erscheint das Buch Thomas Mann. A Life des englischen Literaturwissenschaftlers und Diplomaten Donald A. Prater (1918–2001). Der deutsche Untertitel: Deutscher und Weltbürger gibt sich etwas weniger bescheiden als das britische Original. Wie Harpprecht versteht sich auch Prater als Erzähler eines Lebens, doch bringt er seinem Gegenstand mehr Gelassenheit und Sympathie entgegen. Die erste Biographie, die aktuellen wissenschaftlichen Standards entspricht und sich auch im Hinblick auf die Werkbiographie auf dem gegenwärtigen Stand der Forschung befindet, liefert erst 1999 der Mainzer Germanistikprofessor Hermann Kurzke mit Thomas Mann. Das Leben als Kunstwerk. Wie Praters Biographie ist auch sein Text unübersehbar von einem großen Wohlwollen gegenüber Thomas Mann und der Bewunderung für dessen Lebenswerk geprägt. Deutlich wird dies vor allem dort, wo er Thomas Mann gegen Vorwürfe, etwa den des Antisemitismus, in Schutz nimmt. Mit dem Fokus auf dem „Kunstbau“ dieses Lebens misst Kurzkes biographische Darstellung der Frage nach Sexualität und Homoerotik sehr viel Gewicht bei. An manchen Stellen konstruiert er einen unmittelbaren Kontext zwischen Leben und Werk, der bewusst und explizit auch auf Spekulationen setzt. Gleichwohl bildet Kurzkes Buch als maßgebliche wissenschaftliche Biographie neben den Selbstzeugnissen, Briefen und Tagebüchern Thomas Manns die Hauptquelle der folgenden kurzen Übersicht über Leben und Arbeiten des Autors.
Aktuelle biographische Forschung
Jüngst wurde die Reihe der Biographien durch Hans Rudolf Vagets versierte und umfangreiche Darstellung der Zeit Thomas Manns in den USA ergänzt (2011), die eine wichtige Lücke in der biographischen Thomas-Mann-Forschung schließt. Einen zuverlässigen tabellarischen Überblick über Lebens- und Werkdaten bietet zudem die Thomas Mann Chronik (2004) von Gert Heine und Paul Schommer. Das ausgeprägte biographische Interesse an der Person Thomas Manns umfasst gerade in jüngerer Zeit auch die Familie des Autors – zumal, seit „die Manns“ mit der Ausstrahlung von Heinrich Breloers gleichnamiger Docufiction im deutschen Fernsehen (2001) zu den „deutschen Windsors“ avancierten. So wurden die Biographien des Vaters durch eine ganze Reihe an Darstellungen über die Familie ergänzt (u.a. Wißkirchen 1999, Jens/Jens 2003, Kuschel/Mann/Soethe 2009, Wüstner 2010).