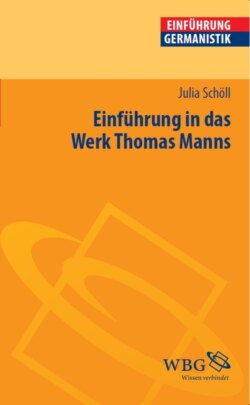Читать книгу Einführung in das Werk Thomas Manns - Julia Schöll - Страница 9
1. Leben und Schreiben im Wilhelminischen Kaiserreich
ОглавлениеQuellenlage zum Frühwerk
Da die frühen Tagebücher Thomas Manns nicht erhalten sind, stellt sich die Quellenlage für diese Zeit anders dar als für die späteren Schaffensjahre. Nur die Hefte von September 1918 bis Dezember 1921 nimmt Thomas Mann von der Vernichtung aus, weil er sie noch als Inspiration für den Roman Doktor Faustus braucht (Mendelssohn 1979, Vff.). Zudem stellt sich die biographische Quellenlage für die frühen Jahre anders dar, weil Thomas Mann in dieser Zeit erst berühmt wird und noch nicht den Status eines deutschen ‚Nationalschriftstellers‘ innehat, der später die Grundlage dafür sein wird, dass alles von ihm Geschriebene akribisch gesammelt und kommentiert wird.
Kindheit
Thomas Mann wird am 6. Juni 1875 in Lübeck als zweiter Sohn einer wohlhabenden und angesehenen protestantischen Kaufmannsfamilie geboren. Sein Bruder Heinrich wird 1871, die Schwestern Julia 1877 und Carla 1881, der Nachzügler Viktor 1890 geboren. Der Vater, Thomas Johann Heinrich Mann, ist Inhaber der Getreidefirma „Johann Siegmund Mann“, außerdem Niederländischer Konsul und später Steuersenator der Stadt Lübeck. Vom Vater übernimmt Thomas Mann offenbar den Ehrgeiz und den bürgerlichen Habitus, jene für ihn so typische Mischung aus Fleiß und Eleganz (Kurzke 1999, 25). In der symbolischen Topographie, die bereits im Frühwerk virulent ist und auf die Thomas Mann zeit seines Lebens zurückkommen wird, repräsentiert der Vater den Norden. Die Mutter hingegen steht für den Süden. Julia Mann, geborene da Silva-Bruhns, bildet als Kind einer reichen deutsch-brasilianischen Kaufmannsfamilie das exotische Element der Familie Mann, sie ist zudem für die musikalische (zur musikalischen Bildung und Praxis im Hause Mann: siehe Schröter 2005, 18ff.) und literarische Ausbildung der Kinder zuständig. Trotz ihrer Affinität zum Süden wird die eigentümliche „Kälte“, die viele der literarischen Figuren Manns auszeichnet und die auch ihm selbst von Zeitgenossen attestiert wird, der Seite der Mutter zugeschrieben (Kurzke 1999, 26).
Lübecker Erbe
Die Atmosphäre in der Handelsstadt Lübeck, die mit der ganzen Welt Geschäfte macht und zugleich – nicht nur architektonisch – eine beklemmende Enge vermittelt, sowie der Habitus der Kaufmanns- und Senatorenfamilie, der er entstammt, prägen Thomas Mann. Die bürgerliche Erziehung des Wilhelminischen Kaiserreichs setzt auf die Perfektionierung der Rollen, die der Mensch in Gesellschaft und Familie übernimmt; mit dem modernen Schlagwort ‚Authentizität‘ hätte man im Lübeck des späten 19. Jahrhunderts wohl wenig anfangen können. Erziehung und Umgebung vermitteln dem jungen Thomas Mann früh ein Bewusstsein des eigenen Status (Kurzke 1999, 22), das später auch sein Selbstbewusstsein als Schriftsteller und als patriarchalisches Oberhaupt einer großen Familie prägen wird. Den ersten überlieferten Brief vom Oktober 1889 unterzeichnet er bereits selbstsicher mit „Lyrisch-dramatischer Dichter“ (Prater 1998, 19).
Schulzeit
Der schulischen Ausbildung ist Thomas Manns Selbstbewusstsein indes nicht geschuldet. Der junge Kaufmannssohn besucht eine Privatschule, später mit mäßigem Erfolg das Gymnasium, wo er mehrere Klassen wiederholen muss. Er verlässt es 1894 ohne Abitur, lediglich im Besitz des so genannten „Einjährigen“, also der Berechtigung zum einjährigen freiwilligen Militärdienst. Die Schulszenen aus dem Roman Buddenbrooks (Kurzke 1999, 33f.) zeugen vom Klima der pädagogischen Disziplinierungsmethoden des Kaiserreichs ebenso wie die Episode der Musterung aus Felix Krull oder die Atmosphäre, die Heinrich Manns berühmter Roman Der Untertan (1914, Buchausgabe 1918) vermittelt. Die umfangreiche Bildung, von der Thomas Manns Texte zeugen, wird sich der Autor im Laufe der Jahre weitgehend autodidaktisch aneignen. Wichtig sind jedoch die zwischenmenschlichen Begegnungen der Schulzeit: die enge Freundschaft mit Otto Grautoff, der wir einen umfangreichen Briefwechsel (ab 1894) verdanken, sowie die Verliebtheit in die Kameraden Armin Martens und Williram Timpe, die Objekte früher sehnsuchtsvoller Gedichte werden (Kurzke 1999, 40ff.). Thomas Mann wird, wie so oft, diese pubertären Leidenschaften später als Inspiration für seine Literatur nutzen, so weist etwa die Figur des Pribislav Hippe im Zauberberg Züge von Williram Timpe auf. Traumatische Spuren hinterlässt der Spott des Bruders Heinrich für diese homosexuellen Schwärmereien (Kurzke 1999, 48f.) und belastet das ohnehin zeitlebens schwierige Verhältnis der Brüder.
München und Italien
Als der Vater 1891 mit nur 51 Jahren stirbt, verfügt er testamentarisch die Auflösung der Firma – in dem Wissen, dass keiner der Söhne zu seinem Nachfolger berufen ist (Kurzke 1999, 31). Kurz darauf siedelt die Mutter mit den jüngeren Kindern nach München über, wohin ihr Sohn Thomas 1894 nach einiger Zeit in Lübecker Pensionaten folgt. Zwar hatte der Vater im Testament die Hoffnung geäußert, sein Zweitältester habe „ein gutes Gemüth“ und werde sich „in einen praktischen Beruf hineinfinden“ (Prater 1998, 25). Doch nach einer kurzen Zeit als Volontär bei einer Feuerversicherung konzentriert sich Thomas Mann, wie sein Bruder Heinrich, auf die literarischen Interessen, die er bereits während seiner Schülerzeit entwickelte und pflegte. Die Publikation seiner Erzählung Gefallen (1894) in der naturalistischen Zeitschrift Die Gesellschaft öffnet dem jungen Autor die Türen der Münchner Literaturszene (Kurzke 1999, 66). Er verkehrt in Schwabings Boheme und im Künstlercafé Central, besucht als Gasthörer Vorlesungen an der Technischen Hochschule, hört viel und ausdauernd Wagner an der Münchner Oper und verlässt sich bei all dem auf das Einkommen, das ihm aus dem Nachlass des Vaters und der Liquidation des Lübecker Familienunternehmens zufließt. In den Jahren 1895 sowie 1896 bis 1898 unternimmt er zusammen mit Heinrich ausgedehnte Reisen nach Italien, die ihn u.a. nach Venedig, Palestrina, Rom und Neapel führen. Eine kurze Episode beim Militär 1900 endet nach nur wenigen Wochen mit Thomas Manns vorzeitiger Entlassung.
Erste Publikationen
Die frühen Erzählungen erscheinen in verschiedenen Zeitschriften, u.a. in der nationalkonservativen Zeitschrift Das Zwanzigste Jahrhundert, für die Heinrich Mann als Redakteur arbeitet, sowie im berühmten Simplicissimus (Kurzke 1999, 66). Der künstlerische Durchbruch gelingt schließlich mit der Erzählung Der kleine Herr Friedemann (abgeschlossen im Herbst 1896), die auch den Titel des 1898 erschienenen Novellenbandes liefert. Während des zweiten langen Italienaufenthalts beginnt Thomas Mann im Oktober 1897 in Rom mit der Niederschrift des Romans Buddenbrooks, der 1901 im Berliner Verlag Samuel Fischer erscheinen und den Ruf Thomas Manns als junges literarisches Genie festigen wird.
Vater- und Mutterwelt
Nach der Logik der Gegensätzlichkeit von Vater- und Mutterwelt – die Sphäre der bürgerlichen Vernunft und des Geschäftssinns versus die Welt von Kunst, Musik und Literatur –, die Thomas Manns Texte, vor allem aber das Frühwerk leitmotivisch durchzieht, entscheidet er sich mit dem Schriftstellerdasein zunächst für die Mutterwelt. Erst durch die Distanz zur Sphäre des Vaters, zu Lübeck, zum bürgerlichen Habitus, wird ein Roman wie Buddenbrooks möglich: „Erst das Herausfallen aus der Bürgerwelt machte Thomas Mann zum Künstler“, schreibt Hermann Kurzke (Kurzke 1999, 71). Der Biograph präsentiert Manns Leben und Arbeiten als ein immerwährendes Austarieren der beiden entgegengesetzten Pole von Vater- und Mutterwelt.
Hochzeit und Ehe
Auf die Seite der Mutterwelt gehört in dieser Logik unter anderem die Beziehung zum Maler Paul Ehrenberg, den Thomas Mann 1899 kennenlernt und mit dem er bis 1903 eine homoerotisch geprägte Freundschaft, wenn auch keine Liebesbeziehung pflegt. Das Leben des jungen Bohemien neigt sich jedoch bald wieder in die andere Richtung: 1903 macht Thomas Mann die Bekanntschaft von Katia Pringsheim, der Tochter einer ebenso gebildeten wie wohlhabenden jüdischen Münchner Familie. Es folgen die Verlobung im Oktober 1904 sowie am 11. Februar 1905 die Hochzeit. Die Ehe mit Katia, die ein Leben lang bestehen wird und aus der sechs Kinder hervorgehen werden, bedeutet einen wichtigen Schritt in Richtung eines gesicherten bürgerlichen Daseins im Sinne der Vorstellungen des Vaters. Durch den ökonomischen Ertrag seiner schriftstellerischen Tätigkeit wird Thomas Mann zeit seines Lebens die wachsende Familie nicht nur ernähren, sondern ihr selbst in den schweren Zeiten von Krieg und Exil einen gehobenen bürgerlichen Lebensstandard bieten können.
Bürgerliche „Verfassung“
Die eigene ‚Verbürgerlichung‘ weckt zugleich immer wieder Zweifel. An seinen Bruder Heinrich schreibt Thomas Mann im Januar 1906: „Ein Gefühl der Unfreiheit werde ich freilich seither [seit der Hochzeit] nicht los, und Du nennst mich gewiß einen feigen Bürger. Aber Du hast leicht reden. Du bist absolut. Ich dagegen habe geruht, mir eine Verfassung zu geben.“ (Kurzke 1999, 129) Dieser Begriff der „Verfassung“ bezieht sich auch auf die eigenen homoerotischen Neigungen, die durch das heterosexuelle Bündnis der bürgerlichen Ehe natürlich nicht beendet, denen damit jedoch auf der Ebene des öffentlichen gesellschaftlichen Auftretens eine endgültige Absage erteilt wird. Der Umgang des Bürgers mit den Trieben und das Zweischneidige sexueller Leidenschaft sind zu dieser Zeit zentrale Themen des literarischen Schreibens und werden es zeitlebens bleiben – wenn sich auch über die Jahre die dringliche Dramatik des Themas ins Ironische wendet.
Frühwerk
Thomas Manns Ehe- und Familienglück ist ein „strenges Glück“, ein als Arbeit und Pflicht wahrgenommenes Glück (Kurzke 1999, 169). Dem entsprechen auf der Ebene des Schaffens ein ausgeprägter Ehrgeiz sowie eine gewissenhafte Selbstdisziplin, die das Zustandekommen dieses umfangreichen literarischen Lebenswerks erklären. „Bisweilen“, so schreibt der junge Autor schon 1901 an Otto Grautoff, „kehrt sich mir vor Ehrgeiz der Magen um.“ (Kurzke 1999, 177) Neben kleineren Prosastücken arbeitet Thomas Mann nach Abschluss des Buddenbrooks-Projekts unter anderem an den Erzählungen Tonio Kröger (1900–1902), Tristan (1901), Ein Glück (1903), Beim Propheten (1904), Schwere Stunde (1905) und Wälsungenblut (1905) sowie am Drama Fiorenza (1900–1905). Später folgen der Roman Königliche Hoheit (1909) und die umfangreiche Erzählung Der Tod in Venedig (1912), außerdem beschäftigt sich Thomas Mann mit Romanprojekten über Friedrich den Großen und die Idee der „Maja“; beide bleiben allerdings Fragment. Es entstehen die wichtigen Essays Bilse und ich (1906), Versuch über das Theater (1907), Süßer Schlaf! (1909) und Auseinandersetzung mit Wagner (1911). 1910 beginnt Mann die Arbeit am Roman Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, ab 1913 an Der Zauberberg.
Familie
Privat bringt diese Zeit die Geburt der Kinder: Erika 1905, Klaus 1906, Golo 1909, Monika 1910, Elisabeth 1918 und Michael 1919. 1908 lässt Thomas Mann in Bad Tölz ein stattliches Sommerhaus für die Familie bauen, 1914 folgt der Bau der Villa in der Poschingerstraße 1 in München-Bogenhausen, in der die Familie bis zu ihrer Exilierung 1933 wohnen wird. Auch traurige Familienereignisse fallen in diese Zeit: 1910 nimmt sich die Schwester Carla das Leben; auch die ältere Schwester Julia wird 1927 ihrem Leben durch Suizid ein Ende setzen. Nach einer Zeit großer Nähe zum Bruder durch die Italienreisen und die beiderseitige Entscheidung für ein Leben als Autor folgt die Distanzierung: Nach einem heftigen Streit, ausgelöst durch Thomas Manns Kritik an Heinrichs Roman Die Jagd von 1903 (Kurzke 1999, 112), bleibt das Verhältnis der Brüder angespannt. 1914 wird es beim Kriegsausbruch wegen der grundlegend verschiedenen politischen Haltung zum Bruch zwischen den Brüdern kommen, der erst nach Jahren wieder gekittet werden kann.