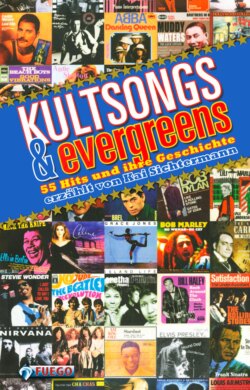Читать книгу Kultsongs & Evergreens - Kai Sichtermann - Страница 13
ОглавлениеOde »An Die Freude«
Deutschland 1824
Sternstunde der Menschheit
von Misha G. Schoeneberg
Es ist dieses eine Bild für die Götter: Umarmt umarmend stehen die jungen Burschen da, geben sich mit einem heiligen Kuss den Treueid ewiger Freundschaft. Als wären sie schon da, im Elysium, in jenen viel besungenen Gärten Edens, manchmal schlicht das Paradies genannt – dort, wo einst die Helden in den himmlischen Gefilden von cherubimen Engeln verwöhnt werden ...
Kraatsch! Alles Quatsch! Mit einem unerhörten Dissonanzschlag des gesamten Orchesters – nur die Streicher ruhen – bricht Beethoven die Realität, als würde er all dies hehre Pathos Schillers, welches jener euphorisch in seiner Ode An die Freude beschworen hatte, wegfegen wollen – bis er dann peu à peu das Lied wieder aufbaut, es ja letztendlich in einem frenetischen Jubel zum tosenden Finale führt. Was war los?
Als Friedrich Schiller die Ode im Jahr 1785 fertig schrieb, muss ihm sein eigenes Leben wie eine der himmlischen Fügungen, die er zu gern in seinen Gedichten besang, vorgekommen sein: Geboren 1759 in Marbach, die arme Kindheit in Ludwigsburg als Sohn eines Berufssoldaten, sieben lange Jahre auf der militärischen Drill-Lateinschule, das kurze Medizinstudium, die Ernennung im Alter von 20 Jahren zum Regimentsarzt in Stuttgart. Für die meisten Jungs, nicht nur zu seiner Zeit, hätte sich doch da der Traum schon erfüllt. Doch nicht für Schiller. Sein Stürmen und Drängen ging weiter: Die frühe Anerkennung seiner wahren Leidenschaft, des Schreibens (sein während des Studiums angefangenes Theaterstück „Die Räuber“ wurde 1782 in Mannheim uraufgeführt), dann das heimliche Verlassen seines Regiments und der folgende Arrest sowie das Schreibverbot durch seinen Arbeitgeber, den württembergischen Herzog Carl Eugen. Schillers Werdegang war wie der Prototyp späterer Künstlerlebensläufe: Er schmiss die bürgerliche Arzt-Karriere und entschied sich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit seinem Freund, Andreas Streicher, zur Flucht nach Mannheim. Dort erhielt er tatsächlich einen Vertrag für ein Jahr am Theater. Ein Rückschlag war das durchgefallene Stück „Fiesko“, doch schnell stellte sich der ersehnte Erfolg ein: „Kabale und Liebe“ wurde 1784 schon nach dem 2. Akt bejubelt. Was für ein Leben! Dabei, die Sorgen waren groß. Und wurden größer. Das Ende des Arbeitsvertrags, kein Geld, Krankheit, Schulden, mal eine Unterstützung durch eine Dichterfreundin, doch immer auf der Flucht vor seinen Gläubigern. So kam Schiller in Leipzig an.
In Christian G. Körner fand Schiller einen Freund und Mäzen, der ihm Zuflucht bot; für Schiller hieß das erst einmal, seiner persönlichen Not entkommen zu sein, bedeutete doch auch die Bestätigung seines Könnens. Eine ungeheure Euphorie, die er auf die ganze Menschheit zu übertragen suchte, erfasste ihn. Sie war eingebettet in die politische Hoffnung, welche die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von Amerika 1776, die der Frieden von Paris 1783 völkerrechtlich legitimierte, auslöste. Und in Körners Haus, das lange schon ein Mittelpunkt republikanischer Netzwerke war, schrieb Schiller die weltberühmten Zeilen:
Freude, schöner Gotterfunken,
Tochter aus Elysium,
Wir betreten feuertrunken,
Himmlische, dein Heiligtum.
Deine Zauber binden wieder,
Was die Mode streng geteilt,
Alle Menschen werden Brüder,
Wo dein sanfter Flügel weilt.
In einer ersten Fassung hieß es Freiheit bei Schiller. Aus Furcht vor der Zensur, wie aber auch aufgrund der Erkenntnis, dass Freude durchaus eine Erweiterung der Freiheit darstellt, wurde der Text zur Ode An die Freude. Die Ode ist der I-Punkt auf der Sturm-und-Drang-Zeit, die ihrem Wesen nach nicht nur eine Jugend-, sondern auch eine Protestbewegung im Europa der Aufklärung am Vorabend der Französischen Revolution 1789 war. Der Sturm und Drang richtete sich gegen die absolutistischen Obrigkeiten in den deutschen Staaten, gegen die höfische Welt des Adels, gegen das bürgerliche Berufsleben ebenso wie gegen die bürgerlichen Moralvorstellungen sowie gegen die überkommene Tradition in Kunst und Literatur.
Im Gegensatz zur vernunftbetonten Aufklärung verklärte der Sturm und Drang das Genie, in welchem sich die schöpferischen Kräfte der Natur, das Ursprüngliche, das Elementare, ja Göttliche äußerten. Als dieser Genius galt die ungebrochene, kraftvolle Seele, die im Denken und Handeln eine Einheit bildet, die sich selbst treu bleibt und sich nicht scheut, gegen eine ganze Welt anzutreten. Dabei waren Sex und Rausch, hier vornehmlich die Droge Alkohol, nicht erst Elixiere des Jazz und Rock’n’Roll; in den Männerbünden und Burschenschaften, zu denen man sich zusammenschloss, lebte man die Daseins-Freuden exaltisch aus: „Lasst den Schaum zum Himmel spritzen!“
Doch die Vorstellung der Bürger über die Realität der Kunst und ihre Künstler sah sehr viel anders aus. So ist es fast kein Wunder, dass eines schönen Sommertags in Wien, kurz nach der Aufführung vom 7. Mai 1824 der mit phänomenaler Begeisterung angenommenen 9. Sinfonie, ein Mann namens Beethoven verhaftet wurde, nur weil er behauptete, er wäre Beethoven. Er war längst schon taub, die Krankheit hatte ihn misstrauisch gemacht, von misanthropischer Art gegen die Bürger seiner Welt war er ohnehin. Doch dieses Beharren darauf, Beethoven zu sein, das hatte die braven Bürger vollends gegen diesen wuschigen, alten Mann, der so traurig in ihre Vorgärten stierte, aufgebracht, sie ließen nach dem Schutzmann rufen. Beethoven wurde unter lautem Gejohle abgeführt, musste eine Nacht im Arrest verbringen, bis anderntags sein Verleger seine Identität bestätigte.
Beethoven stammt aus einer Musikerfamilie, 1770 in Bonn geboren war er elf Jahre jünger als Schiller; sie sind sich nie persönlich begegnet, ebenso wenig gab es eine direkte Korrespondenz. Jedoch bestand zwischen ihnen beiden eine enge Beziehung, nicht nur geistig. Andreas Streicher, Schillers alter Freund aus Stuttgart, den er in Mannheim zurückließ, wurde Beethovens enger Vertrauter. Schon während seiner Studentenzeit 1789 in Bonn hatte sich Beethoven für die seinerzeit revolutionären Ideen begeistert: „Wohl tun wo man kann“, schrieb er, „Freiheit über alles lieben; Wahrheit nie, auch sogar am Throne nicht verschweigen.“ Wie Schiller war er überzeugt, dass die Kunst eine wichtige Rolle in der Aufklärung und Anleitung sowie Veredelung der Menschheit einnehmen müsse. Doch im Gegensatz zu Schiller war Beethoven früh das wütende Genie, das selten an seiner schöpferischen Kraft zweifelte. Man möchte Schiller nicht widersprechen, dass er rückblickend seine Ode künstlerisch als nicht auf den Punkt gebracht ansah. Ohne Beethovens rigide wie gnädige Bearbeitung wäre wohl Schillers Text nur Germanisten und einer handvoll Gymnasiasten bekannt. Vom Entschluss bis zur Tat dauerte es jedoch bei Beethoven im Fall der Ode 30 Jahre, jedes Detail musste er erst vor seinem inneren Auge sehen.
Beethoven eröffnet den 4. Satz der 9. Sinfonie mit dem erwähnten wütenden Dissonanzschlag, er ist die Fanfare für das erste Erklingen einer menschlichen Stimme in einer Sinfonie. Gleichzeitig markiert die Dissonanz eine exakte Zäsur, nicht nur für die Musikgeschichte, sie ist der Scheitelpunkt der erschütternden Diskrepanz zwischen der Möglichkeit des menschlichen Daseins und der Wirklichkeit seiner, des Menschen, tatsächlichen Lebensbedingungen; „unseren verzweifelungsvollen Zustand“, wie es Beethoven selbst zwischen die Noten kritzelte; das ewige Dilemma der Menschheit: Hier sind die realen Verhältnisse, dort ist das Ziel.
„O Freunde, nicht diese Töne“, mit diesen Worten wird der Weg zum Hauptthema des Satzes, dem Freude-Thema, vorbereitet. Es ist bis heute atemberaubend – kniet nieder Millionen! –, lediglich eine Musik erfassende Beschreibung der Vorgehensweise und Kompositionstechnik Beethovens nachzulesen. Die Offenlegung des Vierten Satzes Takt für Takt zeigt, dass Beethoven jeden Ton, jeden Einsatz eines Instruments, jede gesetzte Note vollkommen durchdacht, musikalisch durchlebt und gestaltet, ja auf gewisse Weise durchschaut hat. Eine anscheinend eingefangene, simple Melodie der Freude im volkstümlichen D-Dur – diese Einfachheit, die sich der Mensch, hier der Bass-Gesang, gegen das eigentliche d-Moll der Sinfonie eingangs immer wieder erobern muss –, wird zum hymnischen Schlusschor, ‚diesen Kuss der ganzen Welt!‘, zur ungeheuer kraftvollen Vision eines großen menschlichen Finales.
Die Reduzierung dieses symphonischen Meisterwerkes auf seine reine Melodie in Miguel Rios’ Song of Joy 1970, war nichts, weder Klassik noch Rock’n’Roll, es war purer Kitsch und damit das Böse schlechthin. Mit einem erbärmlichen Gesang in der englischen Fassung bleibt das einzig Geniale an diesem Streich das freche Verkaufstalent von Rios Onkel Waldo, einem argentinischen Produzenten. Sieben Millionen verkaufte Schallplatten! In vielen Ländern ein Top-Hit. Eine hübsche Ironie liegt in der Tatsache, dass die langen Wochen vom 18. September 1970 bis zum 29. Januar 1971, in denen diese Scheibe an der Spitze der deutschen Verkaufshitparaden lag, einmal unterbrochen wurden: Für 14 Tage im Dezember hieß die Nummer 1 Paranoid, das war die Antizipation des Punkrock durch einen gewissen Ozzy Osbourne. Beethoven hätte seine böse Freude über diese wütende Kraft gehabt.
Als ein Beispiel für die schier unzählbar vielfältige wie kontroverse Rezeption Beethovens Neunter der letzten 200 Jahre steht das Buch A Clockwork Orange (A. Burgess 1962) wie auch der gleichnamige Film von Stanley Kubrick (1971); der Lieblingskomponist der tragenden Figur, ein Bösewicht, ist Beethoven, doch wendet sich das gegen ihn, die Freude an dem Chor wird ihm zur Falle, wie ihn später gar, durch eine kleine therapeutische Panne, Beethoven zum Erbrechen bringt. Unschwer war darin eine Allegorie auf die Vorliebe Adolf Hitlers zu Beethovens Neunter – übrigens das einzige Stück Musik, das in Bayreuth aufgeführt werden darf, ohne von Wagner zu sein – zu lesen.
So Vieles spricht – trotz aller Widersprüche oder gerade ihrer wegen – für die Wahl des Schlusschores der Neunten als Europa-Hymne, doch dass die Vertonung einem Karajan angetragen wurde, kommt einer Kastration des Genialen gleich, nun ja, Staatsräson. Man möchte mit Beethoven traurig in die geordneten Vorgärten der Anderen schauen, doch hoffen, dass einen die braven Bürger nicht verhaften. Das Leben ist doch nicht gemähter Rasen, Freunde, sondern Jubel! Jubel, Freunde, Rausch und Ekstase! Geboren aus der urknallartigen Dissonanz, um eine hübsche Melodie arrangierte Sonnenläufe! Als entspräche jede Note einem Himmelskörper, der seinen ganz bestimmten Platz einnimmt. So hatte Beethoven den vierten Satz geschaffen: das durchschaute kosmische Chaos! Es ist Jubel, Freunde, vollkommene Euphorie, eine Sternstunde der Menschheit!
Titel – Autoren – Interpreten
Ode » An die Freude«
Original-Musik: Ludwig van Beethoven – 1824
Deutscher Original-Text: Friedrich Schiller – 1785
Bearbeitung des Textes: Ludwig van Beethoven – 1824
Spanischer Text: (als »Himno a la alegria«) Amado Regueiro Rodriguez – 1969
Englischer Text: (als »A Song Of Joy«) Clarke Ross Parker – 1969
Frühe Tonträgeraufnahme auf Schellackplatten: Orchester der Berliner Staatsoper, dirigiert von Oscar Fried, mit dem Bruno-Kittel-Chor – 1929; Label: Polydor/Brunswick
Hit-Version als »A Song of Joy«: Miguel Rios – 1969/70; Label: Polydor
Legendäre Einspielung aus Ost-Berlin als »Ode an die Freiheit«: Chor und Orchester mit internationalen Musikern, dirigiert von Leonard Bernstein – Weihnachten 1989; Label: Deutsche Grammophon
Neue, moderne Live-Fassung: Xavier Naidoo – 2005; Label: Naidoo Rec (SPV)
Annehmbare Chor-Version als »Freude schöner Götterfunken«: Gotthilf Fischer mit Chor – 2007; Label: Zyx