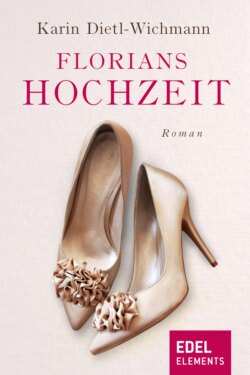Читать книгу Florians Hochzeit - Karin Dietl-Wichmann - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6 Bea
Miriam
Gesine
ОглавлениеMiriam hatte den Brief ihrer Freundin Gesine auf den Schreibtisch gelegt und vergessen. Erst Wochen später fiel ihr der blaue Umschlag mit der runden Schrift wieder ins Auge. Es war die Einladung zur Hochzeit, und Miriam hatte sie gerade noch rechtzeitig aus dem Stoß unerledigter Post hervorgezogen.
Gesines Umzug nach Hamburg lag ein halbes Jahr zurück. Sie hatte ihr Studium abgebrochen und einen Job in einer Werbeagentur angenommen. Sie war es Leid gewesen, nachts als Barfrau oder Babysitter zu arbeiten. Gesine wollte endlich einmal ausreichend Geld verdienen.
»Ob ich nun einen Abschluss habe oder nicht«, hatte sie zu Miriam gesagt, »ist doch schnurzegal. Wenn ich gut bin, brauche ich keinen Titel!«
Miriam fand nicht, dass die Freundin Recht hatte. Aber ihre Argumente blieben ungehört.
»Wenn ich eine Wohnung gefunden habe, kommst du nach«, sagte sie. »In Hamburg kannst du genauso studieren. Mir ist schon klar, dass du wenig Lust hast, allein mit Bea zu leben!« Bea Winter war Miriams Mutter, und ihr Verhältnis war denkbar schlecht. Gesine dagegen bewunderte Bea. Damals, als Bea noch am Theater in Berlin engagiert gewesen war, gab es keine Aufführung mit ihr, die Gesine versäumte. Sie saß dann im dunklen Zuschauerraum und wünschte sich, dass Bea ihre Mutter wäre. Wenn Bea auf die Bühne kam, spürte man, wie sie das Publikum fesselte. Sie war, fand Gesine, absolut einmalig. Groß, schlank, mit einem schmalen, länglichen Gesicht und dunklen Augen. Die halblangen, lockigen Haare hatte sie meistens in verschiedenen Rottönen gefärbt. Ihre große, leicht gebogene Nase gab Bea etwas Kühnes, Abenteuerliches. Als Bea angeboten hatte, bei ihr in Berlin zu wohnen, war Gesine froh. Endlich konnte sie ihrem warmen, aber kleinbürgerlichen Zuhause entfliehen. Bea war großzügig, machte keine Vorschriften und fragte nicht viel. Sie wirkte eher wie Miriams große Schwester, ohne das Gluckengetue, das Gesines Mutter immer an den Tag legte.
Miriam empfand das ganz anders. Sie fühlte sich ungeliebt. Miriam war Gesines beste Freundin. Sie waren als Nachbarskinder zusammen aufgewachsen, hatten gemeinsam die Volksschule besucht, die Oberschule und waren auch bei den jungen Pionieren gewesen. Die weizenblonde Gesine, mit ihrer blassen Haut, den spitzen Knien und Ellenbogen – und Miriam mit den dichten schwarzen Haaren, an der alles rund zu sein schien, waren unzertrennlich. Gesine wuchs mit ihren drei Brüdern in einem großen, alten Steinhaus auf. Ihr Vater war Schreiner und arbeitete in einem Kollektiv. Ihre Mutter war das, was man allgemein als »gute Mutter« bezeichnete. Sie kümmerte sich um ihre Kinder und ganz besonders um das einzige Mädchen. Ihre Brüder hatten alle Freiheiten, Gesine dagegen hatte gar keine. Ihre Mutter steckte ihre Nase in alles. Sie überwachte die Hausaufgaben, legte die Kleidung für den Tag raus und räumte in ihrem Zimmer das kleinste Fitzelchen weg. Gesine hatte sogar den Verdacht, dass ihre Mutter in ihren Sachen schnüffelte. Beweisen konnte sie es nicht. Wenn Gesine etwas ausgefressen hatte, hieß es: Du wirst schon sehen, was der Vati dazu sagt. Aber den Vati interessierte das überhaupt nicht. Gesine war sein Liebling.
Praktisch konnte sie bei ihm tun und lassen, was sie wollte. Zum Ausgleich setzte es dann Ohrfeigen von der Mutter, noch dazu begleitet von dem Spruch: »Das tut mir mehr weh als dir!«, oder »Das tu ich nur, damit du begreifst, was Zucht und Ordnung ist!«
Auf der anderen Seite war sie immer für Gesine da. Wenn sie krank war oder einfach traurig, dann kochte Herta Sager entweder Hühnersuppe für die Kranke oder Kakao für die Traurige. Sie sagte dann: »Dieser Kakao vertreibt alle Sorgen, meine Kleine!« Und manchmal hatte sie sogar Recht damit. Als Gesine den ersten Liebeskummer hatte, nahm Herta Sager ihr Mädchen in den Arm und drückte sie an ihren großen Busen. »Schäfchen«, sagte sie. »Die Männer sind schlecht und die Welt auch! Versuch du selbst nur immer anständig zu bleiben!«
Gesine hatte lange Zeit keine Ahnung, was ihre Mutter damit sagen wollte. Anständig sein, so schien es ihr, war etwas schrecklich Langweiliges. Sie wollte nicht langweilig sein und schwor sich: Ich werde nie anständig!
Mit der Zeit begann sie, ihre Mutter beinahe zu hassen. Immer wollte diese wissen, wo sie war. Immer fragte sie, mit wem sie sich getroffen hatte. Der Gipfel war die allzu oft wiederholte Bemerkung: »Eine Sager tut so etwas nicht!« Daraufhin rastete Gesine jedes Mal regelrecht aus. »Was ist denn Besonderes an einer Sager?«, fragte sie provozierend. »Du tust ja gerade, als wären wir das Königshaus!«
»Nein«, entgegnete Herta Sager dann. »Aber wir sind anständige Leute!«
Dass ihre Gesine sich so eng an Miriam anschloss, war Herta Sager anfangs gar nicht recht. Sie schätzte zwar Miriams Großeltern, den Dorflehrer und seine Frau; aber Bea, ihre Mutter, beäugte sie misstrauisch. »Die kümmert sich nicht um ihr Kind«, sagte Herta Sager oft. »Das wird sich später rächen!«
Gesine liebte ihre dunkelhäutige Freundin über alles. Sie verkörperte für sie das Abenteuer, das es in ihrer ›normalen‹ Familie nicht gab. Um Miriam gab es Geheimnisse, die interessanter waren als der ganze Dorfklatsch.
Miriam hatte bei den Großeltern gelebt, weil ihre Mutter, die Schauspielerin, in Berlin nur eine Einraumwohnung zugeteilt bekommen hatte. Doch der eigentliche Grund, so mutmaßten die Dorfbewohner, war Beas ausschweifender Lebenswandel. Wie immer bei derartigen Verdächtigungen, gab es auch hier ein Körnchen Wahrheit. Bea lebte in einer leidenschaftlichen Liebesbeziehung mit Miriams Vater, einem kubanischen Physikstudenten. Natürlich hätte ein Baby da gestört. Sooft Bea daran dachte, und das kam ziemlich selten vor, fuhr sie das winzige dunkelhäutige Mädchen besuchen. Manchmal kam auch Juan mit, der immer etwas verlegen am Tisch saß. Die Leute im Dorf guckten misstrauisch. Aber in der DDR war Völkerverständigung angesagt, und offen durfte man seinen Rassismus nicht zeigen. Trotzdem ließ man Miriam ihre Andersartigkeit spüren. Sie war das Schokobaby, obwohl sie nicht wirklich schwarz war. Spanisches, portugiesisches, kubanisches und deutsches Blut waren bei ihr zusammengekommen und hatten ihr diese olivfarbene Haut beschert.
Ihrer Großmutter verdankte sie ein enormes Selbstbewusstsein. »Du bist der Engel, den der liebe Gott in unser Dorf geschickt hat«, sagte sie. »Du bist etwas ganz Kostbares. Schau dir doch an, wie langweilig all die anderen Menschen ausschauen!«
Als Miriam fünf Jahre alt war, fragte sie nach ihrem Vater. Alle Kinder im Dorf hatten einen, nur sie nicht. »Aber du kennst ihn. Er hat dich mit mir zusammen besucht!«, sagte Bea damals. Doch Miriam konnte sich an den dunkelhäutigen Begleiter ihrer Mutter nicht erinnern.
Juan war ein Jahr zuvor nach Kuba zurückgekehrt. Bea hatte nach einem seltsam förmlichen Abschiedsbrief nichts mehr von ihm gehört. Sie war sich sicher, dass dies auch so bleiben würde. Deshalb hatte sie beschlossen, diesen Fehlgriff aus ihrem Leben zu streichen. Miriam war sechs Jahre alt, als sie bei einem Besuch ihrer Mutter erneut nach ihrem Vater fragte. »Er ist gestorben«, sagte Bea. »Eine schwere Krankheit.«
Monatelang trauerte das Mädchen um den toten Vater, an den es sich nicht mehr erinnerte. Gemeinsam mit ihrer Freundin Gesine baute sie in einer Ecke im Garten ihrer Großeltern eine Grabstätte für den Verstorbenen. Aus Ästen banden sie ein Kreuz, und Miriam schnitzte den Namen Juan hinein. Sie kannte weder seinen vollen Namen noch sein Geburts- oder Sterbedatum. Jeden Nachmittag nach der Schule besuchte sie ihre kleine Grabstätte. Der Unbekannte wurde zu ihrem Vertrauten. Ihm erzählte sie von ihrem ersten Liebeskummer, von den Lehrern, die ihr ungerechte Noten gaben, und wenn sie böse auf ihre Mutter war, dann erzählte sie ihm auch das. Bald nahm der Tote eine feste Stelle in Miriams Leben ein. Er wurde zu ihrem Verbündeten gegen alles Übel dieser Welt.
Nur Gesine wusste von den täglichen Besuchen in der Ecke des Gartens.
Einmal hatte Miriam Bea gebeten, ihr ein Foto des Vaters zu geben.
»Ich besitze keines!«, hatte Bea geantwortet. Miriam glaubte ihr nicht. Ein andermal hatte sie die Mutter aufgefordert, von ›ihm‹ zu erzählen. Wie sie sich kennen gelernt hatten. Wie er sie genannt hatte und warum er nicht hier bei ihnen geblieben sei. Bea hatte ausweichend geantwortet. Er habe Chemie und Physik studiert. Der Staat habe ihn ins befreundete kommunistische Ausland, in die DDR, geschickt. Er habe zurückgemusst, nach dem Studium. Miriam verstand nichts. Weshalb waren sie dann nicht mit ihm gegangen? »Hatte er mich denn nicht lieb?«, fragte sie. Aber Bea schüttelte nur den Kopf. »Ich weiß es nicht«, antwortete sie. »Er ist bald gestorben!«
So blieb die Gestalt von Juan ein großes Geheimnis, das nur in der Phantasie des Mädchens lebendig wurde.
Nach der Wende, Miriam war gerade dreizehn Jahre geworden, Gesine war zwölf, schmiedeten die beiden wilde Pläne. Um die Welt wollten sie fahren. Endlich raus aus dem muffigen Dorf. Aber noch blieben sie, wo sie waren. Das Geld war knapp. Jeder musste sich erst in der neuen Situation einrichten. Später gingen sie zusammen nach Berlin. Gesine wollte Design und Miriam Kunstgeschichte studieren. Bea, Miriams Mutter, hatte inzwischen eine große Wohnung und nahm die beiden Mädchen bei sich auf.
Als Bea wieder einmal bei einem Filmdreh im Ausland war, wollten die Mädchen ihr eine Freude machen und die Wohnung streichen. Beim Ausräumen fand Gesine eine Schachtel mit Fotos und Briefen. Darunter auch Ausschnitte aus kubanischen Tageszeitungen. Beide konnten kein Spanisch.
Doch der Mann, von dem die Artikel handelten, hieß Juan Rio de Ramos und das war, laut Aussagen von Miriams Mutter, der Name des verstorbenen Vaters. Miriam ließ sich die Artikel aus den Jahren 1998, 1999 und vom März 2000 übersetzen. Wenn es sich bei diesem Professor um ihren Vater handelte, so war er also quicklebendig. Die Zeitungen berichteten über das neue Institut, das für den verdienten Wissenschaftler errichtet worden war. Miriam war von ihrer Entdeckung völlig erschlagen. Gesine versuchte, die Ausschnitte herunterzuspielen.
»Das kann nicht sein!«, sagte sie der Freundin. »Warum sollte Bea dir erzählen, dass dein Vater tot ist? Das macht doch keinen Sinn! Frag sie!«
Miriam überkam eine ungeheure Wut auf ihre Mutter. Bea hatte sie nicht nur jahrelang belogen, sie hatte sie auch um den Vater betrogen. Ganz gleich, was ihr dieser Mann angetan haben mochte, Miriam glaubte ein Recht auf die Wahrheit zu haben. In Gedanken spielte sie die wildesten Szenarien durch. Dass Juan die Mutter verlassen hatte und sie zu stolz gewesen war, ihm nachzureisen. Dass er möglicherweise gar nichts von ihrer Existenz wusste, ganz gleich, was ihre Mutter auch von gemeinsamen Besuchen mit ihm bei den Großeltern erzählt hatte. Dass der Vater ein Spion war und die DDR hatte verlassen müssen. Sie würde zu ihm fahren. Würde sich vor ihn hinstellen und sagen: Ich bin Miriam, deine Tochter. Aber was, wenn er sie nicht empfangen würde? Wenn er Familie hätte, die nichts von ihrer Existenz wissen durfte? Miriam beriet sich mit Gesine. »Warte, bis Bea kommt. Sie wird dir sagen, was tatsächlich los war!«, sagte die Freundin. Doch je mehr Gesine zur Besonnenheit mahnte, desto verbissener klammerte sich Miriam an die Idee, ihren Vater zu suchen. Sie hatte in der Schachtel auch alte Fotos von Bea und Juan gefunden. »Schau mal«, sagte sie zu Gesine. »Das könnte doch dieser Mann auf den Zeitungsausschnitten sein! Der gleiche Gesichtsschnitt, das Lachen!« Gesine schüttelte den Kopf. »Miriam«, meinte sie, »du verrennst dich. Der Mann aus der Zeitung trägt einen Bart, und die einzige Ähnlichkeit ist, dass er ebenfalls dunkle Haare hat!«
»Warum sollte Bea diese Ausschnitte sonst aufgehoben haben, wenn es nicht mein Vater ist?« Miriam war wütend, dass Gesine sie zu bremsen versuchte. »Du weißt ja nicht, wie es ist, unehelich aufzuwachsen! Erinnerst du dich nicht mehr, wie die Leute im Dorf getuschelt haben? Wie sie Bea hinter vorgehaltener Hand eine Negerhure genannt haben!«
»Du übertreibst. Die Schwätzer haben über jeden gelästert, der aus der Stadt kam. Und deine Oma hat ihnen immer die Meinung gesagt. Stell dich jetzt bloß nicht als armes Opfer hin! Für uns in der Schule war es doch spannend, dass du eine andere Hautfarbe hattest, und die Lehrer haben dich auch immer bevorzugt. Außerdem, haben meine Eltern dich etwa komisch behandelt?«
Je länger Miriam über die Lüge ihrer Mutter nachdachte, desto gewaltiger wurde ihre Wut. Hatte Bea sie überhaupt haben wollen? War es nicht so, dass sie sofort bei den Großeltern abgestellt wurde? Wie eine Katze, die zu viel Mühe machte, in Pflege gegeben? Was tat die Mutter damals eigentlich allein in Berlin? Miriam glaubte nicht mehr daran, dass sie auf dem Land leben musste, weil es für ein Kind gesünder war. Weil der aufreibende Beruf von Bea ihr keine Zeit ließ, sich um sie zu kümmern. Ich habe sie immer nur gestört, sagte sie sich. War lästig, weil ich sie gehindert hätte, ihre Liebschaften zu empfangen.
Immer neue Liebschaften, wie sogar einmal der Großvater gemurmelt hatte. Was war ihre Mutter überhaupt für ein Mensch? Sie hatte genug von ihren Versprechungen, die sie nie einhielt. Von ihrer oberflächlichen Besorgtheit und den überschäumenden Zärtlichkeiten, wenn sie ein schlechtes Gewissen hatte. Weil sie vergessen hatte, zur Abiturfeier zu kommen, den Geburtstag zu feiern ... In Miriam stieg der Hass hoch wie bitterer grüner Magensaft. Sie würde weggehen aus dieser Wohnung, von Bea, aus Berlin.
Den Absprung aus Beas Wohnung und deren Leben hatte Miriam inzwischen ja geschafft. Aber wirklich glücklich war sie nicht. Und nun rückte auch der Plan, zu ihrer Freundin nach Hamburg zu ziehen, in weite Ferne. Wohin sollte sie, wenn Gesine jetzt heiratete?