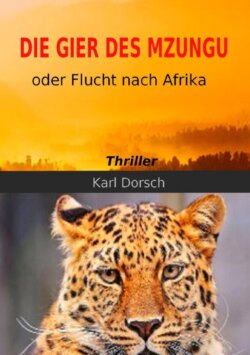Читать книгу Die Gier des Mzungu - Karl Dorsch - Страница 4
Оглавление1
Der weiße Leib schimmert blass auf der linken Seite des holprigen Ackerweges. Aus dieser Entfernung kann man sich nicht vorstellen, dass die Figur mannsgroß ist. Ein zur Kugel geschnittener Buchsbaum und die hölzerne Bank darunter sind um diese Tageszeit nicht mehr zu sehen, nur die schwarze Silhouette des Waldes hebt sich noch klar vom Himmel ab. Dort, wo der Weg durch die Bäume ins kleine Tal führt, ist ein noch schwärzeres Loch, eine Art Tunneleingang zu erahnen. Seitlich davon die Figur, inzwischen schon größer. Die Gedanken sind bei seinem Plan, trotzdem signalisiert in ihm etwas, wer weiß, vielleicht die Seele, das zum Anhalten rät. Der Kopf wehrt sich, es hat ja alles keinen Sinn. Seine Schritte werden langsamer, die Augen sind starr nach vorne gerichtet, auf den Weg zum dunklen Durchgang des Waldes. Er bleibt ruckartig stehen, links von ihm der bleiche Leib in zwei Meter Höhe, fährt mit den Fingern durch sein Haar und schaut verstohlen zu den nackten Zehen hinauf, ja nicht ins Gesicht.
Es ist still, ganz still.
Sein Atem ist flach, dann ein Seufzer, die Augen feucht und warum soll er nicht mit ihm sprechen? Es ist egal, ob er fünf Minuten früher oder später ankommt. Seine Blicke tasten sich ruckweise, wie eine Fliege am Fenster, von den Füßen bis zum Antlitz.
Dann nimmt er im Inneren einen Anlauf.
„Jesus!“, sagt er leise und sucht die schwarzen Pupillen unter den niedergeschlagenen Augen der Figur, will ihn dadurch zwingen zuzuhören.
Dann der nächste Anlauf.
„Jesus, Gott“, wiederholt er deutlich und laut, „du hast versagt, wie ich!“ Er sammelt sich. „Wie oft habe ich mit dir hier gesprochen, wie oft habe ich dich um Hilfe gebeten?“, klagt er an. „Und jetzt? Meine Frau hat einen Anderen, ich habe nichts mehr und bereue meinen Diebstahl zutiefst. Ich bin in einer Sackgasse, nein, einer Einbahnstraße die am Abgrund endet.“
Er wartet kurz und schnaubt wütend durch die Nasenlöcher, wie ein Stier in der Arena. „Was ist?“, zischt er. „So rühre dich oder gib mir einen Einfall!“
Hermann Purecker lauscht und hofft auf einen Einfall, ein Wort Gottes oder ein Wunder. Hofft seit Jahren ohne Erfolg. In seinem fünfundsechzigsten Lebensjahr muss er erkennen, dass sein Fleiß, seine Arbeit, am Ende zu nichts geführt haben. Er ist alleine. Seinen Lebensabend wird er zuerst in einer Zelle, später irgendwo in einer schäbigen Wohnung verbringen, mit abgetragener Kleidung, so wie jetzt.
„Nein, das ist nichts für mich“, beschloss er vor einer Stunde, „lieber mache ich Schluss.“
In einem halben Jahr hätte er Rente bezogen, er, der gesittete Leiter einer österreichischen Bankfiliale, ohne Vermögen, ohne Frau.
„Du hilfst mir also nicht“, sagt er ruhig und nickt bedächtig. „Gut, ich habe verstanden und werde dich auch nicht bitten, mir die nächste halbe Stunde zu helfen. Es wäre leichter, aber ich schaffe es auch ohne dich.“
Er presst die Lippen aufeinander, schnaubt nochmals trotzig aus und geht weiter. Tränen kullern über seine Wangen, es werden mehr, der Rotz rinnt aus der Nase und er beginnt lauthals zu Heulen. Traurigkeit, Verbitterung, Hass und Wut auf sich selbst, kommen zum Vorschein, schlüpfen durch ein Ventil, eine Öffnung seines lang unterdrückten Kummers, ins Freie.
„Das hätte ich früher machen sollen“, stellt er fest, „mir wird dabei besser und ich weiß jetzt, dass ich es schaffe, ohne diesen Gott.“
Der Weg ist abschüssig.
In seiner Hosentasche fühlt er die kleine metallenen Taschenlampe und holt sie heraus. Das wenige Licht reicht, um die nächsten Schritte vor ihm zu erhellen. Der Pfad durch den Wald mündet nach zweihundert Meter in einen quer verlaufenden, befahrbaren Flurweg. Er schaltet die Taschenlampe aus, das Restlicht des Himmels lässt den Schotter hell genug erscheinen. Hermann Purecker biegt rechts ein und geht weiter leicht bergab, bis der Weg eben verläuft. Das kleinen romantischen Tal führt durch fruchtbare Felder und Hänge mit Wald der Bauern.
Rentner haben vor vielen Jahren an einer Böschung eine Bank zum Verweilen errichtet. Alte Balken als Sitzfläche, darüber ein luftiges Dach aus Brettern, ein idealer Platz für ihre Treffen. Er setzt sich und holt aus der linken Hosentasche eine schmale Taschenflasche, einen Flachmann, öffnet und trinkt die hochprozentige Flüssigkeit ohne abzusetzen aus. Ein Versuch den Hustenreiz zu unterdrücken endet in heftigem Räuspern und Schlucken. Der Platz ist idyllisch und über dem Hügel auf der anderen Seite des Tales schimmert der Himmel, die Reflexion der Lichter seiner Geburtsstadt. Er hört leise das Rollgeräusch und weiß, dass es innerhalb der nächsten fünfzehn bis zwanzig Sekunden seinen Höhepunkt erreicht.
Als Kind liebte er dieses Brausen und Dröhnen, jetzt steht er dort und erinnert sich an früher. Es wird laut, durchbricht zunehmend die Stille und die Lichter rasen auf ihn zu, dann zehn Meter an ihm vorbei, zur nächsten Stadt. Die vier Waggons sind beleuchtet, nur ein einziger Fahrgast sitzt darin. In etwa zehn Minuten kommt der nächste Zug von der anderen Seite, bis dahin hat er noch Zeit. Die Wirkung des Alkohols wird das Vorhaben erleichtern. Hermann Purecker wirft die leere Flasche weg und hört ein Klirren.
„Das wollte ich nicht“, sagt er, schaltet die Taschenlampe ein und leuchtet nach dem zerbrochenen Glas. Er steht auf, geht hin und sieht, dass es auf dem groben Schotter des Gleises liegt. „Hier stören sie nicht“, denkt er und schlendert zurück. Das Sitzen ist angenehm, der Schnaps entspannt, lässt es zu, an nichts zu denken.
Nach geraumer Zeit sagt ihm sein Gefühl, dass er aufstehen muss. Die Taschenlampe legt er auf die Bank, vielleicht braucht sie jemand, Ordnung muss sein. Er durchsucht seine Taschen, findet nichts Wertvolles und steigt auf das Gleis. Der Spaziergang zwischen den Schienen wird kurz sein, der Zug soll ihn von hinten erfassen. Die Schritte sind wie die eines Greises, aber das Herz schlägt schnell, wie das eines Läufers, kurz vor dem Ziel. Ein feines Vibrieren überträgt sich auf seine Beine, dann hört er das Rauschen des Zuges. Es wird lauter, sein Körper wirft einen langen, diffusen Schatten, der wird kürzer und deutlicher und er schreit: „Herr, lass mich nicht allein!“
Hermann Purecker ist tot.