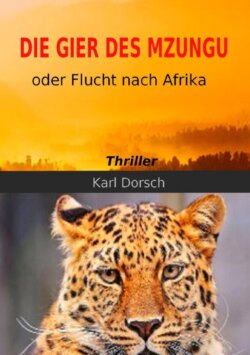Читать книгу Die Gier des Mzungu - Karl Dorsch - Страница 9
Оглавление6
„Diese schwarzen, streitsüchtigen Drecksvögel sollte man alle vergiften! Das ausgelegte Stück Schinken ist viel zu groß und trotzdem hacken sie nur darauf herum. Wieso eigentlich? Der Hund soll es fressen, der Hund und nicht diese widerlichen Viecher. Die Witterung wird ihn zuerst zum Abgrund führend und anschließend in den Wald. Und diese schwarzen Vögel zanken und schreien seit Minuten, wie stinkende Hyänen bei der Beuteverteilung im dunkelsten Afrika.“
Afrika! Ja, da wird er bald sein, morgen, genauer gesagt, übermorgen früh. Er muss dahin, es ist seine große Hoffnung, dann wird alles besser, in einem Jahr oder zwei. Er schafft das schon.
Das Gekreische geht ihm durch Mark und Bein. Vögel können schön und vielfältig singen, aber sie schreien ohne Pause in nur einem einzigen Ton. Er muss diese Viecher verscheuchen.
Kaum, dass Frank Roland hinter dem dichten Gebüsch am Waldrand hervorgeht, hüpfen die Krähen hastig zur Kante des alten Steinbruches und lassen ihn nicht aus den Augen. Er bückt sich, hebt kleine Steine auf und wirft. Es wirkt sofort, sie fliegen knapp über den Rand zur anderen Seite der Kluft. Er zielt nochmals auf einen dieser schwarzen Rabenvögel, der durch den Aufwind gekonnt in der Luft steht. Er will ihn nicht treffen oder töten, sondern nur verscheuchen. Töten will er an diesem Nachmittag einen anderen, jemanden, der fast zehn Jahre älter ist als er.
„Das Schwein muss sterben“, hat er vor vier Wochen beschlossen, der Teilhaber seiner Firma, der Verursacher seines Bankrotts: Rolf Roland, sein Bruder.
Ein gut ellenlanger, schwerer Eisenstab liegt bereit und sein Entschluss steht fest, er muss Deutschland danach verlassen, es bleibt ihm keine andere Wahl. Er hatte selber betrogen, auch da blieb ihm keine andere Wahl.
Eine Geschichte aus der Bibel kommt ihm in den Sinn: Kain und Abel, der Böse und der Gute. Kain, der Erstgeborene, war neidisch auf seinen Bruder Abel und erschlug ihn.
Nur dieses Mal wird es anders herum sein, er ist der gute Abel, der den bösen Kain tötet. Überhaupt ist alles ganz anders geworden, anders gekommen. Und der böse Bruder heißt nicht Kain, sondern Rolf und wird, wie alle Tage, seinen Hund spazieren führen. Immer den selben Weg, zur selben Stunde den Hang hinauf, knapp am Abgrund vorbei und auf der anderen Seite zurück zu seinem Haus. Der Hund wird vorauslaufen, heute den Köder wittern, sein Herr dahinter, in Gedanken versunken.
Frank Roland setzt sich wieder hinter den Strauch, die Deckung zwischen ihm und dem Pfad, zieht die Beine an und versucht sich zu beruhigen. Es geht nicht. Da knickt er kleine Zweige ab und wirft sie zur Seite. So hat er mehr Sicht und fühlt sich besser. Das war es wohl. Während er seinen Gedanken nachgeht, steht plötzlich der Hund am Anstieg und wittert nach oben, geradeso, als ob er ihn sehen könnte.
„Aber das ist unmöglich“, überlegt Frank, die Entfernung ist zu groß und er war nicht einmal für die Vögel sichtbar. Dennoch, der Hund spitzt die Ohren und sein schwarz und braun geflecktes Fell ist am Rücken leicht gesträubt. Was hat das Tier?
Ein schöner, großer Hund, nur leider launenhaft. Er hatte ihn betreut, wenn sein Bruder in den Urlaub flog, nur richtig gemocht hat das Tier ihn nie. Er wollte seinem Bruder damit Last abnehmen, auch die Last durch seine Frau, der Schwägerin, alkoholabhängig, fett, aufgedunsen und faul. Eigentlich ein asoziales Ehepaar, dabei wirken sie beängstigend normal. Nur, wer wollte es sehen? Er nicht, seine drei Schwestern nicht. Seiner Umwelt gegenüber gibt er sich freundlich und naiv, sein Handeln und Reden wirkt bedächtig. Aber er ist der Wolf im Schafspelz. Rolf Roland, der heimtückische Wolf, und im Grunde genommen ein armer Mensch. Nach oben hin bücken, nach unten hin drücken, so ist die Devise in seinem Leben.
Der Hund ist verschwunden und wo bleibt sein Herr? Endlich kommt der Bruder und pfeift. Das Tier kriecht aus einem niederen Dickicht, schüttelt sich und trottet den Weg hoch, sein Herr hinterher, seinem Ende entgegen. Rolf ist fast Sechzig und im letzten Jahr ein alter Mann geworden, mager wie eh und je, mit weißem, lichtem Haar. Die frisch geschnittene Frisur lässt den Kopf noch schmäler, seine große Nase noch größer wirken. Eine ausgewaschene Hose und der zu weite, grüne Pullover geben ihm das Aussehen eines Greises.
Er bleibt stehen, starrt trübsinnig vor sich hin, grübelt.
Das macht er öfter, weil er weiß, dass er sich nicht mehr herausreden kann, nie mehr, vermutlich zum ersten Mal in seinem Leben, er wurde endlich entlarvt. Das tat ihm weh, vor allem, weil er erkennen musste, dass ausgerechnet der jüngere Bruder Frank ihn durchschaute.
Und der sitzt hier im Gras und lauert.
Eine dunkle Wolkenbank schiebt sich vor die Sonne, das gelegentliche Vogelgezwitscher wirkt träge und durch die feuchte Luft entsteht ein erdiger Geruch. Die Landschaft ist düster und ergraut. Frank hockt mit krummen Rücken und beobachtet, wie Hund und Herr ihren gewohnten Weg weiter spazieren, beide die Nase nach unten gerichtet.
Ein Windhauch streicht von hinten über sein Haar, über seine geröteten Ohren, wie der gewollt geblasene Luftstrom aus einem anderen Mund. Er dreht sich um, niemand da. Dennoch glaubt er einen anderen Körper zu spüren, zu riechen, zu erahnen. Er streicht sein Haar zurecht, automatisch, setzt sich aufrecht hin. Der Regen hat sanft eingesetzt.
„Hoffentlich regnet es mehr“, überlegt er, „damit mögliche Spuren verwischt werden.“
Und so kommen ihm Gedanken, kommt ihm vieles in den Sinn, die Auseinandersetzungen, der wochenlange Streit, kaut er wieder und wieder, wie ein Rindvieh eben kaut, „und das bin ich auch“, erschrickt er, „ich habe nicht aufgepasst. Der Hund steht nur noch fünfzehn Schritte vor mir, schaut in meine Richtung, und er wird mich doch nicht entdecken, nein, denn dann ist mir alles egal, dann bring ich dieses Vieh auch um, Hauptsache es ist vorbei und wenn nicht, bringe ich mich um.“
Der Hund senkt seine Nase und schnuppert der Fährte nach bis zum Schinken. Er leckt daran, verschlingt ihn hastig und folgt der nächsten Fährte in den Wald. Dort wartet eine weitere Leckerei, in Brusthöhe fest an einem Ast gebunden, und er wird damit beschäftigt sein, zwei oder drei Minuten, so hat es sich der Mörder ausgedacht.
Rolf ist jetzt wo der Hund eben war und schaut interessiert in den tiefen Abgrund mit dem Rücken zu seinem Mörder.
Die Zeit für den Vollstrecker ist da!
Frank steht auf, umklammert mit beiden Händen das Eisen, die Knöchel werden weiß, kommt hinter seiner Deckung hervor und schleicht wie eine Katze beim Fangen einer Maus. Es sind nur noch drei Meter, da nimmt der Bruder den Kopf in den Nacken und stöhnt, geradeso als ob er eine Vorahnung hat.
Überzeugt davon, dass der Bruder spürt, was mit ihm geschieht, reißt Frank den Eisenstab hoch, denn Rolf will wahrscheinlich noch sagen: „Ich weiß nicht, was du willst, weiß nicht, was du hast“, dabei das überzeugende Gesicht eines Opferlammes machen, würde wieder ganz unverstanden dastehen, wieder schlüpfrig entgleiten.
Darin ist er Weltmeister.
Ein heftiger Schlag, mit aller Gewalt, ein dumpfes Knacken und es knirscht …,
… war er Weltmeister.
Rolf Roland ist tot!
Er liegt mit dem Gesicht nach unten am Rand des Steinbruchs und aus dem Hinterkopf tritt Blut, sucht zwischen den weißen Haare seinen Weg. Aus der Nase läuft Wasser, vielleicht ist es Schleim, Frank schaut nicht genauer hin, es würde ihn ekeln, auf alle Fälle ist Rot mit dabei. Mehr will er nicht wissen. Der tote Körper muss hier oben verschwinden, muss den senkrechten Abgrund hinabfallen, muss den Eindruck erwecken, dass Rolf Selbstmord beging.
Er zerrt hektisch an den Beinen, schleift ihn, rollt ihn bis an die Kante, gibt einen kräftigen Schubs und hört einen dumpfen Aufprall. Frank richtet sich kerzengerade auf, seufzt und atmet schwer, mit verschwommenem Blick nach nirgendwo, die Hände hängen schwer nach unten. Eine feuchte Brise steigt von einem kleinen Teich am Grunde auf und gegenüber, am Rande eines Wäldchens, sitzen die Krähen geduckt auf Ästen, beobachten interessiert das Geschehen, als stumme Zeugen eines Mordes.
Irgendwann blickt er nach unten, wo ein dünner, zarter Nebel theatralisch über den Boden der Senke zieht, über den Bruder und dieses Bild erinnert ihn komischerweise an seine Kindheit.
Aufgewachsen in einer kinderreichen Siedlung an einem Fluss mit vielen Altwässern, war das Peinigen und Töten von Fröschen eine Mutprobe der Kinder. Man katapultierte die armen Kreaturen hoch und lies sie auf den harten Boden fallen. Danach lagen sie auf dem Rücken und waren tot oder schwerst verletzt, alle Viere weit von ihrem feuchten Körper gestreckt.
So wie der Bruder jetzt. Kopf und Schultern sind vom Wasser des Tümpels umspült, Arme Körper und Beine ruhen auf dem Ufer, geradeso, als wolle er sich nach einem kurzen Schlaf dehnen und recken.
Ein Spruch aus der Bibel fällt ihm ein: Es ist vollbracht! Oder war es gar nicht das Wort Gottes? Er weiß es nicht mehr, denn das Glauben hat er irgendwann abgelegt.
Es regnet. Die Tropfen sind groß und schwer. In seinen Ohren rauscht es. Kommt das vom Regen oder von seinem schnell fließenden Blut? Ihm ist weder kalt noch warm, nur ein kurzer, lauer Hauch umspült flüchtig seine rechte Hand, nochmals, immer wieder diese Andeutung von warmer Luft an den Fingern. Da erschrickt er, springt zur Seite, reißt den Arm hoch und fuchtelt wie ein Ertrinkender.
Der Hund!
Der Hund steht neben ihm und hat seine Hand beschnuppert, schaut fragend in sein Gesicht. Er streichelt über den Kopf des Tieres und schaut ihm in die Augen, ansprechen mag er es nicht. Der Hund wird lange nach seinem Herren suchen und ist irgendwann zu Hause.
„Ich sollte jetzt gehen“, überlegt Frank, „eine Stunde habe ich Vorsprung, aber zuvor muss ich die Spuren verwischen, das Seil vom Ast binden und die Eisenstange mitnehmen.“
Er sucht konzentriert am Tatort nach verräterischen Spuren, stellt abgeknickte Gräser auf, als ob hier keiner gewesen wäre, wirft kleine, trockene Zweige auf seinen Sitzplatz, vergewissert sich, dass nichts dem Zufall überlassen ist. Der Hund ist wieder in den Wald gelaufen, vermisst etwas, das er nie mehr finden wird. Der Mörder, nein, der gerechte Richter und Vollstrecker, zumindest sieht er sich so, blickt sich zum letzten Mal um. Der Himmel hat eine passende traurige Farbe angenommen. Bäume werden schwarz, das Gelände trostlos und die dunkle Teichoberfläche kräuselt sich. Die Leiche blendet er aus. Zeit zu gehen, Zeit für eine neue Zukunft.
„Ist mir jetzt gut oder schlecht?“
Der Rückweg zu seinem Auto ist ein schmaler Trampelpfad. Auf der anderen Seite des Waldes, in einem schwer einsehbaren Feldweg, hat er geparkt. Nach den ersten, eilig gegangenen Minuten wird er ruhiger, lauscht. Es regnet stärker, die Luft wirkt kühler, die Bäume noch schwärzer. Seine Sinne sind geschärft und von irgendwoher riecht er Autoabgase. Er bleibt stehen, schnuppert wie der Hund geschnuppert hat, horcht auf ein Rascheln im Laub oder das Knacken der Zweige. Dort, wo der Pfad endet, wischt für einen Augenblick ein Schatten durch eine Fichtenschonung.
Frank springt wie ein Hase mit zwei, drei Sprüngen hinter einen Baum, die Eisenstange fest umklammert, schielt mit einem Auge zur Einzäunung und presst sich an den Stamm. Er wartet voller Furcht auf eine neue Bewegung, eine Silhouette, ein verräterisches Geräusch. Als seine Geduld erschöpft ist, rappelt er sich auf, macht leise einen Bogen um die Schonung und fühlt sich erleichtert beim Anblick seines Autos. Bevor er einsteigt dreht er sich wie zufällig um, sucht aus den Augenwinkeln und kann nichts entdecken. Dennoch hat er das Gefühl beobachtet zu werden. In der Fichtenschonung knackst es.
„Stehen bleiben und abwarten oder losfahren?“, rätselt er und entschließt schnell zu verschwinden, seinen Plan weiter zu verfolgen. Und der war und ist einfach: Zuerst das restliche Vermögen in Sicherheit bringen, Rache nehmen, dann über Zwischenstationen nach Südafrika oder Namibia und mit neuer Identität nach Deutschland zurückkehren. Die ersten beiden Ziele sind erreicht, morgen nach Mombasa und der Rest wird auch gelingen.