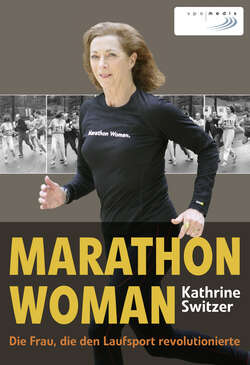Читать книгу Marathon Woman - Kathrine Switzer - Страница 10
Kapitel 4 »Ich schätze, ich habe sie abgewimmelt.«
ОглавлениеMein Wohnheim auf dem Campus der Syracuse University hieß Huey Cottage. Es war ein baufälliges altes Haus in der Comstock Avenue, die reinste Feuerfalle. Ich hatte die einfachste Wohnmöglichkeit gewählt, da ich den beträchtlichen finanziellen Druck auf meine Eltern reduzieren wollte. Syracuse war schon damals teuer, und ich hatte Schuldgefühle.
Mein Zimmer lag im obersten Stock, drei Treppen, und ich teilte es offensichtlich mit zwei anderen Frauen, denn in der geräumigen Dachgeschosswohnung standen drei Betten. Wir erhielten Schlüssel und konnten kommen und gehen, wann wir wollten, und als die »Hausdame« (eine Studentin im letzten Semester, die mit dieser Arbeit ihre Miete verringerte) mir meinen Schlüssel aushändigte, bekam ich vor Aufregung über die Freiheit weiche Knie.
Als ich mich nach ein paar Tagen eingerichtet hatte, kam ich nach einem langen Tag der Orientierung nach Hause und siehe da: Meine Mitbewohnerinnen waren da. Sie saßen auf der Bettkante, rauchten und unterhielten sich. Sie kannten sich offensichtlich, sie wohnten bereits seit zwei Jahren hier zusammen. Ich war die Neue. Ich sagte fröhlich und selbstbewusst: »Hi, ich bin Kathy!«, aber die beiden starrten mich wortlos an und rauchten weiter. Schließlich stieß eine von ihnen den Rauch aus und sagte: »Ach herrje.«
Ich brauchte keine zwei Sekunden, um zu merken, dass ich ihnen wie die Langeweile in Person vorkam. Hier, hatte ich gedacht, sei ich total »in« mit meinem geblümten Sommerkleid mit rundem Ausschnitt, Handtasche und dazu passenden Schuhen. Die beiden trugen Jeans, schwarze Rollkragenpullover und Creolen.
Der Code hier hieß »cool«, also eilte ich in die Marshall Street und kaufte Jeans und einen Rollkragenpullover. Nicht, dass das etwas geändert hätte – ich war und blieb das fünfte Rad am Wagen. Und dass ich sie gleich fragte, ob sie wüssten, wo hier die Geschäftsstelle der AAU sei, machte es nicht besser.
Nach dem offiziellen Beginn des Semesters eilte ich zum Büro der Sportfakultät im Manley Field House. Um genau zu sein: zum Büro der Sportfakultät für Männer, denn das Büro für Frauen war gerade nicht besetzt. Was bestätigte, dass an den großen Universitäten Sport gleichbedeutend war mit Fußball und Basketball, alles für kräftige, von Stipendien unterstützte männliche Studenten. Für Frauen waren keine Stipendien vorgesehen. Für Frauen gab es »Spiel- und Sporttage«. Das hatte ich bereits vor Syracuse gewusst und es war mir, offen gestanden, auch egal. Ich ging davon aus, dass die Frauen in Syracuse und vergleichbaren Universitäten eben keine Wettkämpfe mit anderen Colleges wollten, sonst hätten sie sie. Damals hatte ich mich bereits für das Laufen als Sportdisziplin entschieden und soweit ich wusste, gab es keine wettkampforientierten Frauenlaufgruppen. Wenn möglich, würde ich also in einem Männerteam laufen, sonst eben allein. Da ich nichts zu verlieren hatte, ging ich voller Selbstvertrauen zum Büro des Leichtathletiktrainers Bob Grieve und erkundigte mich, ob ich mit der Crosslaufmannschaft laufen könnte. »Stimmt, ich habe von dir gelesen. Ja, in der Sports Illustrated, in der Rubrik Gesichter in der Menge«, sagte er, nachdem ich ihm erzählt hatte, dass ich in Lynchburg für das Männerteam gestartet war. Ich fand ihn recht nett. Mit ihm befanden sich noch zwei Männer im Büro, die so taten, als hörten sie nicht zu. Einer war um die fünfzig, dünn und absolut harmlos. Der andere war fünfundzwanzig, sehr groß, sehr attraktiv, und jedes Mal, wenn er aufsah, starrte ich ihn an mit meinem »Leg-dich-bloß-nicht-mit-mir-an-du-Klugscheißer«-Blick, bis er die Botschaft verstand und das Büro verließ. Dann sagte Trainer Grieve freundlich: »Schau, Syracuse ist Mitglied der NCAA-Conference, nur für Männer, das heißt, es verstößt gegen die Regeln, Frauen an den Wettkämpfen teilnehmen zu lassen. Aber ich habe nichts dagegen, wenn du mit den Männern trainieren willst.« Das reichte mir voll und ganz, mehr noch, ich wollte nicht gegen jemand von Lynchburg antreten und gewinnen, und mit Sicherheit würde ich nicht schneller sein als jemand von den großen Universitäten.
Er erklärte mir noch, dass das Team auf dem Golfplatz von Drumlin trainierte, etwa eine Meile von der Halle entfernt. »Wie kommt man hin?« fragte ich. Er zögerte einen Moment und in seinem Gesicht bemerkte ich leisen Zweifel. »Wir laufen hin«, sagte er.
Ich ging die eine Meile zum Wohnheim zurück und überlegte, dass ich nach Drumlin zwei Meilen hin- und zwei Meilen zurücklaufen müsste, was mehr war als mein tägliches Laufpensum. Und wer weiß, wie viel ich im Training laufen müsste! Ich kam mir wie eine Idiotin vor, die sich für das Superlaufgenie hielt, nur weil sie täglich drei Meilen rannte, aber ich hatte gesagt, dass ich hingehen würde, und ich ging hin. Im Büro sagte Trainer Grieve zu dem älteren Mann: »Ich schätze, ich hab sie abgewimmelt.«
Am nächsten Tag nahm ich ein Taxi zum Golfplatz. Als ich bezahlte, witzelte ich im Stillen, dass Laufen letztlich doch kein billiger Sport sei und dass ich schnell besser werden müsste, um nicht pleite zu gehen. Ich brauchte eine Tasche für das Geld, deshalb trug ich lange Hosen und eine langärmlige Bluse. Ich hatte noch nie Crosslauf trainiert und wusste daher nicht, was man dafür anzog. Jetzt war ich nervös, weil ich in die Mitte des Fairways musste, wo all die mageren Typen in orange-weißen Shorts im Kreis herumliefen. Sie würden mich hassen. Die coolen Mädchen von Syracuse traten in Studentinnenverbindungen ein und sahen jede Minute gut aus. Sie liefen nicht.
Als ich auf sie zuging, rannte der harmlose ältere Typ aus dem Büro von Trainer Grieve auf mich zu, begrüßte mich, hoppelte um mich herum wie ein Hase. »Hey, ich bin Arnie, wir hatten hier noch nie ein Mädchen! Du bist Kathy, stimmt’s? Hallo, Jungs, das ist Kathy, und sie wird mit uns trainieren!« Die Jungen begrüßten mich, hießen mich willkommen. O mein Gott, dachte ich, so weit, so gut. Plötzlich gerieten sie in Bewegung, standen dann in einer Reihe, und Coach Grieve pfiff auf der Trillerpfeife. Dann rannten sie wie eine Windhundmeute los, über den sanft gewellten Rasen. Ihre Schnelligkeit und Schönheit nahm mir den Atem. Sie stoben über die grüne Weite und schienen die langen Steigungen hinaufzutreiben, verschwanden zwischen den Bäumen. Der attraktive Assistent nahm die Zeit mit der Stoppuhr, schrieb etwas auf sein Clipboard. Er hieß Tom, und bei seiner Statur war er mit Sicherheit kein Läufer. Ich hatte ihn im Büro des Trainers niedergestarrt, und jetzt würdigte er mich keines Blickes.
Trainer Grieve saß auf einem motorisierten Golfcart, und Arnie setzte sich neben ihn. »Okay, wollen wir mal sehen, was du kannst«, sagte der Trainer. Er zeigte auf die lange Begrenzung des Golfplatzes und fragte, ob ich die Strecke laufen könnte. »Klar«, sagte ich, es waren ja höchstens zwei Meilen. Lachend fügte ich hinzu: »Nur nicht so schnell!« Dann lief ich los, beschloss, ein gleichmäßiges Tempo zu laufen, da ich nicht wusste, was sie noch mit mir vorhatten. Als ich zurückkam, hatten einige Erstsemester ihr Training beendet, und der Trainer bat einen Studenten, mit mir über ihren Kurs zu joggen. Ich entschuldigte mich für mein langsames Tempo, aber den jungen Mann störte das nicht, er würde sich sowieso gerade auslaufen, was immer das bedeuten mochte. Und so endete mein erster Trainingstag mit insgesamt fünf Meilen in langer Hose und Bluse, ich hatte ein gutes Gefühl und war glücklich, dass ich mich nicht ganz zum Narren gemacht hatte. Arnie bot mir an, mich nach Hause zu fahren. Er konnte nicht wissen, wie dankbar ich sein Angebot annahm, und erzählte ohne Punkt und Komma von seinen guten Zeiten als Läufer, dass er sogar Zehnter beim Boston Marathon geworden sei und immer noch, nach all den Jahren, den Upstate-New-York-Marathon-Rekord hielt, kannst du dir das vorstellen, aber jetzt sei er verletzt, er hatte es am Knie und an der Achillessehne, nun, das kam vor, er sei zum Laufen zu alt, die Arbeit als Briefträger sei schon hart genug, er war wirklich der Postbote in der Comstock Avenue, und deswegen würde er mit dem Auto zum Golfplatz fahren und nicht laufen, und er sei seit 25 Jahren verheiratet, aber seine Frau habe das Laufen von Anfang an gehasst, habe einfach nie verstanden, was er daran so liebte, nun, das wissen wir ja auch nicht, nicht wahr? Jedenfalls arbeitete er mit dem Team und half beim Training der Jungen, seit er aus dem Zweiten Weltkrieg heimgekehrt war. Im Zweiten Weltkrieg hatte er sich beim Absprung mit dem Fallschirm über Frankreich den Rücken gebrochen. Der Arzt dort meinte, er solle laufen, um Arthritis zu vermeiden, also könnte er auch gut Trainer Grieve hier helfen, der ihn brauchte, er wurde ja auch nicht jünger, und so bin ich hier der »inoffizielle Teammanager«. Er grinste. Wir gaben uns die Hand, und ich bedankte mich. »Bis morgen«, rief er mir zu, als ich aus dem Auto stieg.
Ich trainierte jeden Tag. Manchmal lief ich zum Golfplatz, aber meistens holte Arnie mich am Huey Cottage ab, sobald er seine Briefträgertour beendet hatte. Wir fuhren erst zur Sporthalle, wo wir uns umzogen, und dann zum Country Club. Ich hatte beschlossen, während der ganzen Zeit auf dem Golfplatz zu laufen, aber ich war sehr langsam und konnte nicht mal mit dem langsamsten Läufer mithalten. Ich wusste auch nicht, welche Strecke ich nehmen sollte, da ich den Golfkurs nicht kannte. Bald fing Arnie an, ein bisschen mit mir zu joggen, wahrscheinlich tat ich ihm leid, aber er dachte auch, dass er trotz seiner Behinderung mit mir Schritt halten könnte. So wurden wir zu einer festen Größe, der humpelnde und schlurfende ältere Mann neben der jungen Frau, die locker, aber langsam lief.
Arnie schnatterte die ganze Zeit wie eine Ente. Er war voller Geschichten, und für mich war dieses viele Laufen so ungewohnt, dass ich nicht noch die Puste hatte, dabei zu reden. So lief ich, schnaufend wie ein Zug, neben ihm, und manchmal stieß ich eine keuchende Antwort aus. Es war erstaunlich, wie wenig kardiovaskuläre Kapazität Arnie im Lauf der Jahre verloren hatte und wie fit er wirkte. Sicher, seine Haare waren grau, er wurde kahl, er hatte tiefe Falten im Gesicht, aber er war schlank und, wie alle Läufer, hatte er fabelhafte Beine. Er trug immer graue Shorts und ein graues T-Shirt, und wegen seiner grauen Haare und seinem leicht aschefarbenen Gesicht nannte ich ihn immer Mr. Monochrom. Ich konnte ihn aufziehen, und er mochte das. Aber, um die Wahrheit zu sagen: Wenn er nicht dieses verletzte Knie gehabt hätte, hätte er es mit etlichen dieser jungen Männer aufnehmen können, und ich habe ihn von Anfang an bewundert. Immerhin war er schon fünfzig! Uralt!
Jeden Tag hatte Arnie eine neue Geschichte vom Boston Marathon auf Lager. Er war ihn fünfzehn Mal gelaufen. Und obwohl ich auch manchmal etwas über die heiße Zeit in Yonkers erfuhr, die Buddy Edelen ruinierte, oder von Arnies Triumphen beim Around-The-Bay-Lauf, erzählte er doch meistens eine weitere Geschichte über Boston. Darüber, wie er trotz der großen Hitze im Jahr 1952 Zehnter wurde oder vom legendären Johnny Kelley, dem Älteren, der dutzende Male den Boston Marathon gelaufen war, und von Johnny Kelley, dem Jüngeren, der nicht mit dem anderen Kelly verwandt war und 1957 gewann, oder von Tarzan Brown, der während des Wettkampfes in einen See sprang, einfach weil ihm zu warm war. Arnie lief inzwischen schmerzfrei; das weiche Gras und das lockere Tempo taten ihm gut. Die Tage und die Meilen flogen vorbei, und bald würde Arnie alle seine fünfzehn Boston-Geschichten erzählt haben und wieder von vorn anfangen. Es war wie die Schleife eines Films, die alle zwei Wochen von vorn anfängt. Er hätte mir genauso gut Geschichten über Achilles und Hector, Ajax und Apollo erzählen können, denn Arnies Helden wurden meine Götter, und Boston wurde für mich heiliger als die olympischen Gefilde.
Drei Monate später, im Dezember 1966, saß ich auf den Zuschauerplätzen in der Sporthalle und wartete darauf, dass Tom, der attraktive Trainer-Assistent, Student im letzten Semester, seine Arbeit als Trainer beendete. Ich fühlte mich rundherum wohl. Arnie und ich waren zehn Meilen auf der Straße gelaufen, draußen war es dunkel und kalt. Bei Wind und Wetter zu laufen erfrischte mich, ich fühlte mich wie gereinigt. Und dass ich die zehn Meilen geschafft hatte, konnte ich mir im Kalender rot anstreichen. Tom und ich hatten jetzt eine Beziehung auf freundschaftlicher Basis. Er hatte gesagt, dass meine einfachen Stoffturnschuhe ungeeignet wären, und als er merkte, dass ich keine anderen Schuhe kannte, hatte er mir freundlich angeboten, mit mir zu einem Spezialgeschäft zu gehen, wo ich Schuhe in guter Qualität aus Deutschland bestellen konnte. Heute Abend war Shoppingabend.
Außer mir trainierte die gesamte Crosslaufmannschaft seit einem Monat drinnen, in der Halle. Sie liefen auf der Bahn, elf Runden waren eine Meile. Ich hasste natürlich das Bahnlaufen. Mir missfiel nicht nur der Drill, wie Hamster im Laufrad, sondern auch das Ziel, nämlich möglichst schnell zu laufen. Ich wollte lange laufen können, nicht schnell. Als ich meine ersten Sprinteinheiten in der Halle absolviert hatte, schmeckte es danach jedes Mal wie Blut in meiner Kehle, und meine Beine waren weich wie Gelee.
Außerdem hasste ich das Innere der Sporthalle, damals war der Innenraum mit Sand belegt, und alles war voller Staub. Um den Staub einzudämmen, kam alle zwei Tage eine Maschine und spritzte Öl auf den Sand. Die Folge war, dass man nicht nur staubig, sondern auch schmierig wurde, das Haar roch nach Motoröl, und Nase und Lunge füllten sich mit Partikeln, die meinem Gefühl nach bestimmt nicht ungefährlich waren. Einer der wichtigsten Gründe für das Laufen war schließlich, meine Lunge täglich mit frischer, sauberer Luft zu füllen. Ich war überzeugt davon und bin es heute noch, dass eine Stunde tiefes Ein- und Ausatmen an der frischen Luft mehr Krankheiten heilen kann als jedes Medikament. Deshalb hatten Arnie und ich beschlossen, dem Winter die Stirn zu bieten und weiterhin draußen zu laufen. »Bisher ist niemand mit mir den Winter durchgelaufen!«, jubelte Arnie.
Tom war in seinem Element, er arbeitete mit den Werfern, nicht mehr mit den Crossläufern. Ich wurde nie müde, ihn dabei zu beobachten, wie er demonstrierte, auf welche Weise man mehr Schwung aus den Drehungen in die Diskusscheibe oder aus der Hüfte in den Stoß der Kugel bringen kann. Es war faszinierend. Tom war gelenkig wie ein Tänzer, eine ungewöhnliche Eigenschaft für einen so großen und stattlichen Mann. Er war nur 1,795 Meter groß (der halbe Zentimeter war wichtig für ihn, denn er mochte den Spitznamen Big Tom) und wog über zwei Zentner. Er hatte gewaltige Oberschenkelmuskeln, einen breiten Rücken, breite Schultern, einen starken Hals, aber keine besonders auffallende Arm- oder Wadenmuskulatur. Und vergleichsweise winzige Füße – vielleicht Größe 41. Die Füße waren sein besonderer Stolz, ein echter Pluspunkt für einen potenziellen Hammerwerfer von Weltklasse, weil er dadurch seine Drehungen schneller ausführen konnte. Wenn er den Werfern zeigte, wie sie sich bewegen sollten, wirbelten seine Füße herum, sie waren ihm nie im Weg. Er vollführte beim Hammerwerfen eine geradezu phänomenale Pirouette, seine Füße waren ein einziger Wirbel. Ich fand sein Können bei diesem mir völlig fremden Vorgang fabelhaft; so unerfahren ich auch war, ich konnte ein echtes Talent erkennen. Er konnte den Hammer nicht oft werfen, weil das zu gefährlich war, und er warf ihn fast niemals in der Halle – es sei denn, sie war leer, was fast nie der Fall war, und solange das Wetter blieb, wie es war, konnte er nicht unter freiem Himmel werfen. Also trainierte er mit den jüngeren Werfern aus den niedrigeren Semestern, stemmte Gewichte und ersetzte das Hammerwerfen durch das Werfen von kiloschweren Gewichten, was er ohne Gefahr in der Halle machen konnte, da sie nie sehr weit flogen.
Seine Brust und sein Bauch waren außerhalb der Wettkampfsaison etwas wabblig, aber wenn er in Form war, wurde alles wieder fest und stramm, ohne besonders ausgeprägt zu sein. Er gehörte zu den Männern, die nicht so sehr Kraft ausstrahlten, als vielmehr Zuverlässigkeit. Tatsächlich sah er den Männern auf den Fotos von meinem Großvater und Urgroßvater ähnlich – sie waren breit und hatten einen tiefen Körperschwerpunkt. Man konnte Tom nicht mal eben umhauen und ein Mädchen fühlte sich sicher bei ihm. Ein sexy Typ war er eher nicht. Wäre er ein freundlicherer Mensch gewesen, ein Mann, der auch mal lächelte, hätte er als Teddybär durchgehen können. Aber so war er nur selten, dafür meistens ungeduldig! Wenn er mit den Werfern arbeitete, hörte man nie ein »Okay, das ist schon besser!«, sondern: »Jetzt aber, die Hüften, die Hüften, Hüften, Herrgott noch mal!!!«
Die Kombination dieser Eigenschaften machten ihn für mich ungeheuer attraktiv. Mit vielen seiner Charakterzüge war ich vertraut, ich schätzte sie – die Stärke, das Können –, hinzu kamen Eigenheiten, die mir völlig fremd waren und die mich faszinierten: Er war oft launisch und herrisch. Aber vor allem war er der geborene Athlet. Ich kannte niemanden, der von Natur aus talentiert war. Ich kannte nur Menschen, die hart arbeiten mussten. Wie sehr ich mich auch bemühen würde, ich wusste, dass ich keine herausragende Begabung hatte – das galt nicht nur für mein Laufen, sondern auch für mein Aussehen und meine intellektuellen Fähigkeiten. Ich war nur besser als der Durchschnitt, und deshalb fühlte ich mich Tom nie ebenbürtig, was ihn perverserweise noch attraktiver für mich machte, denn dadurch stand er für mich eine Stufe höher. In der Tat gibt es keine objektive Größe für adoleszente Logik, obwohl ich nicht weiß, ob man mit neunzehn die Adoleszenz noch als Entschuldigung anführen kann.
Ich war also an dem Abend, als wir die Schuhe kauften, überrascht und geschmeichelt, als Big Tom mich fragte, ob er mich noch zum Dinner einladen dürfe, und er war plötzlich zugänglicher, weniger unerreichbar und sehr interessant. Er schüchterte mich immer noch ein, schließlich war er die Sportskanone, vier Jahre älter als ich und wusste mehr über Sport als alle Menschen, die ich kannte. Er erzählte mir von seinen Plänen, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, das war sein ehrgeiziges Ziel, aber er fühlte sich von der AAU, der nationalen Sportkommission, eingeschränkt. Die AAU organisierte die Wettkämpfe, in denen die Sportler sich für Olympia qualifizierten, wir hatten nur diese eine Stimme in der IAAF, dem internationalen Leichtathletikverband der Amateure, und dieser Verband wiederum war als einziger stimmberechtigt im Internationalen Olympischen Komitee (IOC). Die AAU war übermächtig, und ihre Regeln für Amateure hielten Tom davon ab, mehr mit seinem Sport zu verdienen als ein studentischer Assistenztrainer in Syracuse. Er erzählte mir Horrorgeschichten von der AAU, die Sportler nach der geringfügigsten Übertretung ausgeschlossen hatte. Man musste die Regeln haargenau einhalten, um nicht als Profisportler eingestuft zu werden und nie wieder als Amateurwettkämpfer antreten zu dürfen. Das war wirklich tragisch, denn niemand hatte so viel Geld, um zu Wettkämpfen anreisen oder sich eine anständige Ausrüstung kaufen zu können oder, und das war das Schlimmste, so viel Zeit zu haben, um richtig trainieren zu können. Sein Traum, sagte er, sei es, ein paar Jahre zu haben, in denen er einfach nur trainieren dürfte, dann wäre er mit Sicherheit ein Olympionike. Wow, ich war beeindruckt. Innerhalb weniger Wochen wurden wir ein »Paar«.
Kurz vor den Weihnachtsferien kam ich eines Tages nach meiner letzten Vorlesung um 16.05 Uhr aus dem Hörsaal und war so müde, dass ich vor dem Abendessen nur noch ins Bett fallen und ein bisschen schlafen wollte. Es war schon fast dunkel und es schneite heftig. Arnie stand mit dem Auto vor der Tür, er parkte im absoluten Halteverbot und hielt unruhig nach mir Ausschau. Er hoffte, mich unter der Menge der Studenten zu finden, ehe die Campuspolizei ihn zum Weiterfahren auffordern konnte.
Ich hasste seine Beharrlichkeit. Ich hasste sogar ihn. Wir hatten uns nicht für heute verabredet, er war einfach gekommen, weil er wusste, wann meine letzte Vorlesung zu Ende war und ich ihm nicht entkommen konnte. Missmutig stieg ich ein, er dagegen war bestens gelaunt. »Hast du deine Sachen dabei?« Er war immer bereit, so wie ein Hund, der immer begeistert nach dem Stöckchen rennen will. Ich schämte mich sofort für diesen Gedanken, aber ich wollte nicht weich werden. »Ich laufe heute Abend nicht, ich bin einfach zu müde«, erklärte ich schnippisch. »Ich habe meine Sachen auch nicht mit, sie sind im Wohnheim.« »Ohhh, oh«, lamentierte er, als ob ich ihm eine große persönliche Enttäuschung bereitet hätte! Ich mochte es nicht, wenn Arnie jammerte, und er jammerte ständig. Es war seine Entscheidung gewesen, im Auto weiß Gott wie lange zu warten, nicht meine. »Wie wäre es mit einem lockeren 6-Meilen-Läufchen, damit bist du im Handumdrehen fertig«, schlug er vor.
Ich zankte mich mit ihm, bis ich merkte, wie kindisch ich mich verhielt und wie viel Zeit ich verschwendete. Ich konnte genauso gut Laufen gehen, ich würde sowieso keinen Schlaf mehr bekommen, da die Studenten schon in den Speisesaal strömten, also schnappte ich mir meine Laufsachen, und wir fuhren zur Sporthalle, um uns umzuziehen. Wegen meines Zögerns hatten wir fast eine Stunde verloren, und ich war nicht nur beschämt, sondern auch wütend auf mich selbst, weil ich immer zu wenig Zeit hatte. Wir würden uns beeilen müssen, damit der Speisesaal nicht schloss, bevor wir vom Laufen zurückkamen, und so wie die Dinge jetzt standen, würden sowieso nur noch die letzten festgebackenen Reste irgendeines Auflaufs in den Töpfen übrig sein. Das machte mich noch wütender auf Arnie.
Als wir aus der Hintertür der Sporthalle in die Colvin Street kamen, lag der Schnee bereits zehn Zentimeter hoch, und die Reifenspuren der Autos waren trotz der Rushhour fast sofort wieder zugeschneit. Zunächst bahnten wir uns auf einer einzigen Spur am Straßenrand den Weg, fanden unseren Rhythmus neben den vorbeisausenden Autos und Scheinwerfern entlang der Kurven und Unebenheiten der Straßen, die wir nicht mehr sehen konnten, die uns aber sehr vertraut waren. Der Schnee trieb hinter uns her, wurde über unsere Köpfe geweht und wogte vor uns wie ein flatterndes Segel, das von den Straßenlaternen herunterhing. Die Autos fuhren in den Schneesturm hinein und ich wusste, dass sie weder deutlich sahen, wohin sie fuhren, noch uns rechtzeitig bemerkten. »Was für ein blödsinniger Abend zum Laufen, wir werden möglicherweise umgefahren, aber das kann mir jetzt auch egal sein!«, dachte ich damals.
Als wir uns dem Golfplatz näherten, wurde die Straße ländlicher, es gab kaum noch Verkehr, wir rannten Seite an Seite, im Gleichschritt. Wir konnten ein paar Meter weit sehen, deshalb hatten wir Zeit, die Straße zu verlassen, wenn ein Auto sich näherte. Ich fühlte mich sicherer, war aber immer noch sehr nervös und lief verkrampft. Der beste Teil des Laufens war, wenn die Anspannung verschwand, wenn sie verflog in dem Strom der unzusammenhängenden Gedanken und Ängste und ich frei und locker lief. Das geschah immer dann, wenn ich es zuließ oder einfach nur lange genug lief. Aber an jenem Abend hatte ich schlechte Laune, und aus irgendeiner selbstzerstörerischen Anwandlung heraus wollte ich auch schlecht gelaunt sein. Ich rannte und schlug auf die Luft ein wie ein Boxer. Arnie spürte das und wollte eine Unterhaltung in Gang bringen, hörte von mir aber nur einsilbige Antworten oder ein Grunzen. Trotz dieser weißen grenzenlosen Weite fühlte ich mich wie in einem Gefängnis, in dem ich unerträglich lange mit diesem Mitgefangenen eingesperrt war. Doch statt einfach den Mund zu halten und zu laufen, machte Arnie das, was bei mir unter Garantie ankam: Er erzählte noch eine Geschichte von einem seiner fünfzehn Boston-Marathon-Rennen. Es war seine Art, mir zu verstehen zu geben, dass es kein guter Abend für einen Lauf war, dass er wusste, wie müde ich war, aber schau, jetzt sind wir hier, also lass uns das Beste daraus machen.
Als wir uns der Ecke am oberen Ende der Peck Hill Road näherten, blies uns der Sturm ins Gesicht. Der Schnee lag jetzt an die fünfzehn Zentimeter hoch und war nass. Nicht pulvrig-griffig, wie Schnee für einen guten Lauf sein kann. Noch schlimmer war, dass die Straße wieder schmal war, ohne einen richtigen Randstreifen, und wenn Autos kamen, mussten wir zur Seite springen und rutschten in den Straßengraben. Die Flocken waren so dick und nass, dass sie an Nase und Wimpern kleben blieben. Es war fast dunkel, und die Welt sah aus wie in Gaze verpackt. Scheinwerfer, die näher kamen, wirkten wie diffuse Streifen. Wir rannten wieder hintereinander, kullerten übereinander, wenn es bergab ging, und traten uns bergauf in die Hacken. Wenn Autos kamen, war Arnie so intensiv in seine Geschichte von Boston vertieft, dass er nicht zur Seite sprang. Im Gegensatz zu mir. Als ob ich plötzlich zum Leben erwacht wäre und doch noch nicht sterben wollte. Dann musste ich ihm schlitternd hinterherrennen; meine neuen Schuhe waren noch nicht eingetroffen, und meine schwarzen Stofftennisschuhe waren wie Wasserflugzeuge. Die Autofahrer, die uns begegneten, fuhren hektisch. Nun ja, ich mache euch Schwächlingen keinen Vorwurf, dachte ich im Stillen. Jeder, der an diesem Abend unterwegs ist, aus welchem Grund auch immer, ist dumm, aber bei diesem Wetter zu laufen, das ist unfassbar dumm. Und neben mir lief Arnie und plapperte vergnügt vor sich hin, als gäbe es keine Krise. Schließlich schrie ich ihn an: »O Arnie, wir wollen jetzt nicht mehr von diesem Marathon reden, lass uns das verdammte Ding laufen!«
Er war so überrascht, dass er sich zu mir umdrehte und allen Ernstes sagte: »Oh, eine Frau kann den Boston Marathon nicht laufen.«
»Und warum nicht?«, fragte ich.
»Ein Marathon ist sechsundzwanzig Meilen und dreihundertfünfundachtzig–«
»Ich WEISS, wie lang ein Marathon ist, Arnie. Warum soll eine Frau ihn nicht laufen können?«
»Auf Frauen trifft das Gesetz vom abnehmenden Ertrag zu.«
»Und was bedeutet DAS genau?« Arnie konnte mich wirklich auf die Palme bringen. Er benutzte häufig Begriffe wie Die Theorie der Osmose oder Die Lehre der Thermodynamik, um mir etwas zu erklären, was ich meistens ziemlich witzig fand, da das eine nichts mit dem anderen zu tun hatte, aber an diesem Abend war ich nun mal schlecht gelaunt.
»Weil ein Marathon immer schwerer wird, je länger er dauert.« Jetzt behandelte er mich wie eine Dumpfbacke.
»Und?«
»Frauen schaffen diese Entfernung nicht, sie können nicht so weit laufen«, sagte er. Er meinte das weder entschuldigend noch herablassend noch einschüchternd. Es war einfach eine Tatsache.
»Aber ich laufe jeden Abend sechs Meilen mit dir! Du erzählst mir ständig, wie gut ich deiner Meinung nach bin, was für Fähigkeiten ich habe! Und jetzt willst du mir weismachen, dass ich physisch nicht in der Lage bin, einen Marathon zu laufen?«
»Ja, das will ich, denn zwischen zehn Meilen und sechsundzwanzig Meilen liegt ein großer Unterschied.«
»Tja, Arnie, da liegst du falsch. Im vergangenen April ist eine Frau in Boston die Strecke gelaufen, sie heißt Roberta Bingay, und sie war sehr gut. Sie lief etwa drei Stunden und zwanzig Minuten«, sagte ich schroff. Ich hatte meine Trumpfkarte ausgespielt, war aber auf seine Reaktion nicht vorbereitet. Arnie explodierte, und das jagte mir ein wenig Angst ein, denn ich hatte ihn noch nie wütend erlebt. Er blieb stehen (was er sonst nie machte) und brüllte: »Keine Dame ist je den Boston Marathon gelaufen! Dieses Mädchen ist erst in Wellesley eingestiegen.«
»Sie ist ihn doch gelaufen. Das weiß ich, weil ich es in Sports Illustrated gelesen habe.« Ich betonte den Namen der Zeitung, denn was in Sports Illustrated stand, war für mich so, als stünde es in der Encyclopaedia Britannica.
»Ich sage es noch mal, keine Frau ist je einen Marathon gelaufen.« Schweigen. Wir schneiten immer mehr ein, und ein paar Autofahrer, die uns zu spät sahen, rutschten fast in uns hinein. »Okay, weiter«, sagte er mürrisch.
»Ich laufe erst wieder mit dir, wenn du glaubst, dass eine Frau Marathon laufen kann«, sagte ich ruhig.
»Los, lass uns weiterlaufen.«
»Nein, Arnie. Du musst doch zugeben, dass Frauen körperlich dazu in der Lage sind. Vielleicht traust du es Bingay nicht zu, schön und gut. Aber IRGENDEINER Frau. Ich kann mit dir nicht mehr laufen, wenn du nicht davon überzeugt bist, dass eine Frau es schaffen kann. Das ist wichtig.«
Arnies Antwort kam schnell und unmissverständlich. Ich war überrascht. Später kam mir der Gedanke, dass er darüber schon viel nachgedacht haben musste, vielleicht schon seit Monaten.
»Wenn eine Frau den Marathon laufen kann, dann bist du es, denke ich. Aber selbst du müsstest es mir beweisen. Wenn du mir im Training zeigst, dass du die Distanz schaffst, also ich wäre der Erste, der mit dir zum Boston Marathon fährt!«
»Okay«, sagte ich und grinste. »Du bist wieder dabei!« Und wir machten uns auf den Heimweg. Müdigkeit und schlechte Laune waren verflogen. Auf dem Rückweg machte Arnie nur noch Pläne, er skizzierte grob, wie wir trainieren würden, dass wir nur drei Monate Zeit hätten, es aber vielleicht schaffen könnten. Ich grinste nur. »Heilige Sch...«, dachte ich. »Ich habe einen Trainer, einen Partner, einen Plan und ein Ziel – das größte Rennen der Welt. Boston! Boston!«