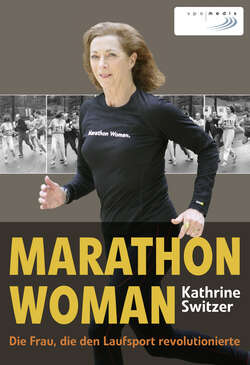Читать книгу Marathon Woman - Kathrine Switzer - Страница 9
Kapitel 3 »Könnt ihr eine Meile laufen?«
ОглавлениеIch traf mit einem leichten Groll, aber auch überglücklich, von zu Hause fortzukommen, im Lynchburg College ein. Überrascht entdeckte ich, dass es dort sehr schön war, freundlich, und – ich gebe es ungern zu – es gefiel mir dort fast auf Anhieb. Ich hatte befürchtet, der ganze Campus wäre von unerträglicher Religiosität geprägt, aber es stellte sich heraus, dass nur die Theologiestudenten die Religion forcierten. Der Rest der Schule war erstaunlich ausgewogen, wenn man bedenkt, dass sie mitten in den fundamentalistischen Süden eingebettet war.
Ein paar der »heiligen« Studenten, die Priester werden wollten, waren aber kleine Teufel! Sie luden Mädchen ins Kino ein und bogen dann stattdessen in eine kleine Landstraße ein und versuchten, dort den Abend zu verbringen. Als mir das zum ersten Mal passierte, blieb ich vor dem Auto auf der Straße stehen und weigerte mich, wieder einzusteigen, bis der Student mir versprach, mich ohne Umweg direkt in mein Studentenwohnheim zurückzubringen. Nach diesem Erlebnis war ich sprachlos, als er mich fragte, ob er mich am nächsten Tag zur Kirche begleiten dürfe, so als sei er die Unschuld in Person!
Die akademische Atmosphäre in Lynchburg gefiel mir. Sie war anspruchsvoll, aber nicht einschüchternd, und die Seminare waren klein genug, um sich als Individuum fühlen zu können. Da ich überzeugt war, Journalistin werden zu wollen – obwohl mein militärischer Vater Journalisten verabscheute, sie »schwatzende linke Typen« nannte, »die nie dem Feind gegenübergestanden hätten« – , studierte ich zum ersten Mal mit Leib und Seele.
Begeistert ging ich zur ersten Sitzung meines Englischseminars am College. Ein Tag, den ich nie vergessen werde. Der Professor hieß Charles Barrett, ein leicht skurriler und bezaubernder Mensch. Er trug uns auf, einen Essay über eine Kurzgeschichte von Orwell zu schreiben. Dann schmunzelte er und referierte über die Schwierigkeit, einem Essay einen guten Titel zu geben. Ein fabelhafter Titel beinhalte entweder »Schlangen« oder »Sex«. Diese beiden Begriffe würden Leser sofort gefangen nehmen. Noch nie hatte ich im Unterricht von einem Lehrer das Wort »Sex« gehört, und ich fand es herrlich verrucht. Ich arbeitete lange an meinem Essay, unterzeichnete ihn mit K. V. Switzer, und in einem mutigen Moment setzte ich den Titel »SEX« darüber. In der nächsten Woche sagte Dr. Barrett, er wolle einen Essay laut vorlesen, und begann mit »Sex«. Ein kollektives Schnappen nach Luft folgte, und ich duckte mich auf meinem Platz. Dann las er die ganze Arbeit vor, erklärte, warum sie gut sei und er die beste Note gegeben habe. Ich war völlig fertig. Als wir den Seminarraum verließen, sagte ein Mitschüler: »Kannst du dir vorstellen, dass jemand diesen Titel gewählt hat?!« Und ich sagte nur: »Ja. Nein.« Ich belegte schließlich alle Englischkurse von Charles Barrett, ebenso Kurse für Kreatives Schreiben und Journalismus, und bald schrieb ich für die Collegezeitung Critograph.
Das einzig wirklich Enttäuschende am LC war das Niveau der Frauenhockeymannschaft – und dann noch der Südstaatenakzent und die Hüfthalter. Wenn man sich einen Dialekt angewöhnt hat, ist es schwer, ihn wieder loszuwerden, und ich fand, dass Frauen mit diesem langsamen Südstaatenakzent weniger ernst genommen wurden als Frauen ohne Akzent. Vor lauter Angst, mir diese sirupsüße Sprache anzugewöhnen, bemühte ich mich um eine hochgestochene Ausdrucksweise. Ich muss wie eine arrogante Ziege geklungen haben, aber ich glaube wirklich, dass mir das später bei meiner Radio- und Fernseharbeit geholfen hat.
Die Hüfthalter – anscheinend trugen alle Mädchen diese grässlichen Gummidinger, die sie von der Taille bis zu den Oberschenkeln versiegelten – waren vordergründig dazu da, die Strümpfe oben zu halten und die Hüften schlanker wirken zu lassen, aber auch schmale Mädchen trugen sie. Warum irgendjemand überhaupt ein Kleidungsstück trug, das den Muskeltonus beeinträchtigte und Pinkeln zu einer zehnminütigen Tortur machte, war mir unbegreiflich, bis ich »den Code« begriff. Irgendwann fiel mir auf, dass meine simplen Baumwollstrumpfhalter gerümpfte Nasen und Kopfschütteln bei meinen Mitbewohnerinnen hervorriefen. Denn der dreifach gewirkte Hüfthalter signalisierte, dass man nicht »leicht zu haben« war. Wie sich später zeigen sollte, waren am Ende des ersten Semesters etliche dieser Latexjungfern schwanger, und ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie sie es geschafft haben, diese Dinger auf dem Rücksitz eines Autos auszuziehen und vor der mitternächtlichen Ausgangssperre wieder anzubekommen.
Ich hatte gehofft, auf stärkere Feldhockeyspielerinnen zu treffen, um meine Technik zu verbessern. Aber wie sich herausstellte, war ich eine der besseren Spielerinnen. Es schmeichelte meinem Ego nicht, es war frustrierend. Als einige Spielerinnen nach einem Sprint außer Atem eine Pause machen mussten, war mir klar, dass wir nie ein erfolgreiches Team sein würden. Und als einige Abwehrspielerinnen darauf bestanden, ihren Longline-BH samt Hüfthalter zu tragen, wusste ich, dass es keine Hoffnung gab.
Das Spielfeld war ein Witz. Es war mit Steinen und Unkrauthügeln und kahlen Stellen übersät, der Ball rollte überall hin, nur nicht in die Richtung, in die er sollte. Ab und an errangen wir dennoch einen Heimsieg, weil niemand sonst auf diesem Feld spielen konnte. Die Mannschaften, die uns besuchten, besonders die aus den schicken Schulen, wie zum Beispiel Hollins, waren daran gewöhnt, auf traumhaften Anlagen zu spielen, die wie Golfplätze waren. Unser Platz brachte sie völlig durcheinander.
Eines Tages besuchte uns die legendäre Engländerin Constance Appleby, die Feldhockey im Jahr 1901 nach Amerika gebracht hatte, und hielt mit uns eine Trainingseinheit in Theorie und Praxis ab. Ich betete sie an und schätzte sie auf ungefähr achtzig Jahre. Man kann sich mein Erstaunen vorstellen, als ich herausfand, dass sie dreiundneunzig war. Sie wirkte nicht im Mindesten gebrechlich, war ziemlich kräftig um die Mitte herum und hatte sich mit einer schokoladenbraunen Tunika und farblich passender Schärpe und Schienbeinschützern angetan.
Nach einer kurzen Ansprache schockierte uns Miss Appleby, indem sie uns aufs Spielfeld jagte und mit uns spielte. Wir griffen gerade das Tor an, als Miss Appleby nicht weit von mir entfernt über einen großen Maulwurfshügel stolperte und lang hinschlug. Ich rannte zu ihr und schrie: »Oh, Miss Appleby, ist Ihnen etwas passiert? Oh, oh, oh!« O Gott, dachte ich, wir haben Miss Appleby umgebracht, aber als ich ihr aufhelfen wollte, sprang sie auf die Füße, wies mit ausgestrecktem Arm wie ein General auf das Spielfeld und rief mit ihrem unnachahmlichen britischen Akzent: »Weiterspielen!«
Von diesem Moment an wusste ich, dass ich Sport machen würde, um mein Leben lang in Form zu bleiben. Miss Appleby war eine fitte, lebhafte alte Schachtel, und so wollte ich im Alter auch sein. Das Problem war nur, dass Frauen keinen Mannschaftssport außerhalb der Universität treiben konnten, es sei denn, man wurde Trainerin und konnte auf diese Weise dabei sein. Ich wollte nicht Trainerin werden, und ich wollte nicht nur dabei sein. Ich wollte eine Sportlerin sein, aber auch mehr als das. Ich wollte einen Beruf haben, einen journalistischen Beruf. Ich wollte sein wie die griechischen Athleten, die auch Philosophen waren: Ich wollte herausgefordert werden und an der Herausforderung wachsen.
Ich hatte dies oft mit mir selbst diskutiert, meistens beim Laufen, was ich weiterhin fast täglich nach dem Hockeytraining machte. Laufen war unglaublich befriedigend, selbst wenn es nur um den Sportplatz herum ging oder hin und wieder in einer großen Schleife um den Campus. Die Strecken hielten sich in Grenzen, sie gaben mir das Gefühl, etwas zu schaffen, und es war eine angenehme Art, die Frustrationen des Trainings mit der Mannschaft abzubauen, bei dem ich kaum außer Atem geriet. Ich fürchtete, mit der Mannschaft meine Form zu verlieren – was für eine Ironie! –, und ich wusste, dass Laufen mich stark und selbstsicher machte, bis ich die Lösung gefunden hatte.
An einem herrlichen Nachmittag im Herbst spielten wir beim nahen Sweet Briar College. Noch nie hatte ich ein so gepflegtes Spielfeld gesehen, und entsprechend schnell war auch das Spiel. Unsere Mädchen waren nicht in Form, und die Spielerinnen von Sweet Briar hatten uns in der Hand. Unsere Hüfthalter tragende Verteidigerin ließ die Gegnerin vorbei, und lachte dabei auch noch. Da spurtete ich los, um ihre Position einzunehmen, und versuchte, ein Tor zu verhindern. Verärgert, weil ich sowohl ihre Arbeit als auch meine verrichten musste, schrie ich sie an: »Das ist nicht lustig. Renn ihr nach!« Und ich schwöre, sie blieb stehen, stemmte die Hände in die Hüften und sagte: »Das ist nur ein Spiel, Kathy.« (Spiel sprach sie wie »Spie-hiel« aus.)
Nach dem Spiel schien niemand in unserem Team etwas dabei zu finden, dass wir verloren hatten. Sie waren begeistert, mit den Sweet-Briar-Mädchen Tee zu trinken. Ich war so wütend, dass ich mich verkrümelte, die sanften Linien der Blue Ridge Mountains betrachtete und mich fragte, warum es für mich nicht nur ein »Spie-hiel« war, warum ich es wichtig fand. Die Trainerin kam zu mir und sagte: »Du verlierst nicht gern, stimmt’s?« Es war viel komplizierter als das, aber ich war nicht gewandt genug, um ihr zu erklären, wie mir zumute war. Ich konnte lediglich sagen: »Nein, ich verliere nicht gern«, aber ich fing immerhin an, mich zu fragen, ob ich das Zeug zur Mannschaftssportlerin hatte. Vielleicht brauchte ich einen individuellen Sport. Dann musste ich nur auf mich selbst wütend sein. In drei Jahren würde ich sowieso keinen Mannschaftssport mehr betreiben können, weil es damals keinen Mannschaftssport für Frauen gab.
Heute – vierzig Jahre später – träume ich manchmal, dass ich Feldhockey spiele. Dann habe ich die Schnelligkeit und die Ausdauer, die ich damals hatte, bin aber so erfahren und gewieft wie heute. Meine Mannschaftskolleginnen und ich arbeiten zusammen, wir bauen brillante Spiele und Spielzüge auf, die ich mir mit achtzehn nie hätte ausdenken können. Dann wache ich lachend auf und frage mich, wie anders mein Leben verlaufen wäre, wenn Feldhockey schon damals eine olympische Disziplin gewesen wäre.
Dave und ich hatten uns darauf geeinigt, im College auch mit anderen auszugehen, aber weiterhin fest zusammenzubleiben. Da er ein Erstsemester in der Marineakademie in Annapolis war, würden wir uns sowieso nur sechsmal im Jahr sehen können, warum sollten wir da nicht auch mit anderen ausgehen? Die wichtigsten Feierlichkeiten im College wurden June Week genannt, sie fanden am Ende des Ausbildungsjahres statt, und in der Akademie wurde jeden Abend getanzt. Meiner Mutter lag es besonders am Herzen, dass ich, ihre Tochter, daran teilnahm. Sie gab, was nicht oft vorkam, ihren weiblichen Fantasien Ausdruck, und ihre Geschenke zu Weihnachten in jenem Jahr bestanden aus Abendkleidern und allgemeinen Accessoires zur Gestaltung der June Week.
Das erste Weihnachten zu Hause in den Collegeferien war eine Entzauberung für mich, weil Dave sich so verändert hatte beziehungsweise weil die Marineakademie ihn verändert hatte. Er war nicht mehr der fröhliche Junge, den ich gekannt hatte, er kommandierte herum, sagte, ich müsse vom Lynchburg College zum Goucher College wechseln, um näher bei ihm und der Akademie zu sein, es sei egal, wo ich den Abschluss mache, ich würde sowieso nicht zu arbeiten brauchen. Darüber musste ich laut lachen, denn wir hatten unsere Berufswünsche in der Highschool besprochen.
»Wenn ich Marineoffizier bin, wird meine Frau nicht arbeiten«, eröffnete er mir.
»Aha«, sagte ich. »Und was soll ich in den sechs Monaten im Jahr machen, in denen du auf See bist?«
»Meine Mutter hat auch nicht gearbeitet, und sie war glücklich und zufrieden damit, für ein schönes Heim zu sorgen.«
»Nun, meine Mutter hat immer gearbeitet, und sie ist auch glücklich und zufrieden. Sie verdient ihr eigenes Geld, sie ist anerkannt in ihrem Beruf, und ich habe auch vor zu arbeiten, also mach dich darauf gefasst.«
Unsere strahlende Beziehung verdüsterte sich. Ich wollte immer noch zur June Week gehen – ich hatte schließlich diese schönen Abendkleider! –, aber ich war aus zwei weiteren Gründen von Dave immer weniger begeistert. Erstens lehnte er es plötzlich ab, dass ich lief, weil es mich in seinen Augen zur Außenseiterin machte. Das sagte er mir auf einer Party, und ich wurde so wütend, dass ich mich ohne ihn auf den sieben Meilen langen Heimweg machte. Es war spät, und ich wusste, dass es dumm von mir war. Als ein Freund im Auto vorbeikam und anbot, mich nach Hause zu fahren, willigte ich ein. Als ich eingestiegen war, merkte ich, dass ich mich geirrt hatte, der Mann war kein Freund, nicht mal ein Bekannter. Während der Fahrt dachte ich, o Gott, das ist sehr gefährlich! An einem Stoppschild sprang ich aus dem Wagen, rannte durch die Vorstadtgärten und versteckte mich unter einer Hecke. Dort lag ich eine Ewigkeit, und der Typ suchte nach mir. Als ich sein Auto wegfahren hörte und wusste, dass ich in Sicherheit war, ging ich zur Party zurück und bat einen Freund, mich nach Hause zu bringen. Dave kam später zu mir, wir stritten uns, weinten beide, und ich schrie ihn an, es sei verflucht gut, eine Läuferin zu sein, sonst hätte ich dem Verfolger nie entkommen können.
Der zweite Grund war, dass ich in Lynchburg seit dem Spätherbst mit einem Mitstudenten namens Robert Moss ausging, der anders war als alle Jungen, die ich bisher kennengelernt hatte. Seine Mutter war Engländerin, sein Vater Amerikaner. Er war groß und dünn, ruhig und zurückhaltend, hatte einen trockenen Humor, und er war im Besitz eines Regenschirms; all dies waren unamerikanische Züge, die mich faszinierten. Außerdem war er Mitglied der Crosslaufmannschaft, was für mich der Inbegriff der Romantik war. Er war der erste Mensch, dem ich die Geheimnisse meines Herzens offenbarte, auch meinen Wunsch, mich im Sport auszuzeichnen, was ein großes Wagnis war in dieser Ära der Geschlechterstereotypen. Robert hat meine Begeisterung nie abgewertet, nur weil ich ein Mädchen war, und ich hielt seinen erstaunlichen Sinn für Gleichwertigkeit unglücklicherweise für selbstverständlich.
Im Frühling waren wir dann ineinander verliebt und verbrachten viel freie Zeit, die wir in der Bücherei zum Lesen hätten nutzen sollen, unter einem Busch mit duftenden Blüten und tauschten bis zur Sperrstunde Zärtlichkeiten aus. Da ich die Freundin eines anderen war, schwebten wir in einem romantischen Nebel, wie es zu einer verbotenen Liebe gehört. Ich war verliebt, aber an Dave gebunden, oh, es war aussichtslos, bis Robert vorschlug, Dave sausen zu lassen. Was, und nicht zur June Week zu gehen? Unmöglich! Es war der falsche Vorschlag. Stur nahm ich an der June Week teil, und Robert, der mir vorwarf, ihm ein paar Ballkleider vorgezogen zu haben, weigerte sich ebenso stur, unsere Beziehung danach fortzusetzen. Wir blieben Freunde, aber ich habe Jahre gebraucht, wirklich über ihn hinwegzukommen.
Achtzehn Monate später, an einem regnerischen Nachmittag, waren die harten Grasflächen des Spielfelds, auf denen ich sonst lief, so matschig, dass ich beschloss, auf der Bahn des Sportplatzes zu laufen. Normalerweise lehnte ich Bahnläufe ab, weil ich es so langweilig fand, im Kreis herumzulaufen, aber auch deshalb, weil an einer Seite die Wohnheime der Jungen lagen. Als ich das letzte Mal dort gelaufen war, hingen ein paar blöde Kerle aus den Fenstern und sangen im Chor »Hüpf, hüpf, hüpf!« Aber an diesem Nachmittag regnete es so stark, dass ich trotzdem beschloss, dort zu laufen.
In der letzten Zeit hatte ich einige meiner Läufe mit einem schnellen Erstsemester namens Martha Newell absolviert. Marty und ich spielten Hockey zusammen, und dann liefen wir gemeinsam und beschlossen sogar, einer Organisation namens Amateur Athletic Union (AAU) beizutreten, die, wie man uns sagte, 880-Yards-Rennen (804,68 Meter) durchführte, die längste für Frauen erlaubte Distanz. Marty lief die respektable Zeit von 2:23 Minuten und war auch auf den kürzeren Strecken schnell. Meine Bestzeit auf 880 Yards waren 2:34 Minuten, und ich war frustriert, weil ich spürte, dass ich auf diesen kurzen Strecken kaum in Fahrt kam. Wir reisten zu ein paar Wettkämpfen nach Baltimore. Obwohl es sich, wie ich fand, kaum lohnte, irgendwohin zu fahren, nur um zwei Runden um einen Sportplatz zu laufen, war ich begeistert von dem Training mit Marty. Das Laufen machte mir so viel Spaß, dass ich mich darauf einstellte, Hockey und Basketball dafür aufzugeben. Laufen war etwas, was ich mit einer Freundin oder allein tun konnte, und zwar mein ganzes Leben lang. Dafür brauchte ich weder einen Trainer noch ein Team. Ich hatte eine Lösung für mein Dilemma gefunden.
Ich war mit meinen drei Meilen fast fertig, als ich bemerkte, dass der Bahntrainer der Männer, Aubrey Moon, nach draußen gekommen war und irgendwie einsam in seinem tropfenden Regenanzug am Rand der Bahn stand. Er hielt Stoppuhren in jeder Hand, deren Bändsel zwischen seinen Fingern baumelten. Aber es gab keine Läufer auf der Bahn, deren Zeit er nehmen könnte. Nach meiner letzten Runde rief er mich zu sich.
»Kannst du eine Meile laufen?« fragte er mich.
Leicht indigniert sagte ich: »Ich kann drei Meilen laufen.«
»Das ist gut. Denn ich habe in dieser Saison nur sechzehn Jungen auf der Bahn, und zwei davon sind 2-Meilen-Läufer, Mike Lannon und Jim Tiffany. Wenn du für uns eine Meile läufst, können wir noch mehr Punkte bekommen. Du musst nur ankommen. Mehr nicht.«
Er hätte auch seinen Cockerspaniel gebeten, wenn er ihn dazu hätte bringen können, vier Runden lang auf der Innenseite der Bahn zu laufen, nur um seine Punkte zu kriegen, aber es freute mich trotzdem, dass ich ihm und dem Team aus der Patsche helfen sollte. Es war keine große Sache. In Lynchburg wurde dem Bahnlauf sowieso keine große Aufmerksamkeit geschenkt.
»Sicher, Trainer, stellen Sie mich auf«, sagte ich lachend. Diesen klassischen Kinospruch wollte ich schon immer mal sagen können.
Lynchburg College war Mitglied in zwei Athletic Conferences (Sportligen). Die eine, Mason-Dixon Conference, verbot die Teilnahme von Frauen in männlichen Teams, die andere, die Dixie Conference, ließ sie zu. Die kommenden drei Wettkämpfe waren mit drei Colleges angesetzt, die Mitglieder der Dixie Conference waren. An diesen Rennen konnte ich also teilnehmen.
Am selben Abend noch rief ich meinen Freund Mike Lannon an und bat ihn um Rat. Denn noch nie war ich eine Meile unter Wettkampfbedingungen gelaufen. Ich glaube, Mike war der einzige Student, der als Läufer in Lynchburg so etwas wie ein Stipendium hatte. Er war ein sehr guter Läufer und wohnte im oberen Stockwerk der alten Turnhalle, was wahrscheinlich eine Art Gegenleistung in Form von Unterkunft war. Mike holte sich ein Stück Papier und sagte, seiner Meinung nach könne ich die Meile in sechs Minuten laufen, was bedeutete, eine Runde in neunzig Sekunden zu schaffen. Wichtig wäre, die erste Runde nicht schneller als neunzig Sekunden zu laufen, sonst würde mir die Luft ausgehen. Mike war sehr lebhaft, er machte mir Mut, ohne mich zu bevormunden. Wie sich beim Training in den kommenden Tagen zeigte, blinzelte mir kein Junge zu oder grinste vieldeutig. Das waren offensichtlich nicht die Kerle, die mir aus den Wohnheimfenstern hinterhergebrüllt hatten. Ich fühlte mich wohl.
Ein paar Tage später forderte Coach Moon auch Marty auf, am Wettkampf teilzunehmen. Sie sollte die 880 Yards laufen. Gott sei Dank musste ich das nicht! Da es keine Wettkampfhemden für uns gab, gingen wir in ein Sportgeschäft und kauften uns rot-weiße Oberteile, die einigermaßen zum Rot der Lynchburg College Hornets passten.
Es ist mir peinlich, das zuzugeben, aber in der Zeit war ich auch Teilnehmerin des Schönheitswettbewerbs Miss Lynchburg. Ich fand, dass alle Schönheitswettbewerbe nur dumm waren und sagte das auch eines Abends während des Essens zu meinen Freundinnen. Unter ihnen war auch meine Mitbewohnerin, Hockeymitspielerin und beste Freundin Ronette Taylor, die meine radikalen Ansichten über Frauenrechte teilte. Meine Freundinnen buhten mich aus, die Schönheitswettbewerbe hätten sich geändert, sie würden heutzutage Interviews beinhalten und die Beurteilung von Talent, außerdem könnte man Stipendien gewinnen, Reisen, schöne Kleider und ein paar Wochen lang ein nagelneues Auto fahren. Als wir wieder in unserem Zimmer waren, meinte Ronnie, ich wäre verrückt, mich nicht zu bewerben, ich hätte ebenso gute Chancen wie die anderen. Ich schätzte Ronnies Urteilsvermögen, und schließlich hatte ich diese Abendkleider! Also nahm ich am Wettbewerb teil.
Schönheitswettbewerb und Laufwettbewerb sollten am selben Tag stattfinden. Nach dem Lauf am Nachmittag würde ich duschen, mich umziehen und bereit sein für den Schönheitswettbewerb. Das hatte ich schon unzählige Male in der Highschool im College gemacht: Ich hatte Hockey gespielt oder Basketball, mich dann umgezogen und war dann »glamourös« zum Tanzen gegangen. Für mich war das nicht weiter ungewöhnlich. Die Medien, meine Mitschülerinnen und die Öffentlichkeit sahen das anders.
Es fing ganz harmlos an, als ein freundlicher Typ vom Pressebüro des Colleges beim Lauftraining erschien und ein paar Fotos von mir machte. Er schickte sie an die Lokalzeitungen von Lynchburg, die die Termine für die bevorstehenden Ereignisse veröffentlichen sollten. Plötzlich wurde daraus ein großes lokales Ereignis. Ein Mädchen würde im Team der Jungen mitlaufen, und zwar eine ganze Meile! Als ob das Laufen einer Meile gleichbedeutend wäre mit der Besteigung des Mount Everest. Sogar mein Wunsch, Mädchen sollte der 3-Meilen-Lauf erlaubt sein, wurde in einer Zeitung zitiert. Die Drähte im Campus glühten. Manche fanden den Vorschlag gut und bewunderten meinen Mut, andere flüsterten düster, dass das Laufen einer Meile gefährlich sei und mich in einen Mann verwandeln könne (schlimmer noch, in eine Lesbierin!). Die Typen, die mir so anzüglich hinterhergeschrien hatten, lästerten, ich würde mit den Läufern schlafen, warum sonst wäre ich in Shorts mit ihnen auf der Bahn? Ich war am meisten unter Beschuss, weil die Geschichte über mein Laufen zuerst kam, aber Marty bekam auch ihren Teil ab. Meine engsten Freundinnen aus meinem Jahrgang und auch noch fünf Mädchen aus meinem Wohnheim, außerdem Mr. Barrett, Wilma Washburn, eine Lehrerin, sowie Robert traten lautstark für mich ein, und so konzentrierte ich mich auf sie und blendete den Rest aus.
Als die Zeitungen von den Veranstaltern des Schönheitswettbewerbs erfuhren, dass ich unter den Finalistinnen war, ging die Meldung an die Tageszeitung Richmond Dispatch und an die Nachrichtenagenturen. Am nächsten Tag stand sie in allen Zeitungen. Mein Dad las morgens beim Frühstück die Washington Post, aus der ihn mein Foto ansprang. Ich hatte meine Eltern nicht angerufen, um sie nicht damit zu belästigen.
Der erste Lauf war am Donnerstag, der zweite am darauffolgenden Sonnabend, und als Marty und ich am Start standen, waren wir doch sehr unvorbereitet auf die Menschenmassen. Anscheinend waren alle Studenten gekommen, mehr als zum Fußball! Die armseligen Tribünen waren rappelvoll, und die Zuschauer standen reihenweise an der Mauer auf dem Hügel. An der Start- und Ziellinie sowie an den Kurven der Bahn standen viele Kameras auf Stativen. Irgendwo waren auch meine Eltern, die beschlossen hatten, lieber gleich selbst mit dem Auto aus Washington zu kommen, um mit eigenen Augen zu sehen, was da los war.
Ich hatte dem Trainer eine Zusage gegeben, und jetzt hatten wir hier die Reporter von sonstwoher, sogar von der New York Times und der Herald Tribune, dazu von etlichen Fernsehsendern. Und ich war noch nie zuvor eine Meile auf Zeit gelaufen! Tatsächlich wurde von mir auch nur erwartet, irgendwie anzukommen, und hier waren nun diese Menschenmengen und erwarteten – was? Dass ich gewann? Dass ich zusammenbrach?
Mike Lannon hatte frappierend genau gerechnet. Ich lief so schnell, wie er gesagt hatte, und war nach fünf Minuten und achtundfünfzig Sekunden im Ziel. Ich war wie erwartet die Letzte, aber ich holte die Punkte. Dann lief Marty die 880 Yards, und besiegte einen Jungen vom Frederick College im Zielsprint! Das war fantastisch, denn die Menge sah plötzlich, dass wir Mädchen nicht nur einfach ein bisschen Joggen konnten – Mädchen konnten laufen! Wir waren begeistert, dem Team geholfen zu haben, und wussten nicht, dass wir Geschichte schrieben. Die Zeitung Lynchburg News berichtete, unser College in Virginia sei mit zwei Läuferinnen im Männerlaufteam »eine der wenigen Einrichtungen des Landes, wo Mädchen und Jungen unter denselben Voraussetzungen an Wettkämpfen teilnehmen«. Es war aber nicht das erste Mal, dass ein Mädchen, den Regeln der Dixie Conference entsprechend, an einem Wettkampf teilnahm. 1964 hatte das Charleston College bereits eine Sprinterin in einem kleinen Team aufgestellt.
23. April 1966: Keiner von uns im College in Lynchburg war auf das Interesse der Medien vorbereitet, als durchsickerte, dass Mädchen in einer Jungenmannschaft antreten würden. Berichterstatter des NBC-Fernsehens und der MGM-Wochenschau standen am Ziel.
Beim Schönheitswettbewerb am Sonnabend nach dem Lauf musste ich meine geschwollenen Füße in hochhackige Schuhe zwängen und stundenlang darin herumstehen. Das war der Todesstoß für meine Zehennägel, die ich schon in zu kleine Spikes gezwängt hatte, die ich bei den Läufen trug. Später wurden die Nägel schwarz und fielen ab. Ich dachte, ich hätte so etwas Ähnliches wie Wundbrand. Das war der Beginn ständiger Fußprobleme in den nächsten zehn Jahren.
Als »Talent« für den Schönheitswettbewerb hatte ich das Akkordeonspiel gewählt. In den Zeitungen hieß es: »Nachdem Kathy Switzer ihre Füße auf der Bahn malträtiert hatte, malträtierte sie das Akkordeon beim Schönheitswettbewerb.« Ich spielte pflichtschuldig »Lady of Spain« oder eine ähnliche für das Akkordeon geeignete Melodie, was, wie man sich vorstellen kann, niemanden interessierte, zumal ich mit schmerzverzerrtem Gesichtsausdruck musizierte. Ich gewann den Titel »Miss Lynchburg« nicht und habe nie wieder Akkordeon gespielt.
Der Trubel ging weiter – von überallher kamen Briefe. Fanpost von meinen früheren Schulkameraden, von Verwandten, Marines von Quantico wollten sich mit mir verabreden, GIs aus Vietnam wollten mir schreiben, und ein Fleischer aus Alabama machte mir unumwunden einen Heiratsantrag. Ich verteilte die Briefe päckchenweise an meine Mitbewohnerinnen, und wir ergötzten uns daran. Außerdem gab es noch die Hasspost, meistens von Menschen, die vorgaben, gläubig zu sein, und die mich darüber informierten, dass ich in der Hölle schmoren würde. Diese Briefe warf ich weg. Das Ganze war eine Lektion in Sachen Polarisierung und unterschiedlicher Wahrnehmung, ob es nun um die unterschiedlichen Meinungen auf dem Campus ging oder um die in den Briefen. Neutral schien niemand zu sein.
Es war auch eine interessante Lektion in Journalismus und bestärkte mich in dem Wunsch, Reporterin zu werden. Ich war jetzt die Sportreporterin des Critograph und musste unter anderem einen Artikel über Martys und meine Teilnahme an den Wettkämpfen schreiben. Das war, soweit mir bekannt ist, der einzige objektive Bericht über unsere Leistung. Gleichzeitig musste ich über andere Ereignisse schreiben, nicht zuletzt über Robert und seinen Freund Jim Tiffany, die am Boston Marathon teilgenommen hatten. Niemand hatte bemerkt, dass sie dafür trainierten, selbst ich nicht. Als sie zurückkamen, interviewte ich Robert und erfuhr, dass ein Marathon 26 Meilen und 385 Yards (42,195 Kilometer) lang ist und dass Jim nach 3:45 Stunden ins Ziel gelaufen war. Nachdem ich mich immer beschwert hatte, dass alle meine Strecken zu kurz wären, gab es hier einen Lauf namens Marathon, meiner Meinung nach das interessanteste Ereignis der ganzen Welt. Ich war fasziniert und hatte den Wunsch, es selbst zu versuchen. Ich fragte, ob auch Frauen mitliefen, und Robert sagte: »Eine«, und dass sie um die 3:20 Stunden gerannt sei. Ich konnte es mir nicht verkneifen und sagte: »Du hast dich von einer Frau schlagen lassen?«
Außerdem bewarb ich mich als Transfer-Studentin an der Syracuse University, weil ich zusätzlich zum Hauptfach Englisch auch Kunst, Naturwissenschaften und Publizistik an der Newhouse School studieren wollte. Ich war gern in Lynchburg, wollte mich aber unbedingt spezialisieren und freute mich, als ich angenommen wurde. Im Frühling 1966, an meinem letzten Schultag am LC, wurden zum Semesterende Urkunden verteilt. Ich war in Gedanken bereits bei meinem Studium in Syracuse, sodass ich fast den Aufruf meines Namens überhört hätte. Trainer Moon zeichnete Marty und mich mit Ehrenurkunden des Bahnlauf-Teams der Männer aus. Wir hatten nur an drei Wettkämpfen teilgenommen und ich war nicht der Meinung, sie verdient zu haben, aber sie gehören zu den schönsten Urkunden, die ich je erhalten habe.