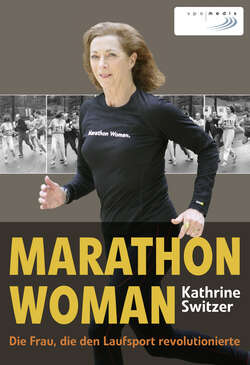Читать книгу Marathon Woman - Kathrine Switzer - Страница 7
Kapitel 1 Die lange Reihe der Pioniere
Оглавление»Hier ist Ihre Patientenakte. Stecken Sie die ein und geben Sie sie Ihrem Arzt, sobald Sie angekommen sind. Und diese Bescheinigung hier legen Sie bei der Einschiffungsbehörde vor. Alles Gute.«
Virginia, meine Mutter, nahm die Unterlagen an sich und bedankte sich bei dem Arzt.
Sie war fast im achten Monat mit mir schwanger und hatte es eilig, auf das erste Schiff zu kommen, das Familienangehörige der US-Armee in das vom Krieg zerstörte Europa brachte. Sie wollte zu meinem Vater, den sie seit sieben Monaten nicht mehr gesehen hatte. Es war im November des harten Winters 1946, für sie hieß es: jetzt oder nie. Denn die Überfahrt mit einem winzigen Säugling und meinem zweijährigen Bruder Warren würde viel schwieriger sein, als schwanger und mit einem Kleinkind zu reisen. Die Papiere, die der mitfühlende Arzt meiner Mutter für die Einschiffungsbehörde ausgestellt hatte, besagten, dass sie erst im sechsten Monat schwanger und somit reisefähig sei. Gerade noch.
Mitten auf dem Nordatlantik havarierte der umgebaute alte Steamer, dümpelte neun Tage lang vor sich hin und wartete darauf, in Schlepp genommen zu werden. Unentdeckte Treibminen, ihre anhaltende Seekrankheit oder die Vorstellung, dass ich auf hoher See geboren werden könnte, beunruhigten meine Mutter weniger als der Gedanke, nach New York zurückgeschleppt zu werden. Doch wir wurden nach Bremerhaven geschleppt, wo ein Zug bereitstand, um die Schiffsladung Frauen und Kinder weiter ins Landesinnere zu bringen.
Es ist großartig, zu dem einen Menschen zu fahren, den man liebt. Ich kann mir die Wiedersehensfreude meiner Eltern vorstellen, meinen hünenhaften Vater Homer, der meine kleine Mutter hochhebt und lacht, weil sie sich seit ihrer letzten Begegnung so verändert hat. Es ist gut, sich in der Liebe sicher zu sein, wenn man eine schwierige Situation zu bestehen hat. Meine Mutter war entsetzt über das, was sie in Deutschland sah. Die Städte lagen in Trümmern, überall türmten sich Schuttberge, Gruppen ausgebombter und vom Krieg vertriebener Menschen hausten auf der Straße; alle hatten Hunger, alle waren auf der Suche nach einem Schutz vor der grimmigen Winterkälte.
Damals war mein Vater Major in der amerikanischen Armee, und zu seinem Aufgabenbereich gehörte es, Lager für Displaced Persons (DP-Camps) zu errichten, für vom Krieg entwurzelte Menschen. Sie erhielten ein Dach über dem Kopf, bis sie ihre Familie wiedergefunden hätten, in ihre Heimat zurückkehren oder woanders ein neues Leben beginnen könnten. Familienleben war für meine Eltern sehr wichtig; sie hatten diese Familie und wollten anderen Menschen helfen, ebenfalls eine zu gründen. Und sie wollten ihren eigenen Kindern das Gefühl für die Bedeutung dieser Form des Zusammenlebens vermitteln. So fand meine Mutter unter den vielen verzweifelten Menschen in der Nähe unseres Hauses zuallererst eine Nanny für mich, die ich noch gar nicht geboren war, und stellte sie ein. Nanny Anni fragte, ob eine Freundin von ihr unsere Köchin werden könnte, und dann tauchte Annis Bruder auf und wurde unser Hausmeister. Bald darauf hatten wir eine Klavierlehrerin (im Haus stand ein prächtiger Flügel) und eine Schneiderin, die unsere Kleider nähte. Die meisten Angestellten wohnten bei uns. Meine Mutter war so etwas wie ein Eine-Frau-Marshallplan, sie teilte alles, was wir hatten, selbst Heizung und Strom, die höchst unzuverlässig funktionierten.
1948. Ich sitze auf dem Balkon unseres Hauses in Amberg. Meine Nanny Anni Simon passt auf mich auf. Sie war wie eine zweite Mutter für mich.
So war dann auch das Hospital der US-Armee am Tag meiner Geburt so schlecht beheizt, dass ich in einen Brutkasten gelegt wurde, sehr zum Vergnügen des Personals, denn ich wog gute acht Pfund und war 58 Zentimeter groß. Mein Vater füllte die Geburtsurkunde aus, und in seiner Aufregung buchstabierte er meinen Namen falsch, er vergaß das »e« in der Mitte, und so heiße ich Kathrine. Meine langen Beine freuten meinen Vater, der selbst 1,96 Meter groß war. Ihm gefiel die Vorstellung, dass ich eine große Frau werden würde, und er machte eine gewagte Bemerkung darüber, dass ich immerhin nach einer ausgelassenen »Der-Krieg-ist-aus-Party« beim Kentucky Derby gezeugt worden sei. Vielleicht würde ich mich zu einem Rennpferd entwickeln! Schon komisch.
Tatsache ist, dass ich, bis ich achtzehn Monate alt war, überhaupt nicht laufen konnte und meine Eltern deshalb ziemlich besorgt waren. Ich hatte nicht vor, laufen zu lernen. Warum auch? Hatte ich nicht meine Anni, die mich überallhin trug? Anni betete mich an; ich war das Kind, das sie, wie sie glaubte, nie bekommen würde. Schließlich gab es in Deutschland nur noch wenige junge Männer, und sie war schon achtundzwanzig. Sie war meine zweite Mutter und eine wunderbare Schwester für meine Mutter, die meinen Vater tatkräftig unterstützte.
Eines Tages sagte mein Vater zu Anni, dass im Nachbarort ein Tanzabend stattfände und dass sie hingehen sollte. Anni zierte sich; sie wüsste nicht, wie sie hinkommen könnte und hätte nichts anzuziehen. Meine Mutter lieh ihr ein Tanzkleid, und mein Vater fuhr sie in seinem Jeep hin. Im Tanzsaal sah ein junger Akkordeonspieler namens Heinz, wie Anni hereinkam, in dem hübschesten Kleid, das er je gesehen hatte. Sie lernten sich kennen und sahen sich von da an öfter.
Zum Glück, denn drei Jahre später, als es für uns Zeit wurde, Deutschland zu verlassen, konnten meine Eltern Anni nicht mitnehmen, da die Einwanderung in die USA nur Familienangehörigen gestattet wurde. Die Trennung war für uns alle sehr schmerzlich, besonders aber für mich. Laut jammernd und um mich schlagend versuchte ich, mich zu Anni zurückzukämpfen, bis mein Vater, dem auch die Tränen in den Augen standen, schließlich losfuhr und Anni auf der Straße zurücklassen musste. Neben ihr stand Heinz und stützte sie.
Anni und Heinz heirateten und ließen sich in der Sowjetischen Besatzungszone Deutschlands nieder, der späteren DDR. Aus Angst vor Repressionen stellten sie und meine Eltern ihren Briefwechsel ein. Fünfzig Jahre lang verging kein Feiertag, an dem wir uns nicht fragten, wie es Anni gehen mochte, und wir hoben unsere Gläser und tranken auf ihr Wohl. Die Trennung von Anni war meine erste einschneidende Verlusterfahrung, und trotz der Geborgenheit in meiner Familie blieb das Gefühl der Verletzlichkeit. Es gefiel mir nicht, alleingelassen zu werden. Doch zwei Jahre später, als mein Vater uns verließ, um in Korea zu kämpfen, begriff ich, dass Abschiede zu einem Dauerzustand werden könnten, an den ich mich gewöhnen musste. Wenige Amerikaner denken heute an den Koreakrieg, aber er war hässlich wie alle Kriege, und mein Vater war an der Front. Er war achtzehn Monate lang fort, und tagtäglich las meine Mutter am Frühstückstisch, bevor ich mich auf den Schulweg machte, aus der Washington Post die Namen der Gefallenen und Vermissten laut vor. Im Alter von fünf Jahren wusste ich nicht, dass die Familie im Todesfall eines Soldaten vom Militär benachrichtigt wird, und dachte, dass uns durch die Zeitung der Tod des Vaters mitgeteilt würde. Ich wusste nicht, wie es dann weitergehen sollte, aber ich wusste, dass ich an dem Tag sehr stark sein müsste.
Meine Mutter war einfühlsam, freundlich und feminin und hatte vor nichts Angst – weder vor Krieg noch vor Spinnen noch vor Gepolter in der Nacht. Ihre Gelassenheit und ihr Einfallsreichtum wirkten zwar nicht ansteckend auf mich, jedoch schämte ich mich immerhin, wenn ich Angst hatte. Als dann mein Vater aus Korea heimkam, entwickelte ich Selbstvertrauen, denn ich saugte die vielen Geschichten auf, die er mir und meinem Bruder über die Kraft und die Willensstärke unserer Vorfahren erzählte.
Immer und immer wieder hörte ich, wie unsere protestantischen Urahnen 1727 in die Neue Welt aufgebrochen waren, weil sie der religiösen Verfolgung, den lästigen Steuern, der Einberufung zum Wehrdienst entgehen und ein friedliches, gottesfürchtiges Leben als »Pennsylvania Dutch«-Farmer führen wollten. Die Geschichten reisten mit ihnen gen Westen, während sie sich mit einfachen Mitteln Farmen in den Nordwestlichen Territorien (heute Illinois) schufen, und zu diesen Geschichten gehörte auch die von W. H. (Washington Harrison) Switzer, der von zu Hause fortging (nicht rannte), um in die Armee der Konföderierten einzutreten. Nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg brach er mit seiner Frau und seinen drei Kindern auf, um sich mit dem als Soldat erworbenen Anrecht auf ein Stück Land in den 1870er-Jahren in South Dakota anzusiedeln. Der Traum von einer Farm, sogar einer Ranch, war die Gewissheit wert, ein Leben lang harte Knochenarbeit und großes persönliches Risiko auf sich zu nehmen. Ich lernte, dass es entscheidend sei, für die nächste Generation eine bessere Ausgangsposition zu schaffen.
Weder in unserer Familie noch in den Familien meiner Vorfahren hat es Abenteurertum gegeben. Ganz im Gegenteil. Wir gehen auf Nummer sicher – manchmal sogar zu sehr. Trotzdem überraschte W. H. der teuflische Winter in South Dakota, der schwarz war vor Schneestürmen und die Familie in der halb unter der Erde liegenden rußigen Hütte zu Eis erstarren ließ. Wie sie überlebten, die letzte Kuh schlachteten, das Fleisch einpökelten und verzehrten, Wurzeln aßen und Eis schmolzen, um Trinkwasser zu haben, wurde zum Stoff, aus dem Legenden sind. Nach zwei Jahren kehrten sie auf ihre Farm nach Illinois zurück, nicht als Verlierer, sondern als Sieger: Sie hatten es versucht. Irgendwann hatten W. H. und seine Frau elf Kinder, von denen zehn das Erwachsenenalter erreichten – eine unvorstellbare Leistung auch noch für heutige Verhältnisse, 130 Jahre später! W. H. starb mit achtundachtzig Jahren in seinem Bett. Deshalb habe ich als Kind nie die Frage gestellt, warum jemand einen sicheren Ort verlässt, um den Traum von einem besseren Leben zu verwirklichen, oder etwas als zu schwierig abtut und es gar nicht erst versucht. Entschlossenheit gehörte zum genetischen Code der Switzers.
Diese Geschichten schnappten meine Eltern, beide mittellose Farmer- beziehungsweise Kleinstadtkinder, in der Zeit der Großen Depression auf. Sie hatten es sich fest in den Kopf gesetzt, ein College zu besuchen, und es gelang ihnen, Stipendien zu ergattern und mehrere Jobs gleichzeitig anzunehmen: Als jeweils Erste ihrer Familien schafften sie den Collegeabschluss. Sie waren sieben Jahre lang miteinander verlobt, bis sie sich finanziell sicher genug fühlten, um zu heiraten, und dann ging meine Mutter allein zum Gesundheitsdienst der Universität und ließ sich ein Diaphragma anpassen, damit sie die Zahl ihrer Kinder planen konnten. Nichts wurde dem Zufall überlassen. Mein Bruder und ich wurden mit den gleichen Erwartungen erzogen, ohne einen Deut von Bevorzugung, was für die damalige Zeit erstaunlich war. Die Familie erwartete von uns beiden, dass wir aufs College gingen; mir wurde nicht erlaubt, weniger anzustreben, und gnade mir Gott, wenn ich diese Chance nicht nutzte! Ausdauer, Geduld und später die Belohnung gehörten ebenso wie Entschlossenheit zum Code.
Die Männer in meiner Familie waren alle groß gewachsen. Nein, hünenhaft! (Mein Vater war so riesengroß, dass ich ihn, als ich klein war, mit Gott verwechselte. Man hatte mir doch erzählt, Gott sei ein großer Mann im Himmel, der auf einen hinunterblicke.) Keiner maß weniger als 1,90 Meter, sie hatten einen beträchtlichen Leibesumfang und waren ungeheuer stark. Sie wären gute Sportler gewesen, aber mangels Zeit und Geld wäre diese Vorstellung nicht nur undenkbar, sondern auch extravagant gewesen. Sie waren stolz auf ihre Kraft und nutzten sie: Sie konnten wirklich alles. Die Frauen, für die sie sich entschieden hatten, waren ihnen ebenbürtig – feminin, aber fähig und resolut. Als ich in den Fünfzigerjahren und Anfang der Sechziger in einem Vorort von Chicago und in Washington D.C. aufwuchs, waren die Mütter meiner Freunde meistens zu Hause, spielten Bridge und empfingen ihre Männer an der Haustür mit einem Drink. Meine Mutter machte zwar auch oft Martinis für meinen Vater und begrüßte ihn an der Haustür. Aber sie war selbst gerade erst von einem arbeitsreichen Tag als Beraterin und Lehrerin nach Hause gekommen und hatte sich ein die Figur umschmeichelndes Kleid angezogen. Meine Mutter konnte alles, und mein Vater achtete sie. Ihr Gehalt war eine wichtige Einnahmequelle.
Als Kind kletterte ich an Seilen auf hohe Bäume, ich spielte mit den Nachbarjungen »Krieg« (und rannte schneller als die meisten von ihnen) und sprang von unserem Hausdach, um zu zeigen, dass ich auch ein Fallschirmspringer sein könnte. Ich wurde als erstes Mädchen gewählt, wenn die Jungen ihre Mannschaften zusammenstellten. Wenn mein großer Bruder in Sport besser war als ich (was er immer war), dachte ich nie, dass er als Junge besser ist, sondern als der Ältere. Gleichzeitig liebte ich Rüschenkleider, spielte zusammen mit meinen Freundinnen mit Puppen und war unsterblich in den Jungen im Nebenhaus verknallt, mit dem ich eng tanzte, wenn die Lehrerin in der Grundschule ein Kindertanzfest veranstaltete.
Ich war die Tochter meiner Eltern. Ich hatte keine anderen Vorbilder, nur sie und meinen Bruder. Und vielleicht war das mein Glück. Ich fand meine Welt aufregend, weil ich beides sein durfte, feminin und stark, zielstrebig und verträumt, besonnen und waghalsig, und dabei der Erwartung meiner Familie entsprechen konnte: Ich würde die Lage der nächsten Generation verbessern. Ich stammte von einer langen Reihe von Pionieren ab. Sie waren nicht berühmt, aber unermüdlich. Ich wollte sie nicht enttäuschen.