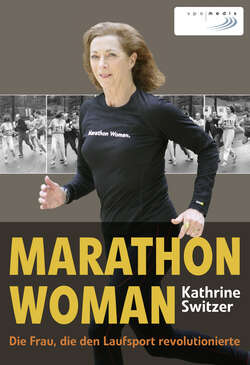Читать книгу Marathon Woman - Kathrine Switzer - Страница 13
Kapitel 6 »Du kannst den Boston Marathon laufen!«
ОглавлениеNach dem letzten 18-Meilen-Lauf sagte Arnie, dass wir am kommenden Wochenende die sechsundzwanzig Meilen knacken würden. Warum er beschloss, gleich auf die volle Distanz zu steigern, weiß ich nicht. Vielleicht, weil es dann genau einen Monat vor Boston war. Vielleicht hatte er auch einfach das Gefühl, dass ich so weit war, aber ich machte mir darüber keine Gedanken. Arnie hatte das Sagen. Aber ich war sehr aufgeregt. Das war mein großer Moment, genauer, mein großer Tag, weil wir uns ausgerechnet hatten, dass der Lauf fast den ganzen Tag dauern würde.
Wir starteten am Morgen, parkten das Auto auf dem Campus und planten, eine Schleife von sechzehn Meilen durch die Landschaft zu laufen und dann unsere übliche Zehnmeilenstrecke anzuhängen. So kämen wir näher an unseren Ausgangspunkt und gerieten nicht in die Gefahr, in irgendeiner entlegenen Gegend festzusitzen. Arnie hatte den Zwischenfall, als er ein Auto anhalten musste, um mich nach Hause zu bringen, nie auch nur angesprochen, aber er wollte keine Wiederholung riskieren. Wir wollten auch nicht in den Monsterbergen um Pompey laufen, was nur gut war, denn die Strecke reichte uns schon ohne Heldentaten. Wir wollten einen Kurs mit möglichst wenig Verkehr; er sollte abwechslungsreich sein, dabei aber nie direkt an unserem Auto oder der Sporthalle vorbeiführen. Es wäre mit Sicherheit eine zu große Versuchung, einfach aufzuhören, wenn man dort vorbeikäme, und sich nah an zu Hause zu zwingen weiterzulaufen, trotz aller Müdigkeit, führt dazu, dass man sich noch müder fühlt. Das ist ein Grund, warum ich nie eine gute Bahnläuferin war. Die Runden machen mich psychisch fertig.
Schön an unserer üblichen 10-Meilen-Runde waren immer die gepflegten Anwesen entlang der Strecke; ich stellte mir vor, eines Tages auch so ein schönes Haus mit Garten zu haben. Manchmal dachte ich mir sogar aus, wie ich es einrichten würde. Außerdem lebte Larry, das Lama, auf einem der teureren Grundstücke. Ein leicht exzentrischer Reicher besaß ein gepflegtes Anwesen mit vielen Bauernhoftieren, darunter ein mürrisches Lama, das Arnie Larry getauft hatte. Ich schätze, dass sich das alles nicht gerade unterhaltsam anhört, aber wenn man eine Route von 26 Meilen und 385 Yards zusammenstellt, ist man auf den letzten zehn Meilen für jede Ablenkung dankbar.
Als wir ungefähr sechs Meilen auf dem platten Land gelaufen waren, rannte uns ein schwarzer Mischlingshund, dem wir schon öfter begegnet waren, knurrend und bellend hinterher, und wie immer drehten wir uns nach ihm um und sahen ihn an, bis wir uns rückwärtslaufend aus seinem Herrschaftsbereich entfernt hatten. Aber statt wieder zurückzulaufen, wedelte der Hund mit dem Schwanz und folgte uns. Nachdem wir ein Dutzend Mal stehengeblieben waren und »Hau ab, geh nach Hause«, gerufen hatten, gaben wir auf, und Blackie wurde zu unserem Begleiter. Großer Fehler, Blackie, dachte ich. Mein Dad hatte mir mal erzählt, dass ein Mensch die meisten Tiere abhängen kann, sogar Rehe, und so glaubte ich, dass Blackie nach wenigen Meilen müde werden und nach Hause humpeln würde. Aber Blackie blieb mit heraushängender Zunge treu an unserer Seite, als gehörte er zu uns. Nach sechs Meilen blieb er langsam zurück, er humpelte, dann versuchte er, uns wieder einzuholen. »Ich weiß, wie dir zumute ist, du armer Kerl«, murmelte ich, und endlich, nach zehn Meilen legte Blackie sich einfach an den Straßenrand und sah uns hinterher. Das gefiel mir nicht, was, wenn er nun starb? Aber Arnie überzeugte mich, dass ich nicht traurig sein müsste, Hunde fänden immer nach Hause. So wie Lassie im Fernsehen und außerdem, was sollten wir denn machen? Ihn tragen?
Obwohl ich Lassie im Fernsehen noch nie gesehen hatte, war Blackie eine willkommene Ablenkung auf der 16-Meilen-Strecke, und jetzt begaben wir uns an die letzten zehn Meilen und hatten die Entfernung gar nicht gespürt. Wir kamen an den schönen Häusern vorüber, die ausladenden Bäume zeigten eine Andeutung von Grün, und Larry, das mürrische aprikosenfarbene Lama, kam zur Steinmauer, als wir vorbeiliefen und blickte uns mit seinem griesgrämigen Kamelgesicht an. Ha! Bis auf seine vier Beine sah es genauso versteinert aus wie die Menschen, an denen wir auf der Strecke vorbeigekommen waren.
Schneller als wir uns vorgestellt hatten, kamen wir wieder über den Hügel am Campus, von wo aus wir in einiger Entfernung Arnies blaues Auto auf dem Parkplatz sehen konnten, wir mussten nur noch eine halbe Meile weiterlaufen. Die 26 Meilen und 385 Yards schienen wie im Flug vorbeigegangen zu sein, und doch waren wir den ganzen Tag gelaufen. Ich war überhaupt nicht müde.
»Du wirst es schaffen«, sagte Arnie. »Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Du wirst es schaffen!«
Ich fühlte mich, als hätte man einen Stecker rausgezogen, ich war beinahe enttäuscht. Das sollte der Moment der Wahrheit sein, der Sieg, die Bestätigung? Ich hatte mir vorgestellt, dass die Ankunft auf dem Parkplatz an diesem grauen Nachmittag wie der Einlauf ins Olympiastadion sein würde. Stattdessen war es eine Ernüchterung.
»Du siehst gut aus, stark!« sagte Arnie.
»Hey, Arnie, es geht mir gut. Vielleicht waren es nicht sechsundzwanzig Meilen, vielleicht war der Kurs zu kurz?«
Arnie regte sich furchtbar auf, er explodierte fast. »Es waren sechsundzwanzig Meilen, vielleicht sogar mehr. Ich habe die Strecke mit dem Auto ausgemessen!« In den folgenden Jahren haben wir natürlich alle erkannt, dass das Ausmessen von Laufstrecken mit dem Auto immer ungenau ist. Viele Jahre lang sind Läufern ihre Rekorde und Zeiten wegen dieser nicht genau ausgemessenen Strecken aberkannt worden. Was den legendären Ultramarathonläufer Ted Corbitt und andere gewissenhafte Seelen dazu brachte, Methoden der genauen und zur Beurkundung geeigneten Streckenvermessung zu erfinden.
»Okay, gut, warum hängen wir nicht noch fünf Meilen ran, einfach um ganz sicher zu sein?«, fragte ich. »Wenn wir fünf Meilen länger laufen, dann weiß ich genau, dass uns in Boston nichts aufhalten kann.«
»Du könntest noch fünf Meilen länger laufen?«, fragte Arnie verwundert.
»Klar. Es geht mir großartig. Wie geht es dir?«
»Naja. Wenn du noch kannst, dann kann ich auch noch.« Er klang nicht so ganz überzeugt, aber er war gewillt, sich auf das Abenteuer einzulassen.
Wir liefen an dem geparkten Auto vorbei, sahen es lange an. Wir bogen an der Ecke ab, liefen weiter. Natürlich fühlten wir uns sofort danach bleischwer. Das passiert immer, wenn man am Ziel ist und noch weiterläuft. Es wurde jetzt spät, die Sonne war untergegangen, und alles wirkte verlassen. Und so verdammt grau. Würde es nie Frühling werden? Jetzt war ich es, die versuchte, munter zu sein und eine Unterhaltung in Gang zu bringen, denn Arnie wirkte niedergeschlagen. Schließlich war es meine Idee gewesen. Nach ungefähr drei Meilen wurde Arnie seltsam, er nörgelte herum, erzählte Unsinn, fluchte vor sich hin. Ich hatte Arnie noch nie fluchen hören! Er war so ein katholischer Miniheiliger, der einen Rosenkranz bei sich hatte, niemals trank, peinlich berührt war, wenn jemand einen schmutzigen Witz erzählte. Ich muss gestehen, ich hatte mich schon hin und wieder gefragt, wie seine Frau schwanger geworden war.
Meine Alarmglocken schrillten, als Arnie Richtung Straßenmitte abdriftete. Ich zog ihn an den Rand zurück. »Hey, alles in Ordnung?«, fragte ich ihn. Er sah mich überrascht an, als hätte ich ihn aufgeweckt.
Ein Auto kam uns entgegen, umfuhr uns in einem großen Bogen. Arnie rastete aus, nahm eine riesigen Stein vom Straßenrand und schleuderte ihn dem Auto hinterher. »Du mieses Schwein!«, brüllte er. »Verdammter Idiot. Du wolltest mich überfahren! Du Ochse. Ich bringe dich um!« Mit seinem dünnen grauen Haar, das ihm zu Berge stand, und den stechenden Augen sah er aus wie eine Vogelscheuche.
»Shit! Arnie, komm schon. Es ist alles in Ordnung.« Ich versuchte, ihn von der Straße zu ziehen, aber er schüttelte mich ab, in seinen Augen stand nackte Angst. »Sie – versuchen – uns – umzubringen!«, fauchte er, als verstünde er nicht, dass ich mir der Lebensgefahr, in der wir schwebten, nicht bewusst war.
»Komm schon, Arnie. Noch eine Meile, eine einzige, und wir haben es geschafft.« Ich hakte ihn ein, führte ihn. Er sah so grau aus wie sein Sweatshirt. Seine Augen waren ausdruckslos. Leer. Doch hoppelnd lief er mit mir weiter, mit Beinen, weich wie bei einer Gummipuppe, unsere Ellenbogen waren eingehakt. Dann sahen wir das Auto. Und wahrhaftig, ich konnte den tosenden Beifall der Menge im Olympiastadion hören. »Wir schaffen es, Arnie, wir schaffen es!«, gurrte ich ständig und mein Herz schlug höher. Dann waren wir bei seinem alten, verdreckten Wagen mit dem Plastik-Jesus auf dem Armaturenbrett, und ich schlang meine Arme um ihn und klopfte ihm auf den Rücken. »Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, Boston, wir kommen!« Arnie wurde in meinen Armen ohnmächtig.
Ich schwankte unter dem plötzlichen Gewicht, hielt ihn unter den Achseln fest und setzte ihn auf den Bordstein, wo sein Kopf auf die Knie sackte. Ich versuchte, einen kleinen Freudentanz hinzulegen, während ich sang: »Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft«, aber ich konnte meine Füße nicht mehr heben. Ich war wie eine Betrunkene, die ihre Bewegungen nicht mehr unter Kontrolle hat, aber nicht aufhören kann, zu lächeln. Nie zuvor habe ich eine so tiefe Freude empfunden. Mir schien, als läge auf der Motorhaube des alten Autos meine glänzende Goldmedaille. Arnie blickte hoch, schloss die Augen wieder und sagte: »Du kannst den Boston Marathon laufen.«
Jeder Student, der an der Comstock Avenue wohnte, kannte Arnie, schließlich war er unser Briefträger, und fast jeder hatte schon mal einen ganzen Packen Briefe für alle Hausbewohner entgegengenommen und bei der Gelegenheit ein paar freundliche Worte mit ihm gewechselt. Er liebte seine Arbeit, weil jeder sich freute, ihn zu sehen. Was die Post betraf, ging es auf dem College nicht anders zu als in der Army. Jeder wartet auf den Brief eines geliebten Menschen. Sie riefen: »Hey, Arnie, wie geht es dir?«, und Arnie reichte die Post durch die Tür, antwortete bereitwillig, redete, plauderte über die Wetteraussichten.
Am Montag nach unserem Lauf, den ich auf etwa einunddreißig Meilen schätzte, fragten mich einige Kommilitonen: »Hey, was ist denn mit Arnie los?«
»Keine Ahnung. Was soll mit ihm los sein?«, sagte ich.
»Naja, als er heute die Post brachte, sagte er völlig unvermittelt, Frauen hätten ein verborgenes Potenzial an Ausdauer und Durchhaltevermögen.«
Ich lachte nur. Und als ich zwischen zwei Vormittagsvorlesungen ins Wohnheim zurückkam, unterhielten sich einige Mitbewohnerinnen über ein Gespräch mit ihm. Eine sagte: »Mir hat er erzählt, sie habe ihn in Grund und Boden gerannt. Was meint er damit?«
Ich stellte mir Arnie vor, der wie Archimedes aus dem Bad sprang, die Eingangstüren jedes Hauses in der Comstock Avenue aufriss und schrie: »Heureka! Frauen haben ein verborgenes Potenzial an Ausdauer und Durchhaltevermögen!« Nur, dass ich diese Vorstellung nicht lustig fand, denn jetzt mussten wir darüber noch mehr Stillschweigen bewahren. Ich war überzeugt, dass der sicherste Weg zum Versagen der war, allen zu erzählen, dass wir es in Boston versuchen würden. Dann würde jeder von mir etwas erwarten und egal, wie es ausging, es würde nie gut genug sein. Diesen Druck wollte ich nicht, und Arnie wusste das, aber er konnte sich nicht zusammenreißen.
»Ich bin einfach so stolz auf dich. Ich muss den Leuten einfach erzählen, wie gut du bist«, sagte er.
»Okay. Aber das war es dann auch jetzt. Jetzt bloß kein Wort mehr von Boston.« Er willigte ein.
Danach machten wir weiter wie immer, und am Dienstag holte mich Arnie nicht vor dem Huey Cottage ab, sondern kam herein und setzte sich mit mir an einen Tisch in der Lobby. Wir konnten sowieso nicht laufen, weil wir immer noch so lädiert waren. Ich kam kaum die Treppen runter und hatte Blutblasen unter den Zehennägeln. Die Dinger waren prall, lila und schwarz, die Nägel hoben sich und schmerzten höllisch.
»Hier, du musst das Anmeldeformular für Boston ausfüllen«, sagte Arnie und schob mir ein Blatt zu, auf dem »American Marathon Race under the Auspices of the Boston Athletic Association« prangte. Arnie hatte mehr als ein Dutzend dieser Formulare, da er als langjähriger Präsident der Syracuse Harriers in Boston auf der Mailingliste stand und alljährlich einen Stapel von Anmeldeformularen für die Klubmitglieder erhielt.
»Ich kümmere mich um deine Reiseerlaubnis, aber du musst das Formular ausfüllen und dir von der Krankenstation ein ärztliches Gesundheitszeugnis ausstellen lassen. Und du musst drei Dollar beifügen. Keinen Scheck. In bar.«
»Himmel, Arnie, ich weiß nicht. Warum müssen wir uns anmelden? Warum können wir nicht einfach so mitlaufen?«
»Das geht nicht. Das ist ein renommiertes Rennen. Du kannst da nicht einfach hingehen und ohne Startnummer teilnehmen. Du bist ein eingeschriebenes Mitglied der AAU und du musst die Regeln respektieren.«
»Genau darum geht es mir, Arnie. Was, wenn ich in Boston nicht willkommen bin?«
»Natürlich bist du willkommen! Du hast die Langstrecke trainiert, was mehr ist, als viele dieser Schwachköpfe dort gemacht haben. Manche dieser reichen Bürschchen von Harvard glauben doch, sie können einfach mitmachen und die sechsundzwanzig Meilen laufen, so als Studentenstreich. Sie springen einfach ohne Startnummer rein und laufen mit der Spitze mit. Idioten! Boston ist nach Olympia der wichtigste Straßenlauf der Welt, du hast dafür trainiert, und jetzt musst du dich an die Regeln halten.«
»Diese Roberta hatte im letzten Jahr keine Startnummer.«
Arnie wurde sehr ernst. »Das hätte sie nicht tun sollen. Das ist ein wichtiges Rennen, für das man sich anmelden und dessen Regeln man befolgen muss. Leg dich nicht mit diesen Boston-Leuten an! Dem BAA! Die sind streng und auch noch etepetete. Und du kennst die AAU!« Schon die Erwähnung der AAU verursachte mir eine Gänsehaut; man konnte nie wissen, wer hier der Joe McCarthy war, der einen wegen irgendeiner Beleidigung oder Verletzung einer Regel, die man nicht mal kannte, auf die schwarze Liste setzte. Arnie und Tom hatten mir erzählt, dass große Sportler in Schwierigkeiten geraten waren, etwa der Langstreckenläufer Wes Santee, der ein Preisgeld verlangte, das die von der AAU akzeptierte Höchstgrenze überstieg. Man hatte ihm daraufhin den Amateurstatus entzogen, obgleich er ein amerikanischer Held war. Man musste also alles richtig angehen.
»Ja, aber was ist, wenn diese Regeln Frauen verbieten, an dem Lauf teilzunehmen? Ich möchte nichts falsch machen. Ich würde mich für Boston lieber nicht anmelden.«
»Ha! Ich wusste, dass du das sagen würdest, deshalb habe ich die AAU-Regeln mitgebracht. Hier.« Er reichte mir ein weiß-blaues Taschenbuch. Dann nahm er es wieder an sich. »Hier. ›Regeln für Cross- und Bahnlauf für Männer‹, und hier, ›Regeln für Cross- und Bahnlauf für Frauen‹, und hier, das dritte Kapitel heißt einfach ›Der Marathon‹. Da steht nichts über das Geschlecht. Außerdem, wenn du dir das Anmeldeformular ansiehst, da steht auch nicht, dass nur Männer laufen dürfen.«
Ich blätterte das Buch durch und sah mir die Wettbewerbe für Frauen an, ich kannte alle Disziplinen – die längste Strecke für Frauen ging über 880 Yards, der längste Crosslauf war eineinhalb Meilen lang. Die Männer hatten noch 3.000 Meter Hindernis und zwei Langstrecken. Ihr Crosslauf ging über siebeneinhalb Meilen. Natürlich würde die AAU Frauen niemals ermutigen, länger zu laufen, und ihnen längere Strecken anbieten.
O nein, ihnen könnte ja schließlich die Gebärmutter herausfallen!
Aber theoretisch hatte Arnie recht. In dem Kapitel über Marathon stand nichts über das Geschlecht der Teilnehmer. Und im Anmeldeformular auch nicht. Aber nur deshalb nicht, da war ich mir sicher, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass ein Mädchen würde laufen wollen – Frauen wären gar nicht daran interessiert, hätten Angst und glaubten das Märchen, der Langstreckenlauf würde sie unweiblich machen. Tatsächlich liefen nur Leute den Marathon, die ein bisschen verrückt waren, so wie Arnie. Nach meiner Erfahrung waren Läufer umso eigenartiger, je länger die Strecke war, auf die sie sich spezialisiert hatten. Nicht nur eigenartiger, sondern auf eine kauzige, aber niemals elitäre Weise auch interessanter. Kein richtiges Mädchen würde auch nur auf die Idee kommen, einen Marathon laufen zu wollen, was zusammen mit den alten Mythen bedeutete, dass die Verfasser des Regelwerks und des Anmeldeformulars sich die Teilnahme von Frauen einfach nicht vorstellen konnten. In einer Million Jahren nicht!
»Ich werde mich anmelden«, sagte ich seufzend und dachte an den Wirbel in Lynchburg, als ich mit einer offiziellen Startnummer für die Männer gelaufen war. Diese öffentliche Reaktion hatte mich überrascht, aber sie war auch schnell wieder verpufft. Außerdem hatte ich nicht daran gezweifelt, dass ich die eine Meile schaffen würde. Aber dies war ein Marathon, und auf sechsundzwanzig Meilen konnte viel passieren. Alles, was ich wollte, war, nicht aufzufallen und den Marathon zu laufen.
»Ja, man wird auf dich achten, aber du bist doch daran gewöhnt. Du bist immer das einzige Mädchen, egal, wo wir sind.« Arnie klang stolz, als er das sagte.
Ich ging nach oben und holte meine AAU-Mitgliedsnummer. Humpelte wieder nach unten und füllte das Anmeldeformular aus. Unter Name schrieb ich in Druckbuchstaben »K. V. Switzer«, und so unterschrieb ich auch. Es hatte mir immer gefallen, mit meinen Initialen zu unterzeichnen, ich kam mir dabei stark und schnell vor. »Drei Dollar, bitte.« Ich reichte ihm das Geld. »Okay, und jetzt geh in die Krankenstation und lass dir bescheinigen, dass keine gesundheitlichen Einwände gegen die Teilnahme an einem Marathon bestehen. Wir wollen keine Zeit damit verschwenden, uns bei den Ärzten in der Hopkins High School anstellen zu müssen, nur damit jemand dein Herz abhört. Außerdem laufen die Männer nackt in der Turnhalle rum, und das wäre dir peinlich.«
Arnie machte sich wieder auf den Weg zur Post, und ich ging zur Krankenstation. Ich war übermütig genug, die Wahrheit zu sagen, dass ich sechsundzwanzig Meilen laufen wollte, dass ich im Training bereits einunddreißig Meilen geschafft hatte und sicher war, fit zu sein. Der Arzt, ein beleibter Typ in den Sechzigern, strahlte. Er sagte, er könne sich an die Tage von Clarence DeMar erinnern, den siebenfachen Boston-Gewinner. »Mein Gott, das ist ja toll!« Er horchte mein Herz ab, maß den Blutdruck. Dann bat er mich, die Treppen mehrmals rauf- und runterzulaufen, um mich dann erneut abzuhorchen. »Fit wie ein Turnschuh!«, rief er laut. Er schrieb genau die Bescheinigung aus, die ich brauchte und benutzte den Namen aus der Patientenkartei: Kathy Switzer. »Viel Glück, viel Glück!«, rief er mir noch nach, als ich sein Sprechzimmer verließ. Diese Erfahrung baute mich auf. Ihn vielleicht auch. Möglicherweise war ich seit Wochen die erste Studentin in seiner Praxis, die nicht wegen eines nervösen Zusammenbruchs rumheulte, die nicht aus heiterem Himmel schwanger war oder sich unter mysteriösen Umständen einen Tripper eingefangen hatte. Boston! Ich fuhr nach Boston!
Ich gab Arnie die Bescheinigung beim Training am nächsten Tag. Wir wollten fünf Meilen joggen, normalerweise eine leichte Übung, aber diesmal war es eine Tortur. Meine Oberschenkelmuskeln waren wie Hackfleisch. Meine Hüfte schmerzte stechend zwischen Oberschenkelknochen und Gelenkpfanne. Ich hatte keine bestimmte Verletzung, ich war wie zerschlagen. Aber schlimmer als die schockierenden Blasen waren meine Zehennägel, die so aufgeschwollen waren vor Blut, dass ich nicht in meine Schuhe kam. Ich musste in die Spitzen meiner schönen blauen adidas-Schuhe, die endlich aus Deutschland gekommen waren, ein dreieckiges Loch schneiden. Das brach mir das Herz. Es waren die teuersten Schuhe, die ich je besessen hatte und die ersten, die mir richtig gefielen. Jetzt musste ich sie verstümmeln, um sie überhaupt anziehen zu können.
Aber die Funktion stand an erster Stelle, das wurde mir immer mehr bewusst, so als müsste ich in den Krieg ziehen. Ich beschränkte mich auf das Wesentliche, befreite mein Leben von allem Überflüssigen, entledigte mich des Schnickschnacks. Mit einer Ausnahme: Ich wollte mir ein schönes Outfit für den Marathon zusammenstellen. Das war nicht leicht, denn modische Aspekte wurden beim Sport kaum berücksichtigt. Doch was gut aussah, musste auch funktional sein, wenn man einen Marathon laufen wollte.
An wärmeren Tagen probierte ich im Training verschiedene Shorts aus, aber die meisten scheuerten hoffnungslos und zwar aus einem einfachen Grund: Sie waren für den männlichen Körperbau zugeschnitten, nicht für die breiteren Hüften einer Frau, ihre weicheren Schenkel. Die kleine Fläche auf den Innenseiten der Oberschenkel wurde besonders schnell wund – und wenn dann noch salziger Schweiß auf die aufgescheuerte Haut kam, blieb auch die beste Läuferin stehen. Arnie hatte in seinem Kofferraum einen ganzen Sack mit Sportkleidung, die er im Lauf der Jahre in den verschiedenen Umkleideräumen eingesammelt hatte. Es müssten sich doch ein paar graue Shorts mit weiten Beinen für mich finden lassen! Burgunderrot war die angesagte Farbe in jenem Jahr, und ich hatte ein burgunderrotes feingestricktes Oberteil, das funktional war und gut aussah. Ich war damit gelaufen und es ging prima, also färbte ich die Shorts in der passenden Farbe. Ich ruinierte dabei das alte Porzellanwaschbecken im Huey Cottage, und die Hausmutter rastete völlig aus, aber ich wurde nicht rausgeworfen. Dieses Waschbecken blieb rosarot, bis zu dem Tag, an dem das Huey fünfzehn Jahre später abgerissen wurde.
Bis auf die Löcher in meinen Schuhen würde ich gut aussehen, und das war mir wichtig. Niemand sollte nach Hause gehen und erzählen, dass die Frauen im Sport alle wie Vogelscheuchen aussähen. Ich hatte dieses Stereotyp satt und wusste, dass ich während des Marathons wenigstens einen Teil zur Zerstörung dieses Mythos beitragen konnte. Arnie sagte, wir könnten in Boston unsere ältesten ausgeleierten Trainingssachen anziehen. Wir würden sie tragen, wenn wir uns einliefen, und wenn uns warm genug war, würden wir sie ausziehen und wegwerfen. »Die Organisatoren in Boston schaffen es nie, dir deine Trainingssachen am Ende des Rennens zurückzugeben, also kannst du sie auch gleich wegwerfen«, sagte er. Ich dachte, gut, dann bin ich das alte Zeug gleich los, und wenn ich es ausgezogen habe, voilà, dann werde ich ein Traum in Burgunder sein.
John Leonard erschien zum Training. Er hatte sich erst vor Kurzem entschlossen, mit nach Boston zu kommen und dort auch zu starten, eine beunruhigende Entscheidung in meinen Augen, denn er hatte zwar in der Woche mit uns trainiert, um die Form zu halten, aber fast keinen langen Lauf mitgemacht. Ich konnte mir nicht vorstellen, sechsundzwanzig Meilen in der Öffentlichkeit zu laufen, ohne die Distanz einmal geschafft zu haben. Aber Arnie versicherte mir, ein bisschen von oben herab, dass die meisten Läufer es so machten, und setzte seinen Namen auf die Reiseerlaubnis.
Als wir später allein waren, sagte ich Arnie, dass ich John gut leiden könnte, aber keine Lust hätte, die Drei Musketiere zu spielen. Wenn er schwächelte und zurückblieb, würden wir unser Tempo beibehalten. Ich fühlte mich immer mehr wie ein Soldat vor der Landung in der Normandie; wir waren Kameraden, aber wir mussten diesen Landekopf einnehmen, koste es, was es wolle! »Arnie, wenn einer von uns es nicht schafft, dann muss der andere weiterlaufen.« Arnie war einverstanden, aber erstaunlicherweise hatten wir für diesen Fall nie einen Plan gemacht. Jahre später, nachdem ich weiß, wie unwahrscheinlich es ist, dass zwei oder gar drei Läufer, die zusammen gestartet sind, auch gemeinsam ins Ziel kommen, ist es einfach unglaublich, dass wir uns keinen Alternativplan ausgedacht hatten. Ich war nicht auf den Gedanken gekommen, weil ich keine Ahnung hatte, und Arnie hatte entweder gar nicht die Absicht, gemeinsam im Ziel anzukommen, oder er war ebenso naiv und optimistisch wie ich.
Jedenfalls schickte Arnie unsere Anmeldungen ab und ließ uns als Mannschaft der Syracuse Harriers registrieren. Ich wusste nicht, dass ein Harrier ein Querfeldeinläufer war, ich glaubte, es sei ein Synonym für jemand, der es ständig eilig hatte, und an der Art, wie Arnie das Wort aussprach, erkannte ich, dass er es auch nicht wusste. »Haar-Yerrs.« Aber wir waren ein Team, die Würfel waren gefallen, der Countdown lief. Noch drei Wochen. In den ersten beiden trainierten wir, schoben auch zwei mittellange Läufe ein, in der letzten Woche würden wir dann fast gar nicht mehr laufen. Ich konnte gar nicht glauben, dass wir eine Woche frei haben würden, aber Arnie sagte, wir müssten uns in der letzten Woche ausruhen. »Wenn das geschafft ist, können wir nichts weiter tun. Wir können uns ruhig ein wenig ausschlafen.« Das war eine Offenbarung. Ich dachte, wir müssten bis einen Tag vor dem Start hart trainieren, und das war auch ein guter Rat in anderer Hinsicht, zum Beispiel beim Lernen für meine Examina. Ich kam mir dumm vor. Denn so stand es in allen Büchern über die richtige Lernmethode, und ich hatte es nie geglaubt. Jetzt freute ich mich auf die letzte Woche, die Ferien.
Wir beendeten die fünf Meilen an der Sporthalle, die jetzt, da es Frühling wurde, fast leer war. Die Holzbahn war abgebaut worden, und die Läufer trainierten draußen im Archibald Stadium auf der anderen Seite des Campus. Coach Grieve war mit ihnen draußen, aber der Boden war noch zu weich für die Spikes der Werfer, die ihre Würfe oder Stöße mehrmals ausführten, und so trainierte Tom mit den Werfern noch in der Halle. Während ich auf Arnie wartete, der duschte, machte ich Dehnübungen und beobachtete Tom, was mich immer wieder faszinierte. Heute arbeitete er mit den Speerwerfern daran, den Wurfarm effektiv nach hinten zu führen und dann durchzuziehen. Ich würde den Hammerwerfer Tom nie infrage stellen, aber der Speerwurf kam für mich vor allen anderen Wurfdisziplinen, weil er so griechisch war, so olympisch, so nah am Ursprungsgerät, dem Speer. Jedes Jahr las man von einem armen Tölpel, meistens einem eifrigen, aber im entscheidenden Moment unaufmerksamen Funktionär, der von einem Speer durchbohrt worden war. »Das beweist, wie schnell dieser Speer geflogen ist«, sagten wir glucksend.
Arnie verließ gerade die Umkleide, als Tom zu mir kam.
»Hiya. Trinkst du später noch ein Bier mit mir?«
»Natürlich«, sagte ich. Diese kurze Unterhaltung bedeutete, dass wir beide zu unseren Wohnheimen zurückgehen und dort essen würden, da wir uns ein Restaurant nicht leisten konnten. Aber manchmal leisteten wir uns ein Bier in der Orange, dem Studentenlokal. Das war zwar ziemlich schäbig, war aber immerhin eine Verabredung, und Toms Stolz war gerettet. Er hatte zu wenig Geld, um mich eleganter auszuführen, und außerdem war es so nicht so offensichtlich, dass er mich eigentlich nur abholte, um mit mir in seiner Wohnung zu übernachten. Ich würde mir auch Rock und Pullover anziehen, Kleidungsstücke, in denen ich mir weiblicher und sogar sexy vorkam – eine große Erleichterung, nachdem ich tagelang in neutralen Sweatshirts und Jeans im Unterricht gesessen hatte.
In der Kneipe verfiel Tom in eine seiner »schweigsamen« Launen. Vielleicht wegen seines Studiums, vielleicht wegen seiner Geldsorgen. Es bedrückte mich, dass zwei Menschen, die so viel gemeinsam hatten und seit vier Monaten miteinander schliefen, sich so wenig zu sagen hatten. Seine Launen blieben mir immer fremd. Manchmal dachte ich, dass Tom einfach kein guter Gesprächspartner war, dann fand ich diesen Gedanken unfreundlich, denn er war doch so talentiert in anderen Bereichen. Vielleicht langweilte er sich mit mir? Tom war immer cool, er vermittelte mir das Gefühl, es nicht zu sein. Sicher, wenn man neben jemandem sitzt, der schweigt und offenbar alles besser weiß, fühlt man sich wie ein Idiot, der vor sich hin plappert oder wie einer, der »Zwanzig Fragen« spielt, ein Spiel, bei dem man einsilbig antworten muss. Ich wusste, dass ich mich in der Gesellschaft des Mannes, mit dem ich schlief, wohler fühlen sollte, aber ich ließ diesen Gedanken nicht zu.
Schließlich unterbrach er sein Schweigen: »Und? Was macht das Joggen?«, fragte er mit einem sarkastischen Unterton, der sich diesmal auf das Joggen bezog, und das war es dann. Egal, wie untalentiert und langsam ich sein mochte, ich war eine Läuferin, verdammt noch mal, keine Joggerin!
»Das Laufen macht sich sehr gut«, sagte ich scharf. Er wusste, dass ich sonnabends oder sonntags diese langen Läufe machte. Er hatte mich sogar an Arnies Auto abgesetzt, wenn ich die Nacht bei ihm verbracht hatte, und wir lästerten manchmal, wie schockiert Arnie sein würde, wenn er das wüsste. Tom hatte keinen blassen Schimmer von unserem Plan, nach Boston zu fahren, und hin und wieder dachte ich, dass ich es ihm sagen müsste, schob es aber immer hinaus. Ich wollte nicht, dass man von allen Seiten Druck auf mich ausüben könnte, aber jetzt war Boston nur noch drei Wochen entfernt. Und jetzt wollte ich ihm eins auswischen.
Ich trank einen Schluck Bier und blieb möglichst lässig: »Es macht sich so gut, dass Arnie und ich in ein paar Wochen nach Boston zum Marathon fahren.« Es klang, als handelte es sich um einen Einkaufsbummel.
Erst wirkte Tom überrascht, dann erholte er sich schnell, und von einer müden Herablassung durchdrungen, sagte er seufzend: »Ein Marathon ist sechsundzwanzig Meilen und dreihundert–«
Ich schnitt ihm das Wort ab. »Ich weiß, wie lang ein Marathon ist, Tom. Ich bin die Strecke gelaufen. Arnie und ich sind sie letzten Sonnabend gelaufen.« Ich fühlte mich großartig. Statt nervös und angestrengt zu reagieren, war mir angenehm warm. Es war das erste Mal, dass ich ihm überlegen war, und das merkte er. Wir schwiegen. Ich lächelte.
»Okay. Ich fahre auch nach Boston«, sagte er schließlich.
»Wie meinst du das?«
»Ich werde auch laufen. Wenn irgendein Mädchen sechsundzwanzig Meilen schafft, dann schaffe ich das auch.« Ich war eher sprachlos als beleidigt, besonders wegen der Formulierung »irgendein Mädchen«.
»Tom. Du bist ein talentierter Leistungssportler. Ich zweifle nicht daran, dass du es könntest. Aber selbst du müsstest trainiert sein. Für sechsundzwanzig Meilen muss man sehr viel trainieren.
»Ich habe es dir schon einmal gesagt, was irgendein Mädchen schafft, schaffe ich auch.«
Ich versuchte es anders. »Tom, denk mal an das Last-Kraft-Verhältnis. Niemand, der über zwei Zentner wiegt, kann Marathon laufen! Das ist doch wohl klar!«
Daraufhin wurde er wütend: »Ich könnte jetzt aus dem Stand sechsundzwanzig Meilen laufen«, sagte er.
»Boston ist in drei Wochen, Tom«, sagte ich kleinlaut und gab mich geschlagen.
»Das reicht dicke, um mich vorzubereiten«, sagte er und trank schnell sein Bier aus. Wir gingen zu seiner Wohnung zurück. Ich war zu feige, ihm zu sagen, dass ich keine Lust hatte, bei ihm zu übernachten. Wir legten uns auf die Klappcouch, aber diesmal schliefen wir nicht miteinander. Er drehte sich beleidigt von mir weg, und ich lag lange wach, starrte an die Decke und war wütend auf mich selbst, weil ich Tom von Boston erzählt hatte und einen Abend und eine Nacht verschwendete. Ich hatte recht damit, niemandem von meinen großen Träumen erzählen zu wollen, denn Mitwisser zerstören sie. Ich hätte warten sollen, bis wir in Boston waren, und ihn dann anrufen können, aber so geht man doch nicht um mit dem Mann, mit dem man schläft, sagte ich mir. Ich wälzte diesen Gedanken hin und her, bis es Zeit war, aufzustehen und mich zum Unterricht zu schleppen.
Tom war nicht da, als Arnie, John und ich uns an der Sporthalle trafen und losliefen, und er war auch nicht da, als wir zurückkamen. Doch in dem Moment, als ich wieder in mein Wohnheim zurückfahren wollte, legte er einen bombastischen Auftritt hin. Es war inzwischen dunkel geworden, und Tom war ganz rot im Gesicht, er schwitzte und wirkte trotzig. Ich sah, dass er hart trainiert hatte und roch die kalte Nachtluft, die von ihm ausging, ein Geruch, den man nicht nach ein paar Minuten an der frischen Luft an sich hat.
»Neun Meilen, das sollte reichen, um es zu schaffen«, sagte er.
»Wow, Tom, du bist einfach mal so neun Meilen gelaufen?« Ich war verblüfft, dass er das aus dem Stand geschafft hatte.
»Ja, du siehst also, dass ich Boston laufen kann.« Ich sagte nichts, ich sparte mir die Bemerkung, dass zwischen neun Meilen und sechsundzwanzig ein himmelweiter Unterschied liegt. Und damit basta. Arnie und ich erläuterten ihm unseren Plan: Wir würden gemeinsam starten, aber wenn einer von uns nicht mehr mitkam, würde der andere weiterlaufen. Da unsere Anmeldungen längst in der Post waren, schickte Tom seine Anmeldung separat ab, aber weil er so spät dran war, würde er sich die Gesundheitsbescheinigung in Boston ausstellen lassen müssen. Das machte mich wütend, weil es eine weitere Verzögerung und mögliche Komplikationen für uns am Start bedeuten könnte. Erst John, jetzt der Große Tom: ungebeten und nicht gut trainiert. Das waren zu viele Variablen.