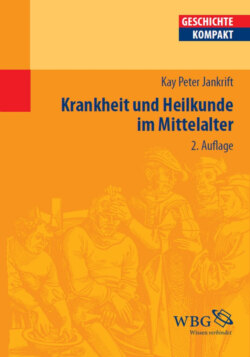Читать книгу Krankheit und Heilkunde im Mittelalter - Kay Peter Jankrift - Страница 26
На сайте Литреса книга снята с продажи.
c) Hospitäler in mittelalterlichen Klosteranlagen
ОглавлениеInfirmarium von Cluny
Es existieren heutzutage keine Klosterhospitäler aus der Entstehungszeit des Sankt Gallener Klosterplans mehr, die eine Umsetzung des Projekts als bauliche Überreste belegen. Erst Klosteranlagen aus späterer Zeit zeigen, in welcher Weise sich mittelalterliche Mönchsgemeinschaften um eine Verwirklichung solcher Idealvorstellungen bemühten. So bestand bereits in der ersten Baustufe des Klosters Cluny in Burgund zwischen 910 und 927 ein Infirmarium, das sich jedoch auf der Basis des spärlichen archäologischen Befundes kaum in seiner Größe fassen lässt. Das um 1040 entstandene so genannte Alte Infirmarium verfügte über vier Zimmer, in denen bis zu acht Bettstätten untergebracht werden konnten. Unter dem Abbatiat Hugos I. von Semur (1049 – 1109), des Taufpaten Kaiser Heinrichs IV., erfolgte um 1082 eine Erweiterung um 24 Betten. Die Bettenzahl erscheint als eine symbolische Anspielung auf die Zwölfzahl der Jünger Jesu. Unter dem neunten Abt von Cluny, Petrus Venerabilis (1122 – 1156), erfuhr das Infirmarium einen Ausbau auf 80 Betten und erreichte damit eine Größenordnung, die es nach Einschätzung des Medizinhistorikers Dieter Jetter in dieser Zeit zu einem der größten Spitäler des Abendlandes machte. Die Zisterzienser folgten im 12. Jahrhundert dem benediktinischen Vorbild. Auch in ihren Klöstern befanden sich Infimarienkomplexe, die in den Überresten der einstigen Anlagen – so im nördlich von Paris gelegenen Ourscamp – noch heute sichtbar sind. Und auch die Bettelorden der Franziskaner und Dominikaner, die sich zu Beginn des 13. Jahrhunderts allmählich entfalteten, integrierten Infirmarien in ihre Klöster.
Hospitalische Fürsorge war nach mittelalterlichen Vorstellungen jedoch selbst im Kloster nicht zu allen Zeiten ein reiner Akt der Selbstlosigkeit. Erfolgte in den frühen Mönchsgemeinschaften eine Versorgung der Bedürftigen aus dem uneingeschränkten Motiv christlicher Nächstenliebe heraus, so begann sich dieses Bild im Laufe der Jahrhunderte in erheblichem Maß zu relativieren. Seit die Cluniazenser um die Jahrtausendwende der Auffassung eines zwischen Himmel und Hölle angesiedelten Fegefeuers Vorschub leisteten, aus dessen Hitze die Seelen durch Gebet und gottgefälliges Handeln errettbar wurden, wandelte sich die Selbstlosigkeit zusehends in eine mehr oder weniger kalkulierte Jenseitsvorsorge.