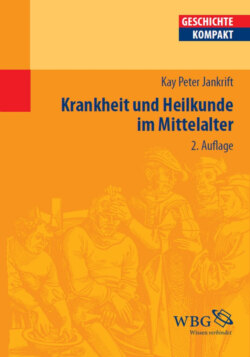Читать книгу Krankheit und Heilkunde im Mittelalter - Kay Peter Jankrift - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
e) Mönchsarzt und Krankenbehandlung
ОглавлениеNicht von ungefähr wird der Abt im Rahmen der Benediktsregel mehrfach mit einem Arzt verglichen, der im übertragenen Sinne die Gebrechen der an ihrer Seele Kranken heilt, Uneinsichtige mit der quasi chirurgischen Maßnahme der Strafe behandelt und hoffnungslose Fälle durch den Ausschluss aus der Gemeinde gleich einem unheilbaren Gliedmaß amputiert. Die Medizin hatte nicht nur einen theoretischen Stellenwert in der Mönchsgemeinschaft. Mönchsärzte wirkten auch in der alltäglichen Praxis.
Medizin im Kloster
Dies zeigt nicht allein der wahrscheinlich bekannteste Exponent der hochmittelalterlichen Klostermedizin, der Arzt Notker aus dem Kloster Sankt Gallen. Notker war nicht nur hinter den Mauern seines Klosters tätig. Vielmehr machte er sich im 10. Jahrhundert am Hof der ottonischen Herrscher durch seine reichen Erfahrungen bei der Behandlung verschiedenster Leiden und Verletzungen einen Namen. Berühmt ist eine Anekdote geworden, die Notkers herausragende medizinische Kenntnis unterstreicht. Der bayerische Herzog Heinrich I. (gest. 955), ein Bruder Kaiser Ottos des Großen, soll dieser zufolge dem gelehrten Mönchsarzt den Urin einer schwangeren Hofdame als seinen eigenen präsentiert haben. Die Harnschau, bei der die Farbe des Urins und die erkennbaren Sedimente zeitgenössischen Vorstellungen zufolge Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand erlaubten, war während des gesamten Mittelalters eines der zentralen Diagnoseverfahren. Notker fiel nicht auf das Verwirrspiel herein. Wortgewandt prophezeite er dem Herzog die Geburt eines Kindes binnen dreißig Tagen als ein göttliches Wunder.
Nur wenige früh- und hochmittelalterliche Mönchsärzte sind namentlich bekannt. Noch seltener sind Zeugnisse ihrer heilkundlichen Leistungen, die sie nicht nur der Mönchsgemeinschaft zur Verfügung stellten. Die im Rahmen archäologischer Grabungen auf mittelalterlichen Klösterfriedhöfen zutage geförderten Skelette sprechen für einen guten medizinischen Kenntnisstand unter den Mönchsärzten, insbesondere im Bereich der Chirurgie. Unter den 526 auf dem Friedhof des dänischen Zisterzienserklosters Øm aufgedeckten menschlichen Gebeinen, die hier vor allem im 12. und 13. Jahrhundert beigesetzt wurden, fanden sich zahlreiche Spuren sorgsam ausgeführter Eingriffe. Der Schädel eines 40- bis 50-jährigen Mannes etwa weist am Stirnbein und dem vorderen Teil des Scheitelbeins eine 58 mm lange, zweifelsfrei durch eine Hiebverletzung mit einer Waffe hervorgerufene Öffnung auf. Die Gestalt der einstigen Wunde lässt erkennen, dass der Mann seine schwere Verletzung dank des im Kloster erfolgten medizinischen Eingriffes überlebte. Der schräge Abfall des oberen Knochenrandes deutet darauf hin, dass eine Meißelung aus therapeutischem Zweck stattgefunden hatte. Die Knochensplitter, die sich in die klaffende Wunde gesetzt hatten, müssen mit großen Geschick entfernt worden sein. Gleichzeitig wurden die Wundränder geglättet. Weitere Schädel weisen ähnliche Merkmale operativer Eingriffe auf. Doch auch die erfolgreiche Behandlung von Arm- und Beinbrüchen wird im Spiegel der Skelette von Øm deutlich. Doch nicht nur die Skelette selbst, sondern auch Funde mittelalterlicher medizinischer Instrumente belegen, dass in den Mauern des Zisterzienserklosters chirurgische Behandlungen durchgeführt wurden.
Noch lange nach den im 12. und 13. Jahrhundert verfügten Einschränkungen zur Ausübung der Medizin durch Mönche finden sich Belege für das heilkundliche Wirken der Brüder. So belegt beispielsweise die chronikalische Überlieferung der westfälischen Stadt Minden an der Weser, dass dort noch im ausgehenden 13. Jahrhundert ein heilkundiger Dominikaner erfolgreich die Behandlung eines langwierigen Augenleidens bei Bischof Volkwin von Schwalenberg (1276 – 1293) unternahm. Der Mindener Bischof war zeitweilig mit völliger Blindheit geschlagen und erlangte durch einen nicht beschriebenen Eingriff des Bruders Burchard seine Sehkraft zurück.