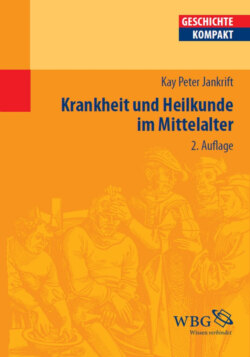Читать книгу Krankheit und Heilkunde im Mittelalter - Kay Peter Jankrift - Страница 29
На сайте Литреса книга снята с продажи.
f) Natürliche Heilmittel: Der Klostergarten
ОглавлениеJedes Kloster verfügte über einen eigenen Klostergarten, in dem Arzneipflanzen und auch Gewürze zur Deckung des klostereigenen Bedarfs angebaut wurden. Bereits das Lorscher Arzneibuch zeigt, wie umfangreich auf der Grundlage des antiken Heilmittelschatzes aus der Natur die Kenntnisse der Mönchsärzte über die Wirkung der Pflanzen waren, die in ihren Gärten wuchsen. Der Sankt Gallener Klosterplan verrät auch die ideale Gestaltung des Klostergartens. Um ein Achsenkreuz liegen die vier- oder achteckig angelegten Beete. In den Gärten oder an deren Rand befand sich ein Brunnen für die notwendige Bewässerung der Pflanzen. Die Art und Weise, in welcher die Beete in mittelalterlichen Klöstern bepflanzt waren, lässt sich heutzutage nirgendwo mehr im Originalzustand sehen. Im Laufe der Jahrhunderte veränderte sich ebenso die Systematik der Anordnung wie der Pflanzenbestand an sich.
Pflanzenarten
Über die Pflanzen, die in den mittelalterlichen Klostergärten gezogen wurden, unterrichten jedoch so beredte Schriftzeugnisse wie das um die Mitte des 9. Jahrhunderts verfasste Lehrgedicht des Walahfrid Strabo, Abt des Klosters auf der Bodenseeinsel Reichenau. Sein Werk unter dem Namen Hortulus entstand in Anlehnung an die antiken Vorbilder Plinius des Älteren und Dioskurides. Dem Idealplan des mittelalterlichen Klostergartens zufolge wuchsen in 16 Beeten jeweils 16 unterschiedliche Gewächse, darunter Stangenbohnen und Bohnenkraut, Liebstöckel und Pfefferminze, Fenchel, Salbei und Rosmarin. Auch Zierblumen wurden in dem Garten gezogen, die als Schmuck für den Altar Verwendung fanden. Falls der Abt von der Reichenau, was wahrscheinlich ist, sein Werk nach der Gestalt seines eigenen Klostergartens ausgerichtet hatte, so wuchsen in dem Bodensee-Kloster noch Kürbisse, Melonen, Mohn, Kerbel und auch Rettich. Es steht außer Frage, dass die Mönchsärzte aus den im Kloster gedeihenden Pflanzen unter Zufügung weiterer Ingredienzien Arzneimittel etwa zur Fiebersenkung, zum Schweißtreiben oder zum Abführen herstellen konnten und dies gewiss auch taten. Betont sei in diesem Zusammenhang jedoch nachdrücklich, dass man sich aufgrund der kaum exakt zu bestimmenden Dosierung mit der inneren Verabreichung von Arzneimitteln während des gesamten Mittelalters zurückhielt. Heilkräftige Wirkung konnte sich bei falscher Dosierung unweigerlich in das Gegenteil verkehren.