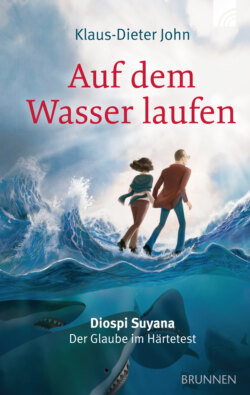Читать книгу Auf dem Wasser laufen - Klaus-Dieter John - Страница 10
Drama, Blut und Tränen
ОглавлениеIch kann gut verstehen, warum die meisten Menschen Krankenhäuser am liebsten meiden. Sie erinnern uns an die eigene Vergänglichkeit und bringen uns zudem in Kontakt mit den Körperflüssigkeiten Blut, Urin und Tränen. Anders als bei Horrorfilmen, die man mit einem leichten Druck auf die Fernbedienung ausschalten kann, lässt sich der Klinikalltag nicht abstellen. Ekel und Grusel bleiben. Nicht nur der Laie erschaudert beim Anblick ausgemergelter Krebspatienten oder der schmutzig gelben Gesichtsfarbe eines Leberzirrhotikers. Auch der erfahrene Mediziner trägt die unangenehmen Eindrücke mit sich herum und nimmt sie am Abend mit ins Schlafzimmer.
Und doch sind wir alle froh, dass es Spitäler gibt. Hier wird Leid gelindert und Leben verlängert. Und wir ahnen, dass auch wir selbst früher oder später Pflege brauchen werden. Auf einer Krankenstation umgeben von anderen bedürftigen Patienten.
In den Bergen Perus haben die Quechuas nur einen sehr beschränkten Zugang zu einer guten medizinischen Betreuung. Deshalb ist es verständlich, warum Alte und Junge strapaziöse Reisen auf sich nehmen, um im Hospital Diospi Suyana behandelt zu werden. Daniel Ticona hatte überzeugende Gründe, als er die ganze Nacht durch den Regen lief, um unser Krankenhaus zu erreichen, Pablo Human hingegen war dazu nicht in der Lage.
Seine 5 erwachsenen Kinder mussten ihren 55 Jahre alten Vater über die Schwelle ins Hospital tragen. Der Indianer aus Südperu litt an einem Aorten-Aneurysma, einer gefährlichen Erweiterung der Hauptschlagader des Körpers. Solche Aneurysmen sind tickende Zeitbomben. Schlagartig können sie platzen und innerhalb von Minuten den Tod durch Verbluten herbeiführen. In Pablos Fall hatte sich die Aussackung der Aorta mit Blutgerinnsel gefüllt, die gelegentlich wie Torpedos dem Blutstrom folgend große und kleine Blutgefäße der Beine verstopften. Der rechte Oberschenkel war bereits kalt und der Fuß schwarz. Auf der linken Seite sah es etwas besser aus, allerdings zeigte die abgestorbene Großzehe, dass akuter Handlungsbedarf bestand. Zu allem Übel hatte sich das tote Gewebe infiziert und eine allgemeine Blutvergiftung, also eine Sepsis, eingesetzt. Ein Herzinfarkt in der Vorgeschichte machte aus Pablo alles andere als einen guten chirurgischen Kandidaten. Wegen dieser Kombination von Risikofaktoren hatte sich bisher kein Chirurg vorgedrängt, um dem Kranken zu helfen. Die Erfolgschancen waren einfach zu niedrig.
Als die Kinder ihren Vater vorsichtig im Sprechzimmer absetzten, schauten sie erwartungsvoll auf unseren Gefäßchirurgen Dr. Thomas Tielmann. „Doktor, bitte tun Sie etwas“, flehten ihre Augen, „wir wollen nicht, dass unser Vater vor die Hunde geht!“
Dr. Tielmann erhob bei Pablo einen gründlichen körperlichen Befund und ordnete dann eine Reihe von Untersuchungen an. Schließlich teilte er der Familie seine Entscheidung mit: „Ich bin bereit, Ihren Vater zu operieren“, erklärte er, „aber ob er überleben wird, weiß nur Gott!“
Aus einer spontanen Gefühlsregung heraus nahmen Pablos erwachsene Kinder den Missionsarzt in die Arme. Diese Geste drückte mehr aus als jedes Wort. Die Familienangehörigen schöpften wieder etwas Hoffnung und fühlten sich endlich verstanden und angenommen.
Wann haben Sie das letzte Mal Ihren Hausarzt vor Dankbarkeit an sich gedrückt? Das ist wahrscheinlich schon eine Weile her. Pablo weinte, als Dr. Tielmann ein Gebet sprach und die nächsten Tage bewusst Gott anvertraute. Sein Leben würde zwar wortwörtlich auf des Messers Schneide liegen, aber nicht das Damoklesschwert des Zufalls hätte das finale Sagen, sondern Gott, der unser Schicksal in seinen Händen hält.
Auch die Operation begann mit einem Gebet. Nach Eröffnung der Bauchwand unterbrach Dr. Tielmann mit einer großen Klemme, die er unterhalb des Abgangs der Nierenarterien ansetzte, den Blutfluss in der Aorta. Er schnitt mit umsichtigen Handgriffen das Aneurysma auf und nähte eine Rohrprothese aus Polyester ein. In einem zweiten Schritt entfernte er mit einem Ballonkatheter mehrere Thromben aus den Beckenarterien. Mit der verbesserten Durchblutung wurden die beiden Oberschenkel wieder warm. In der letzten Phase amputierte er den rechten Oberschenkel. Insgesamt dauerte dieser Hochrisikoeingriff vier Stunden. Er verlief erfolgreich und rettete ein Menschenleben. Langfristig ist daran gedacht, den Patienten mit einer Beinprothese zu mobilisieren. Gott sei Dank, dass es diese Möglichkeit gibt!
Übrigens bilden wir am Hospital Diospi Suyana Assistenzärzte aus und unterrichten junge Krankenschwestern. Für Medizinstudenten aus dem Ausland wird ihre Famulatur (Praktikum) an unserer Einrichtung meist zu einer eindrücklichen Lebenserfahrung. Sie sehen bei uns fortgeschrittene Krankheitsbilder, die sie in Europa oder in den USA so gut wie nie zu Gesicht bekommen würden.
Meine Frau Martina wirbelte in der ihr typischen Art durch die Notaufnahme. Alle sieben Krankentragen waren mit Patienten belegt und der Warteraum draußen quoll über. „Rebekka, schau dir mal die Schwangere dort hinten näher an und erhebe ihre Anamnese“, Martina zeigte mit einer flüchtigen Handbewegung auf eine junge Frau mit einem enormen Bauchumfang.
Die Schweizer Medizinstudentin schnappte sich ihren Notizblock, trat an die Patientin heran und zog den Vorhang hinter sich zu. Keine fünf Minuten später erstattete die angehende Ärztin ihren Bericht. „Die Indianerin ist gar nicht schwanger“, sagte sie zu Tinas Überraschung. „Sie hat einen Ultraschallbericht eines externen Arztes dabei, der besagt, dass es sich um einen großen Tumor handelt!“
Die 29-Jährige wurde umgehend unserem Gynäkologen Dr. Jens Haßfeld vorgestellt. Ein Kontroll-Ultraschall sowie ein Computertomogramm bestätigten die Verdachtsdiagnose einer riesengroßen Ovarialzyste. Bereits am nächsten Tag lag die Patientin auf dem OP-Tisch und Dr. Haßfeld entfernte mit viel Erfahrung einen Tumor von sage und schreibe 14 ½ Kilogramm.
Der Blutverlust hielt sich in Grenzen und Alicia Carbajal überstand die folgende Nacht ohne Komplikationen. Am Morgen lief sie glücklich und sichtlich erleichtert über die Krankenstation. Die feingewebliche Untersuchung ergab keinerlei Hinweise auf eine Krebserkrankung und die Mutter von zwei Kindern war durch diesen Eingriff geheilt. Was unsere Medizinstudentin angeht, wird sie den Fall wohl bis an ihr Lebensende nicht vergessen.
Generell gilt in Südamerika, dass man am Morgen nicht weiß, was der Abend bringen wird. Diese Aussage trifft besonders auf den Alltag eines Krankenhauses zu. Da ist selbst der nächste Augenblick nicht vorhersagbar. Am Hospital Diospi Suyana sind viele Positionen nur einmal besetzt. Das heißt, es gibt einen einzigen Traumatologen, einen Urologen und nur eine Allgemeinchirurgin. Wenn das Telefon klingelt und der Patient rollt in die Notaufnahme, ist der jeweilige Arzt gefordert. Dabei geht es nicht um Lust und Laune, sondern um Pflichterfüllung zu jeder Tages- und Nachtzeit.
Wie an jenem Freitagabend. Familie Boeker wollte das Wochenende gemütlich einläuten. Erst ein Stockbrot am Lagerfeuer rösten und danach mit den Kindern einen schönen Film anschauen. Doch dann erhielt unser Arzt Dr. Tim Boeker einen ominösen Anruf aus dem Krankenhaus, der auf der Stelle alle Planungen über den Haufen warf: „Kommen Sie sofort in die Notaufnahme. Ein junger Mann hat sich mit der Kreissäge seinen rechten Vorderarm verletzt!“
Unser Traumatologe fuhr sofort in das Missionsspital. Der Befund: Der rechte Vorderarm war fast vollständig „amputiert“ und wurde nur noch an einer Seite durch einige Weichteile und den Ulnar-Knochen, die Elle, zusammengehalten. Die elektrische Säge hatte die Arterien, Venen, Nerven, Knochen und die meisten Sehnen durchtrennt. Nun bestanden zwei Möglichkeiten: Der Arzt hätte den Vorderarm ganz abschneiden, die Wunde zunähen und anschließend zu Hause das Heimkino genießen können. Oder er würde in einer Nachtschicht das Unmögliche versuchen, nämlich all die vielen Strukturen zu reparieren.
Dr. Tim Boeker entschied sich für die zweite Variante und wurde dabei maßgeblich durch Dr. David Brady unterstützt. Die Operation dauerte sechs Stunden. Die Durchblutung des Vorderarmes war danach zufriedenstellend, und nach und nach kehrte Gefühl in die Hautareale zurück. Wohl jeder von uns kann den Jubel des Patienten nachvollziehen, als er nach und nach in der Lage war, seine rechte Hand wieder sinnvoll zu bewegen.
Während meiner Vortragsreisen werde ich regelmäßig gefragt, welche Bedeutung dem Gebet bei der Versorgung unserer Patienten zukomme. Unsere Ärzte sind hervorragend ausgebildet und praktizieren Schulmedizin auf hohem Niveau. Aber als Christen wissen wir um die besondere Bedeutung des Segen Gottes bei all unseren Bemühungen. Gott ist der Herr über Leben und Tod. Deshalb beten wir nicht nur im Morgengottesdienst, sondern auch am Krankenbett und im Operationssaal. Die Patienten nehmen dieses Angebot dankbar an. „Just do your best and let Him take care of the rest!“, sang der christliche Songwriter Keith Green in den 1980er-Jahren: „Gib dein Bestes und überlasse Gott alles Übrige!“ An diese Empfehlung halten wir uns gerne. Und gelegentlich erleben wir Überraschungen, die nach den Regeln der medizinischen Logik nicht erklärt werden können.
30. November. Es war ein langer Arbeitstag von zwölf Stunden im Spital gewesen. Müde stellten meine Frau und ich zu Hause unsere Taschen auf den Boden. Tina kämpfte mit einer schweren Erkältung. Sie war zum dreiundachtzigsten Geburtstag ihres Vaters in Deutschland gewesen. Eine anstrengende Stippvisite von sieben Tagen: Cusco – Lima – Madrid und Frankfurt, hin und zurück. Sofort nach ihrer Rückkehr hatte Tina sich wieder an die Behandlung der vielen Patienten gemacht. Aber der Jetlag, gepaart mit dem chronischen Schlafmangel, forderte seinen Tribut. Besonders ihr tiefer Husten gefiel mir nicht.
„Musst du heute Abend noch etwas Dringendes erledigen?“, fragte ich sie mit sorgenvollem Blick.
„Nein, eigentlich nicht!“, antwortete sie und ging in die Küche, um Apfelmus zu kochen. Während ich im Schlafzimmer ein Sudoku löste, vernahm ich plötzlich die Sirene eines Krankenwagens. Ganz leise. Dann etwas lauter. Als Nächstes hörte ich, wie unten jemand die Garagentür aufriss. Ein Motor sprang an.
„Ich komme mit!“, rief ich in den Hof hinunter. Doch zu spät. Meine Frau war schon längst um die Straßenecke gebogen. Langsam schloss ich das Tor. Was war nur los?
Trotz der vorgerückten Stunde fand ich auf der Straße ein Mototaxi, das mich zum Spital brachte. Ich entdeckte Martina mit unserer Kollegin Dr. Ana Delgado und einigen Krankenschwestern in der Röntgenabteilung. Ihr kurzer Bericht beschrieb eine Tragödie, die wieder einmal zeigte, dass ein Unheil zu jeder Zeit wie aus dem Nichts zuschlagen kann.
Der kleine Pedro und sein zwölfjähriger Bruder Jose spielten im Gelände unweit des Apurimac-Flusses. Da passierte es. Jose stürzte kopfüber in ein tiefes, aber schmales Erdloch. Er versuchte sich mit wilden Bewegungen aus seiner Falle zu befreien. Doch umsonst. Von allen Seiten rieselte Sand auf den verzweifelten Jungen und begrub seinen Kopf. Und mit jedem panischen Atemzug drang schmutzige Erde in seine Lungen. Pedro zog an Joses Beinen, aber ihm fehlte die Kraft. Dann rannte er davon, um Hilfe zu holen. Es verging Zeit. Viel Zeit. Wenn jemand lebendig begraben ist, wird eine halbe Stunde zu einer Ewigkeit. Nach zehn Minuten sterben die ersten Zellen im Gehirn ab. Endlich gelang es einem Nachbarn, Jose herauszuziehen. Sein regungsloses Gesicht war mittlerweile tiefblau angelaufen. In diesem jämmerlichen Zustand brachte die Familie den Erstickten zum Hospital Diospi Suyana.
Sorgenvolle Mienen im Röntgenraum. Das zentrale Nervensystem von Jose war durch den langen Sauerstoffmangel massiv geschädigt. Die verletzten Zellen gaben unkoordinierte Salven ab und führten zu gewaltsamen Krampfanfällen des Jungen. Alle Mitarbeiter am Bett packten zu und hielten ihn fest. Über die Infusion liefen starke Anti-Krampfmittel in die Vene.
Nach dem Computertomogramm des Kopfes machten wir ein Röntgenbild der Lunge. Um 21 Uhr holte ich die Anästhesistin Dr. Leslie Ichocan vor ihrer Haustür ab. Wir brauchten Verstärkung. Dabei wusste niemand, ob die Gehirnfunktion des Kindes überhaupt noch zu retten wäre.
Höchste Konzentration auf der Intensivstation. Ein Versuch, den Vater und die Mutter auf das Schlimmste vorzubereiten. „Wir wissen nicht, ob Ihr Sohn jemals wieder aufwachen wird“, sagte Tina einfühlsam den vor Schreck erstarrten Eltern. Dann das übliche Protokoll. Intubation der Luftröhre, Magensonde, Urinkatheter und ein arterieller Zugang. Der Junge, der noch am Nachmittag fröhlich gelacht hatte, hing nun an Schläuchen und Kabeln. Antibiotika für die Lunge. Medikamente gegen eine Hirnschwellung. Drama und Trauer. Warum hatte Gott das nur zugelassen?
Um 23 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag verließen wir drei das Missionsspital und fielen müde ins Bett. Um 1 Uhr in der Nacht würden uns die nächsten Blutergebnisse telefonisch mitgeteilt werden.
Am Morgen war keine Besserung in Sicht. Das klinische Bild legte einen irreversiblen Hirnschaden nahe. Da betrat Gladys Illesca, die damalige Leiterin unserer Kinderklubs, die Intensivstation und kniete an Joses Bett nieder. „Gott, wenn dieser Junge auf eigenen Beinen das Krankenhaus verlässt“, betete sie mit lauter Stimme, „dann werde ich seine nächste Geburtstagsfeier ausrichten!“ Ein Schrei um Hilfe für einen Jungen, dem nach klinischer Erfahrung nicht mehr zu helfen war.
Montagmorgen wachte Jose aus seinem Koma wieder auf. Gegen 11 Uhr am Vormittag begrüßte er meine Frau mit den Worten „Gracias“, vielen Dank. Er sprach und reagierte, als ob nichts gewesen wäre. Seine kognitiven Fähigkeiten ließen keinen Defekt erkennen, und er bewegte seine vier Gliedmaßen ohne jede Einschränkung. Für uns Ärzte ein unglaublicher Vorgang.
Acht Monate später am 25. August feierte Jose seinen dreizehnten Geburtstag im Kinderklubhaus unserer Mission. Gladys hatte – wie versprochen – die Party ausgerichtet. Jose ist völlig gesund geblieben und hat keine bleibenden Schäden davongetragen. Von uns Ärzten hatte damals wohl niemand den Glauben gehabt, um seine Heilung zu beten, aber Gladys hatte ihn. Medizinisch ist der Fall völlig unerklärlich, denn die neurologische Katastrophe hatte nachweislich stattgefunden.
Auf unserer Webseite schrieb ich einen Tag nach seinem Geburtstag: „Hoffentlich wird Jose nie vergessen, dass ihm ein zweites Leben geschenkt wurde!“
In diesem Kapitel habe ich vier Patienten mit ihren Leidensgeschichten vorgestellt. Mittlerweile behandeln wir am Tag bis zu 250 Hilfsbedürftige, das heißt 5.000 Patienten im Monat. Wir tun für sie das, was wir können. Oft sind wir mit unseren Therapien erfolgreich, aber nicht immer. Die meisten Kranken schätzen unseren Einsatz, aber nicht alle. Wir verrichten unseren Dienst aus Leidenschaft und nicht des Geldes wegen. Manchmal sind wir müde und erschöpft, aber wir zweifeln nie an der Sinnhaftigkeit unseres Handelns.