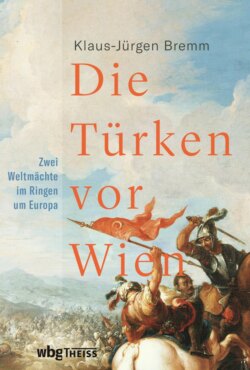Читать книгу Die Türken vor Wien - Klaus-Jürgen Bremm - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4Ein Spanier in Wien und die vergiftete ungarische Erbschaft
Оглавление»Von dort (Bruck a. d. Leitha) erhoben wir uns und am zweiundzwanzigsten des Monats Moharrem (26. September) kamen wir zur Stadt, die Wien heißt, und wie der erwähnte König (Ferdinand) dies hörte, erhob er sich und floh und ging in das Königreich Böhmen, in die Stadt, die Prag genannt wird, und verbarg sich dort und wir erfuhren nicht, ob er lebend sei oder todt.«
Schreiben Sultan Süleymans vom 13. November 1529 an
Andrea Gritti, den Dogen von Venedig 1
Die Nachricht vom Untergang der Ungarn erreichte Erzherzog Ferdinand von Österreich am 4. September 1526 in Innsbruck.2 Zwei Tage später besaß der Habsburger auch die traurige Gewissheit, dass sein königlicher Schwager auf der Flucht vom Schlachtfeld umgekommen war.3 Ferdinands Gram dürfte sich freilich in Grenzen gehalten haben. Gemäß dem Vertrag von 1515 konnte der jüngere Bruder Kaiser Karls V. nach dem Tode Lajos’ II. endlich Anspruch auf die Kronen Ungarns und Böhmens erheben. Beide Erbschaften bedeuteten eine ungemeine Aufwertung seiner bisher marginalen Stellung im Reich.
Der 23-jährige Spanier, Sohn des früh verstorbenen Burgunderherzogs Philipp des Schönen und seiner Ehefrau Johanna von Kastilien, hatte als Ausländer ohne Kenntnis der Landessprache in den österreichischen Erblanden, die ihm nach dem Wormser Teilungsbeschluss von 1521 zur Regierung überlassen worden waren, von Anfang an mit vielen Widerständen zu kämpfen. Schon im ersten Jahr seiner Herrschaft musste Ferdinand die ständische Opposition in Innerösterreich mit aller Härte in ihre Grenzen weisen. Acht führende Repräsentanten Wiens, darunter der Bürgermeister Martin Siebenbürger, verloren nach einem öffentlichen Prozess auf dem Marktplatz von Wiener Neustadt am 11. August 1522 ihren Kopf.4 Drei Jahre später ließ Ferdinand die Bauernaufgebote im Salzburger Land durch seinen Feldhauptmann Niklas von Salm zerschlagen. Als getreuer Enkel und Erbe der spanischen Reyes católicos (Isabella von Kastilien und Ferdinand II. von Aragón) war der junge Habsburger zudem nach Kräften bemüht, die »lutherische Ketzerei« und mehr noch die zersetzende Widertäuferei zu bekämpfen, die sich längst auch in seinen Erblanden auszubreiten drohte.5 Vor allem aber drückte Ferdinand sein Anteil an dem riesigen Schuldenberg von sechs Million Gulden, immerhin sechs Jahresetats, den der 1519 verstorbene Kaiser Maximilian I. seinen beiden Enkeln hinterlassen hatte und dessen Tilgung eine Reihe höchst unpopulärer Maßnahmen erforderte.6
Ferdinand war ursprünglich als Erbe der spanischen Krone vorgesehen gewesen, doch sein älterer Bruder Karl hatte ihn mithilfe des einflussreichen Kardinals Jiménez de Cisneros in seinem Heimatland geschickt ausgebootet. Zwar winkte ihm nach der Katastrophe von Mohács und König Lajos’ Tod ein stattliches Ersatzkönigreich, doch das von den Osmanen fast zur Gänze überrannte Land schien jetzt noch ungreifbarer und ferner als seine alte spanische Heimat.
Schon in den ersten Oktobertagen 1526 nahm jedoch der politische Horizont für Ferdinand hellere Konturen an. Entgegen aller Befürchtungen hatte die siegreiche Armee des Sultans ihren Vormarsch zur Reichsgrenze nicht fortgesetzt, auch schien Süleyman keine Anstalten zu treffen, seine jüngste Eroberung dauerhaft in Besitz zu nehmen. Die Osmanen räumten nicht nur Ofen und Pest, sondern fast das gesamte Land. Als die kaum glaubliche Nachricht von Süleymans Rückzug in Innsbruck eintraf, war der stets loyale Ferdinand noch vollauf damit beschäftigt, Truppen für den Krieg seines Bruders in Italien aufzustellen. Nun würde er diese Streitkräfte selbst benötigen, denn noch ehe der Sultan mit allem Pomp am 13. November nach Konstantinopel zurückgekehrt war, hatte der ehrgeizige Woiwode Siebenbürgens, János Szápolya, die vakante Krone des legendären Staatsgründers Stephan für sich reklamiert und sich in Stuhlweißenburg von den ungarischen Magnaten zum König ausrufen lassen. Ferdinand musste auf diesen Affront reagieren. Mit tatkräftiger Unterstützung seiner Schwester Maria, der verwitweten Königin, und dem Einsatz beträchtlicher Bestechungsgelder ließ sich der Habsburger in Pressburg von den westungarischen Ständen am 16. Dezember 1526 gleichfalls zum König von Ungarn wählen. Vor allem das unbedingte Hilfsversprechen des Kaisers, der sein ganzes politisches und militärisches Gewicht gegen die Osmanen in die Waagschale werfen wollte, dürfte viele Magnaten zunächst auf die Seite Ferdinands gezogen haben.7 Mit ihrer Hilfe gelang es dem Habsburger, seinen Rivalen fürs Erste zu besiegen und Szápolya bis Ende des Winters ganz aus Ungarn zu vertreiben. Damit war jedoch für Ferdinand nur wenig gewonnen, denn nach wie vor betrachtete der Sultan das besiegte Land als seinen Besitz und empfand die Forderungen der von Ferdinand im Mai 1528 nach Konstantinopel geschickten Gesandten als inakzeptable Anmaßung. Als die habsburgischen Diplomaten im Namen ihres Herrn die Rückgabe aller seit 1521 verlorenen ungarischen Festungen verlangten, quittierte Großwesir İbrahim Pascha dies mit der höhnischen Frage, ob man denn nicht gleich auch Konstantinopel zurückhaben wolle.8
Dass Ferdinand nach dem Tod Lajos’ II. seine vertraglichen Rechte auf Ungarn reklamieren würde, war für den stets gut unterrichteten Süleyman keine echte Überraschung. Die überzogenen Ansprüche des Habsburgers machten ihm jedoch klar, dass er wohl einen gefügigeren Vasallen in Ungarn benötigte. Umso willkommener war ihm da der zur selben Zeit am Bosporus erschienene Vertreter des vertriebenen János Szápolya. Ferdinands nach Polen geflohener Rivale ließ bei der »Hohen Pforte« um Hilfe gegen die Habsburger ersuchen und erklärte sich im Gegenzug bereit, das Land zukünftig nach den Befehlen des Sultans zu regieren. Mit polnischen Hilfstruppen und dem Segen des Sultans wagte Szápolya im Sommer 1528 die Rückkehr nach Ungarn, wo im September ein kleiner Erfolg seiner Armee über Ferdinands Truppen seiner Sache weiteren Auftrieb verschaffte. Viele Magnaten wechselten jetzt wieder die Seiten oder spielten wenigstens mit dem Gedanken, nachdem ihnen inzwischen klar geworden war, über wie wenig Hilfsmittel der Habsburger tatsächlich gebot.9
Während Ferdinand im Laufe des Frühjahrs 1529 in seinen Erblanden unverzagt von Landtag zu Landtag reiste, um von den meist skeptischen Landesvertretungen zusätzliche Geldmittel als Türkenhilfe zu erwirken, bereitete sich in Konstantinopel der Sultan darauf vor, drei Jahre nach seinem Triumph von Mohács, in denen er nach den Worten des rumänischen Historikers Nicolae Jorga das Schicksal des Landes vergessen zu haben schien,10 seinen dritten großen Heereszug nach Ungarn zu unternehmen. Der unbotmäßige Habsburger, von Süleyman geringschätzig nur der »König von Wien« genannt, sollte aus seiner angemaßten Erbschaft wieder vertrieben werden.
Die verzögerte Rückkehr seiner lange in Konstantinopel festgehaltenen Gesandten hatte sogleich Ferdinands Befürchtung geweckt, dass seine wenig geliebte Residenzstadt Wien das nächste Angriffsziel der osmanischen Heeresmacht sein würde. Im April 1529 warnte der Habsburger eindringlich den in Speyer zusammengekommenen Reichstag, dass der Sultan, falls ihm die Eroberung von Wien glücken sollte, daselbst überwintern könnte, um im nächsten Frühjahr zur Unterwerfung Deutschlands zu schreiten.11 Unter den Reichsständen, allen voran bei Herzog Ludwig von Bayern, erzielte Ferdinands Schreckensszenario einer osmanischen Invasion des Reiches freilich kaum die gewünschte Wirkung. Falls der »Großtürke« tatsächlich mit seinem Heer vor Wien erscheinen sollte, dann allein, um den habsburgischen Ansprüchen auf den ungarischen Thron eine Abfuhr zu erteilen, so der Tenor der zahlreichen Skeptiker. Weshalb also Gut und Blut gegen die »Turken« einsetzen? Nur um dem Habsburger Ferdinand zusätzlich zur böhmischen Krone auch noch die Ungarns zu verschaffen? Wer konnte schließlich garantieren, dass der erzkatholische Spanier die Truppen, nachdem man sie ihm erst einmal bewilligt hatte, am Ende nicht gegen die Reformation im Reich einsetzen würde? Immerhin bewilligte die hohe Versammlung am 22. April dem Habsburger wenigstens einen Teil seiner Forderungen. Die beschlossenen 20 000 Fußsoldaten sowie 4000 Reiter unter dem Befehl des Pfalzgrafen Friedrich von Bayern reichten freilich kaum aus, um sich den Osmanen in offener Schlacht stellen zu können. Erfahrungsgemäß würden die Truppen auch nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen.
Ferdinand hatte nicht nur die althabsburgische Ländermasse geerbt, sondern auch die bewährte Findigkeit seiner Ahnen, jede nur erdenkliche Finanzquelle zu erschließen. Ausgestattet mit päpstlichem Dispens, forderte er jetzt sogar von dem in seinen Erbländern ansässigen Klerus den vierten Teil der Einkünfte, den sogenannten Quart. Ob er sein feierliches Rückzahlungsversprechen jemals würde einhalten können, erschien mehr als zweifelhaft in diesen spannungsgeladenen Wochen, da bereits ein gewaltiger osmanischer Heerbann unaufhaltsam donauaufwärts nach Nordungarn vorrückte. Als Ferdinand klar wurde, dass die erhofften Verstärkungen aus Italien nicht mehr rechtzeitig vor Wien eintreffen würden, da der Friede zwischen Karl V. und Papst Clemens VII. erst am 29. Juni 1529 zustande gekommen war, fasste er einen für ihn gewiss bitteren Entschluss. Spät, und wie sich bald herausstellte, viel zu spät, schickte der Erzherzog einen weiteren Gesandten mit dem praktisch unlösbaren Auftrag zu Süleyman, einen zehnjährigen Waffenstillstand in Ungarn zu erwirken. 10 000 Dukaten wolle Ferdinand dem Sultan jährlich zahlen. Seinem Großwesir İbrahim Pascha wurden noch einmal 6000 Dukaten in Aussicht gestellt. Mit derart bescheidenen Summen konnte jedoch ein Sultan an der Spitze seiner Hauptarmee kaum noch umgestimmt werden. Ferdinands Bevollmächtigter, Freiherr Niklas Jurischitsch, der bis Möttling gereist war, wartete dort vergeblich auf die Zusage freien Geleits.12
Immerhin verschaffte die wieder einmal widrige Witterung mit Dauerregen und Hochwasser dem Habsburger ein willkommenes Zeitfenster. Das Kriegstagebuch des Sultans notierte für Anfang Juni tagelangen Regen und über die Ufer tretende Wasserläufe. Viele Soldaten konnten sich vor den reißenden Fluten der Maritza nur noch auf die Bäume retten.13 Erst am 10. August, genau drei Monate nach seinem Abmarsch aus Edirne, erreichte das Heer des Sultans das alte Schlachtfeld von Mohács. Auf der Stätte seines bisher größten Triumphes empfing Süleyman den mit seinen Truppen herbeigeeilten János Szápolya mit ausgesuchter Höflichkeit. Der Sultan erhob sich sogar von seinem Thron und kam dem Ankömmling mehrere Schritte entgegen, doch zugleich machte er Mohács durch die Szenerie endgültig zum Symbol der ungarischen Unterwerfung. Mit der Einforderung des obligaten Handkusses bekräftigte Süleyman unmissverständlich vor aller Welt den Vasallenstatus des Ungarn. Der feierlichen Begegnung folgten zehn Ruhetage, ausgefüllt mit Jagden und Banketten, ehe sich die beiden Heere, getrennt durch die Donau, endlich auf den Weg nach Ofen machten, wo Szápolya in der Residenzstadt der ungarischen Könige offiziell inthronisiert werden sollte. Allerdings musste zuvor noch die bescheidene habsburgische Besatzung aus der Stadt vertrieben werden. Die gerade einmal 2000 Söldner, die Ferdinand unter dem Kommando von Thomas Nádasdy, einem loyalen ungarischen Magnaten, in Ofen zurückgelassen hatte, schien für die Heeresmacht des Sultans kein wirkliches Problem. Dass die Stadt gleichwohl schon am 8. September nach nur fünftägiger Belagerung in die Hände der Osmanen fiel, war einer Meuterei der habsburgischen Söldner zu verdanken. Die inzwischen auf das Stadtschloss zurückgedrängte Besatzung, bestehend aus zwei Fähnlein österreichischer Landsknechte, hatte die Fortsetzung des Kampfes verweigert, ihre Anführer, darunter Nádasdy, kurzerhand gefangen gesetzt und eigenmächtig mit den Belagerern Verhandlungen aufgenommen. Durchaus erfreut über die überraschende Wende, gewährte Großwesir İbrahim Pascha den Meuterern den gewünschten freien Abzug, ließ aber auch den ihm in Ketten übergebenen Nádasdy bald wieder frei. Freilich löste die unerwartete Verkürzung des Kampfes nicht überall Begeisterung aus. Die sich so jäh um den erhofften Sturmsold geprellt fühlenden Janitscharen begannen zu meutern, schrien den Großwesir nieder, warfen Steine auf seine Offiziere und sprachen, wie es im Feldzugstagebuch des Sultans heißt, »viele unvernünftige Worte«.14 Die Lage drohte außer Kontrolle zu geraten. Ein Teil der Janitscharen machte sich sogleich befehlswidrig an die Verfolgung der abrückenden Söldner, holte sie noch in den Weinbergen vor der Stadt ein und hieb sie fast alle nieder. Nur wenige Reiter konnten entkommen und verbreiteten die Nachricht von dem Massaker und dem scheinbaren Wortbruch des Sultans bis nach Wien.15
Auch wenn die günstige Jahreszeit für einen Feldzug schon fast verstrichen war, entschloss sich Süleyman nach kurzer Beratung mit İbrahim Pascha, die Stadt Wien anzugreifen. Der Aufruhr seines Elitekorps hatte ihm klar gemacht, dass er die Ansprüche seiner Truppen auf Beute nicht länger ignorieren konnte. In Ungarn war den osmanischen Soldaten das Plündern strikt untersagt gewesen, jetzt aber lag ein reiches Land und vor allem die legendäre Stadt Wien in Reichweite. Das militärische Risiko erschien Süleyman nicht zu groß.
Als das Heer des Sultans am 14. September 1529 gegen Wien aufbrach, traf es vorerst kaum auf habsburgischen Widerstand. Die Festungen Raab (Györ) und Komorn waren von ihren Verteidigern bereits geräumt worden, und die Tore von Gran (Esztergom) wurden Süleyman von Erzbischof Pál Várdai sogar freiwillig geöffnet. Zuvor hatte der katholische Kleriker den abziehenden Österreichern den Zutritt verwehrt. Einzig Pressburg verweigerte die Übergabe, wurde aber von den Osmanen selbst dann nicht angegriffen, als die Besatzung mit ihren schweren Geschützen mehrere osmanische Schiffe auf der Donau beschädigte oder gar versenkte.16 Vor dem Überschreiten des Grenzflusses Leitha hielt Süleyman am 23. September noch einmal eine große Heerschau ab, während wohl 30 000 Akıncı bereits plündernd und mordend durch das Wiener Umland zogen.
Ferdinand hatte lange gehofft, genügend Truppen zusammenzubringen, um über Kroatien den heranmarschierenden Gegner in seiner Flanke anzugreifen. Sein pathetisches Manifest an die ganze Christenheit vom 28. August, in dem er die tödliche Gefahr für das gesamte Reich noch einmal hervorgehoben hatte,17 war jedoch ohne die gewünschte Resonanz geblieben. Das von den Reichsständen als »eilende Türkenhilfe« bewilligte Heer unter dem Befehl des Pfalzgrafen war im Raum Krems erst in der Sammlung begriffen. Die wenigen sofort verfügbaren Truppen reichten bestenfalls, um Wien eine Zeit lang zu verteidigen. Schon im Mai hatte Ferdinand seinen bewährten Feldhauptmann Niklas von Salm mit der Abwehr der Osmanen betraut, was nun auch die Verteidigung der Stadt einbegriff. Der Habsburger selbst war nach seiner Rückkehr aus Speyer mit seiner Familie im vorerst sicheren Linz verblieben.
Auch die meisten Wiener zeigten kein großes Vertrauen in die Verteidigungsfähigkeit ihrer Stadt. Von den mit jedem Tag bedrohlicher klingenden Nachrichten in Panik versetzt, drängten sie in Massen aus den Toren Wiens, nicht ahnend, dass sie auf dem offenen Land erst recht in ihr Verderben rannten. Gegen die wie ein Gewitter über sie hereinbrechenden Streifkorps der Akıncı sollten sie völlig schutzlos sein.
Eine noch am 17. September durchgeführte Musterung ergab, dass von vormals 3500 wehrfähigen Bürgern kaum 400 in Wien zurückgeblieben waren.18 Im Gegenzug füllte sich die Stadt, die in normalen Zeiten von etwa 25 000 Menschen bevölkert wurde, mit Flüchtigen aus dem gesamten Umland. Noch beunruhigender war freilich der traurige Zustand der Festungswerke. Einer ernsthaften Beschießung durch die gefürchtete Artillerie des Sultans schienen die veralteten und zum Teil brüchigen Mauern Wiens kaum widerstehen zu können. Bastionen nach dem neuartigen italienischen Muster, die flankierend vor die Mauern wirken konnten, fehlten noch völlig. Die Wiener Vorstädte waren aus Mangel an Zeit und Arbeitskräften erst gar nicht in die Verteidigung einbezogen worden. Da man die massiv gebauten Häuser im Vorfeld der Befestigung jedoch nicht völlig hatte zerstören können, würden ihre Ruinen den Angreifern später willkommene Deckung sogar bis an den Stadtgraben heran bieten. Die Lage schien fast aussichtslos. Bereits seit dem 19. September verrieten aus der Ferne die überall in den Nachthimmel aufsteigenden Feuersäulen das mörderische Treiben der Akıncı.
Ein an Ferdinand adressiertes Schreiben vom folgenden Tag brachte deutlich zum Ausdruck, wie sehr sich die Verteidiger Wiens von den Ereignissen überrollt fühlten. So meldete der unter Salms Leitung stehende Kriegsrat an Ferdinand, dass man in der Stadt zurzeit nicht mehr als 12 000 Bewaffnete, darunter 1500 Spanier, zur Verfügung habe, und man daher gegen die so »übertreffliche Gewalt des Türken« weder allein noch mit des Reiches Hilfe, auch wenn sie noch rechtzeitig einträfe, »Widerstand zu thun nit vermöchte«. Ferdinand möge daher »eylends berichten«, ob ihm an »dem Kriegsvolk, so vorhanden, mehr als an dieser Stadt und was darinnen ist, gelegen sein will«.19
Die Osmanen nahmen dem Habsburger allerdings die geforderte schwere Entscheidung ab. Nur fünf Tage später, am 25. September, erschien bereits der Großwesir und Oberbefehlshaber (Serasker) İbrahim Pascha mit dem Hauptteil der osmanischen Armee vor der Stadt. Den Wienern blieb damit keine andere Wahl, als sich jetzt so gut es ging zur Wehr zu setzen. Wenigstens vermochte die Ankunft von zwölf Fähnlein Reichstruppen mit insgesamt 5000 Mann den schwindenden Mut der Verteidiger etwas anzuheben.20 Denselben Effekt hatte auch eine zur selben Zeit eintreffende Hundertschaft gepanzerter Reiter unter dem Befehl des Pfalzgrafen Philipp bei Rhein. Zwei letzten verspäteten Fähnlein, eines davon aus der freien Reichsstadt Nürnberg, glückte sogar noch am Tag der Ankunft der Osmanen der Zugang zur Stadt.21 Am 26. September bezog der Sultan bei strömendem Regen seine prächtige Zeltburg bei Ebersdorf, etwa an der Stelle, wo später Kaiser Maximilian II. das Schloss Neugebäude erbauen lassen sollte. Dem Beobachter vom Turm des Stephansdoms bot sich ein ebenso imposanter wie furchterregender Anblick. In einem weiten Halbkreis umstanden Tausende osmanischer Zelte die Stadt, die damit auf ihrer Landseite eingeschlossen war. Als es am 27. September der Donauflottille des Sultans auch noch glückte, die drei nach Norden führenden Donaubrücken samt ihrer Bollwerke in Brand zu setzen, war die Stadt völlig von äußerer Hilfe abgeschnitten.22 Die eigenen Boote hatten die Wiener zuvor verbrennen müssen, nachdem ihre Besatzungen geflohen waren. Durch drei österreichische Gefangene ließ Süleyman ein Angebot überbringen, das bei sofortiger Übergabe der Stadt Schonung und den freien Abzug der Besatzung versprach. Die Verteidiger ließen es ohne Antwort. Nicht erst seit dem Fall von Ofen glaubte man auf christlicher Seite allen Grund zu haben, den Zusicherungen der Osmanen zu misstrauen.
Mit nur 17 000 Mann und 74 Geschützen waren die Verteidiger Wiens den Belagerern numerisch zwar hoffnungslos unterlegen, doch Niklas von Salm setzte darauf, dass die gewöhnlich im Oktober einsetzende schlechte Witterung, mehr noch aber die bald zu erwartende Lebensmittelknappheit, die Osmanen zu einem frühzeitigen Abbruch der Belagerung zwingen könnten. Um wertvolle Zeit zu gewinnen, ließ er noch in den letzten Septembertagen gegen die in den Vorstädten eifrig schanzenden Janitscharen mehrere Ausfälle unternehmen, die auf osmanischer Seite empfindliche Verluste verursachten. Als sich zudem herausstellte, dass die von Süleyman mitgeführten 300 Geschütze zu schwach waren, um Breschen in die Befestigungsanlagen zu schießen, änderten die Belagerer ihre Taktik. Ein am 1. Oktober unter Leitung des Sultans tagender Diwan beschloss, die neuartige Methode des Minierens anzuwenden. Mehrere parallele Minengänge sollten unbemerkt von den Verteidigern bis unter die Stadtmauern getrieben und ihre Enden mit Pulver gefüllt werden. Die anschließende Explosion würde die Befestigungen zum Einsturz bringen und sturmreif machen. Gute Erfahrungen mit dem Minieren hatten die Osmanen schon während der zweiten Belagerung der Johanniterfestung von Rhodos gemacht. Als Angriffsziel wählten die Belagerer das Kärntnertor an der Südspitze der Stadtbefestigung aus. Für die Verteidiger Wiens rächte es sich nun, dass die Einwohner jahrelang ihren Müll einfach in den Stadtgraben geschüttet hatten, sodass er jetzt nicht mehr geflutet werden konnte. Über die neuen Beschlüsse der Osmanen wurden die Wiener allerdings schon frühzeitig durch einen Überläufer informiert, der aus einer christlichen Familie stammte. Der Mann wurde später durch eine lebenslange Rente belohnt. Osmanische Gefangene, die man allerdings »peinlich befragen« musste, bestätigten seine Aussage. Die Osmanen arbeiteten bereits an insgesamt fünf Minengängen. Zur Abwehr der drohenden Gefahr befahl Salm zunächst besondere Alarmplätze im Bereich des Kärntnertors einzurichten, die durch 700 spanische Hakenbüchsenschützen besetzt werden sollten. Darüber hinaus ließ er weitere Ausfälle in die Vorstädte durchführen, um die Stolleneingänge zu zerstören. Der größte dieser Angriffe, zu dem fast die Hälfte der Besatzung vor die Tore rückte, scheiterte jedoch am 6. Oktober. Durch den langen Anmarsch von der Nordseite der Stadt war das Überraschungsmoment verloren gegangen. Ein beherzter Gegenangriff der Osmanen brachte die Ausfalltruppe in Unordnung, und mehr als 500 Kämpfer wurden niedergemacht, als aus Panik ein Stadttor zu früh geschlossen wurde.23 Ähnliche Unternehmungen unterblieben danach. Stattdessen konzentrierten sich die Verteidiger nunmehr darauf, die osmanischen Minengänge durch Gegengrabungen zu neutralisieren und möglichst die Pulverladungen auszuräumen oder ihre Verdämmung zu schwächen. Beide Seiten mussten im Minenkampf improvisieren und setzten jeweils Soldaten mit Bergmannserfahrung ein.
Am Nachmittag des 9. Oktober explodierten die ersten beiden Minen und rissen westlich des Kärntnertors zwei Breschen von je 25 Metern in die Befestigung. Zwei weitere Minenladungen hatten die Verteidiger zuvor zerstören können. Der sofort vorgetragene Angriff der Janitscharen konnte jedoch abgewiesen werden, da beide Breschen zu schmal waren und die Belagerer es versäumt hatten, die Mauer auch an anderen Stellen anzugreifen, um dort Kräfte der Verteidiger zu binden.24
In den nächsten Tagen wiederholten sich die Abläufe. Die Osmanen konnten weitere Minenkammern zur Explosion bringen, scheiterten jedoch jedes Mal mit ihren anschließenden Angriffen. Gleichwohl verschlechterte sich die Lage der Wiener mit jedem weiteren Tag, da die Belagerer mittlerweile durch das gezielte Feuer ihrer Artillerie die Schutzwehren für die Abwehrgeschütze zerstört hatten. Eine Botschaft des Wiener Kriegsrates an den bei Krems stehenden Pfalzgrafen Friedrich vom 11. Oktober fasste die dramatische Lage der Verteidiger, »die von einer Stund zu der anderen weniger und schwächer werden«, zusammen und beschwor den Adressaten, »eilend und eilend zu hilff, trost und rettung [zu] komen und dasselb kain augenblick in lengern verzug [zu] stellen«.25
Allerdings gestaltete sich auch die Lage der Osmanen vor der Stadt mit jedem Tag schwieriger. Außer den herben Sturmverlusten machte dem Heer des Sultans inzwischen, wie von Salm erhofft, der Mangel an Verpflegung zu schaffen. Mit jedem Tag mussten die Streifkorps weiter in das verwüstete und längst entvölkerte Umland ausschwärmen, um noch das Nötigste an Nahrung zu beschaffen. Zudem fürchteten der Sultan und sein Serasker İbrahim Pascha das Eintreffen des Reichsheeres in ihrem Rücken. Deshalb fiel am 12. Oktober der Beschluss, einen letzten Sturm zu wagen und sodann, die Festung möge genommen werden oder nicht, den Rückweg anzutreten, ehe der Winter einsetzte.26 Der folgende Tag verstrich im osmanischen Lager mit letzten Vorbereitungen. Süleymans Herolde gingen durch das Lager und versprachen den Janitscharen großzügige Geschenke. Der Sultan selbst begab sich vor die Stadtmauern, um die geschlagenen Breschen zu inspizieren, und äußerte seine Zufriedenheit mit dem Erreichten.
Am 14. Oktober formierten sich bei Tagesanbruch drei osmanische Angriffskolonnen gegenüber dem Kärntnertor, die so groß gewesen sein sollen, dass die entsetzten Verteidiger ihre Zahl nicht hätten schätzen können. Doch die ersten Angriffe im Verlauf des Vormittags konnten alle wider Erwarten ohne besondere Mühe abgewehrt werden. Die Elitesoldaten des Sultans ließen an diesem Tag trotz der in Aussicht gestellten Belohnungen den gewohnten Elan vermissen. Berittene Offiziere mussten sie sogar mit Peitschen und Säbeln vorantreiben. »Aber ihr kainer [habe] daran wellen«, so der zeitgenössische Augenzeuge und Chronist der Belagerung, Peter Stern von Labach. Kritisch für die Verteidiger schien es erst am frühen Nachmittag zu werden, als eine neuerliche Minensprengung die ursprüngliche Bresche westlich des Kärntnertors auf nunmehr 80 Meter erweiterte. Unter Einsatz aller Reserven – auch die Panzerreiter waren zum Kampf abgesessen – konnte auch dieser letzte Sturm der Osmanen abgewehrt werden. Gegen 3 Uhr nachmittags ebbten die Kämpfe überall rasch ab. Etwa 350 getötete Angreifer füllten den Stadtgraben. Dass auf der Gegenseite nur ein »Hyspanier und etlich Knecht beschedigt worden« seien, wie es der Peter Stern vermeldet, ist wohl eine Untertreibung, doch die Verluste der Verteidiger scheinen längst nicht so hoch wie die der Osmanen gewesen zu sein. Süleyman nahm das peinliche Versagen seiner Elitetruppe mit erstaunlichem Gleichmut auf, zahlte sogar jedem seiner Janitscharen den versprochenen Sturmsold von 1000 Aspern aus und beschenkte alle seine Befehlshaber mit kostbaren Ehrenkleidern. Seine Verlautbarung an das Heer, er werde den Leuten in der Festung Gnade gewähren, da er erfahren habe, dass König Ferdinand nicht in der Burg sei, war eine echte Meisterleistung der Tatsachenverschleierung.27
Berittener Türke mit gefangenem Bauernpaar während der ersten, vergeblichen Belagerung Wiens. Holzschnitt von Hans Guldenmundt.
Süleyman hatte vor Wien die mit Abstand größte Schlappe seiner langen Herrschaft hinnehmen müssen, und es hatte sich dabei gezeigt, dass Offiziere und Truppe den gestellten Anforderungen nicht gerecht geworden waren. Nach einem letzten Diwan brach der Sultan am 16. Oktober mit seinem Heer nach Ungarn auf. Zuvor wurde noch ein Großteil der Gefangenen im osmanischen Lager massakriert. Offenbar gingen Süleymans Krieger dabei völlig wahllos vor, wie ein entsetzter Peter Stern notierte. Die Verteidiger fanden später »allenthalb Kinder, Jungfrawen, Mann und Weib ellendiglich niedergehawen«, der Rest in »ewige Gefangnhus gefürt«.28
Zwei Tage später zog auch die noch auf dem Wienerberg lagernde Nachhut der Osmanen im ersten Schneetreiben ab. An den Dogen von Venedig, das damals in freundschaftlichen Beziehungen zur »Hohen Pforte« stand, richtete Süleyman nach seiner Ankunft in Belgrad ein Schreiben, das wohl in erster Linie der Verbreitung an den Höfen Europas dienen sollte und mit prahlerischem Tenor den militärischen Fehlschlag überspielte. Man habe viel Land verwüstet und 20 Tage vor Wien gestanden, schrieb der Sultan. Ob der nach Prag geflohene Ferdinand noch lebe oder schon tot sei, wisse er nicht. Erst am 20. Oktober, zwei Tage nach dem Abzug der osmanischen Nachhut, waren die Reichstruppen unter dem Befehl des Pfalzgrafen Friedrich vor der Stadt eingetroffen. Die Aufnahme dieser bisher so passiv agierenden Verstärkung war erwartungsgemäß sehr kühl ausgefallen, zumal Friedrich auch jetzt keine Anstalten machte, den Gegner energisch zu verfolgen. Stattdessen fasste der höchste Militär des Reiches den Entschluss, das angeworbene Kriegsvolk unmittelbar auszubezahlen und auszumustern, was sofort endlose Streitigkeiten über die Höhe der Sturmprämie auslöste.29 Die Chance, einen erheblichen Teil der feindlichen Streitmacht noch vor Ofen abzufangen und zu vernichten, war damit vertan. In den folgenden Jahrzehnten sollte das Reich dafür einen hohen Preis bezahlen müssen.