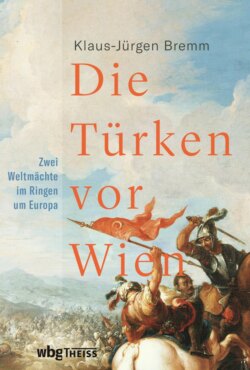Читать книгу Die Türken vor Wien - Klaus-Jürgen Bremm - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
61532!
Das Duell der kaiserlichen Giganten findet nicht statt
Оглавление»Es geht hier (in Freiburg) das Gerücht um, in Wirklichkeit ist es kein Gerücht, dass der Türke mit seiner gesamten Streitmacht in Deutschland einfallen und um den großen Preis kämpfen wird, nämlich ob Karl oder der Türke der Herrscher des Globus sein soll. Denn die Welt kann es nicht länger ertragen, dass zwei Sonnen am Himmel stehen.«
Erasmus von Rotterdam an Lorenzo Campeggi am 11. April 15311
Wenn Sultan Süleyman geglaubt haben sollte, dass sich sein »Vasall Ferdinand« nach der Strafexpedition gegen Wien zukünftig von den ungarischen Angelegenheiten fernhalten würde, sah er sich schon bald eines Anderen belehrt. Der Habsburger zeigte sich keineswegs eingeschüchtert, zumal der unrühmliche Abzug der Osmanen mit Recht als Zeichen gedeutet werden konnte, dass dieser Gegner durchaus nicht unbesiegbar war. Trotz der Meutereien unter den habsburgischen Landsknechten und trotz der Weigerung des Pfalzgrafen Friedrich, mit seinen Reichstruppen dem dezimierten Heer des Sultans energisch über die Grenze nachzusetzen, zeigte sich Ferdinands Feldhauptmann Niklas von Salm entschlossen, mit seinen noch zuverlässigen Truppen sämtliche im September 1529 verlorenen Positionen wieder zu besetzen. Verstärkt durch drei soeben in Wien eingetroffene Fähnlein Tiroler Kriegsknechte, gelang es ihm, wenigstens die Grenzfestungen Altenburg, Hainburg und sogar Raab wieder in die eigene Hand zu bekommen.2
Gran, Ungarns alte Hauptstadt, konnte dagegen von den Anhängern János Szápolyas gehalten werden, worauf Salm seine erschöpften Streiter Winterquartiere in Pressburg und Tyrnau beziehen ließ. Für den schon 70-jährigen Retter Wiens sollte es der letzte in einer beeindruckend langen Liste von Kriegszügen im Dienste Habsburgs gewesen sein. Salm hatte sich zuletzt nicht geschont und trotz seiner auf den Mauern Wiens erlittenen Verwundung den Platz an der Spitze seiner Truppen nicht verlassen. Im April 1530 musste er allerdings um seinen Abschied einkommen und verstarb nur drei Wochen später in seinem Schloss zu Maschegg. Sein von Ferdinand später errichtetes Denkmal befindet sich heute in der 1879 geweihten Votivkirche auf dem Wiener Maximiliansplatz.
Die glückliche Verteidigung Wiens und der Zerfall der von Papst Clemens VII. mit Frankreich, Mailand und Venedig geschmiedeten Allianz (Liga von Cognac) schienen die Position der beiden Enkel Maximilians I. im Reich entscheidend verbessert zu haben. Im Februar 1530 erhielt der siegreiche Karl in Bologna endlich die Kaiserkrone aus den Händen des Papstes. Es sollte das letzte Mal sein, dass sie einem römisch-deutschen Monarchen nach mittelalterlichem Brauch vom römischen Kirchenoberhaupt verliehen wurde. Kaum ein Jahr später setzte Karl gegen den Widerstand eines Teils der Reichsstände die Wahl seines Bruders Ferdinand zum Rex Romanorum durch. Die Macht der beiden Habsburger schien damit ihren Höhepunkt erreicht zu haben. Karl herrschte in Spanien, den Niederlanden, in Mailand und Süditalien, sein Bruder Ferdinand in den Erblanden, in Böhmen und zeitweise auch in Württemberg. An dieser beispiellosen Machtfülle änderte auch der nur sechs Wochen später im thüringischen Schmalkalden geschlossene gleichnamige Bund etlicher protestantischer Reichsstände unter Führung des Kurfürsten Johann von Sachsen sowie des Landgrafen Philipp I. von Hessen nur wenig. Gleichwohl hatten das habsburgische Brüderpaar die aufreibenden Verhandlungen mit Papst und Reichsständen viel Geld gekostet, sodass vorerst nur begrenzte militärische Maßnahmen in Ungarn möglich waren.
Auf der Gegenseite erwies sich allerdings auch die Herrschaft des Rivalen Szápolya nicht als unangefochten. Seine feierliche Inthronisation durch den Sultan im Oktober 1529 konnte seine ungarischen Landsleute kaum darüber hinwegtäuschen, dass die Macht des neuen »Königs János« ohne die abgezogenen osmanischen Truppen nur sehr beschränkt blieb. Im Gegenteil hatte die prunkvolle Ofener Zeremonie vielen seiner Anhänger überhaupt erst drastisch vor Augen geführt, dass Szápolya doch nicht mehr als ein Herrscher von Süleymans Gnaden war. Auch der Kirchenbann, den Papst Clemens VII. gegen den Ungarn wegen dessen Paktierens mit einem heidnischen Fürsten ausgesprochen hatte, schädigte Szápolyas Position in seinem Land nachhaltig. Der strenge Bannspruch aus Rom bewirkte zu Ferdinands großem Missvergnügen allerdings auch, dass sich die Bevölkerung Ungarns danach in Scharen dem Protestantismus zuwandte.
Der finanziell notorisch klamme Habsburger versuchte, gegenüber den Osmanen Zeit zu gewinnen, um zunächst eine Einigung mit den protestantischen Reichsständen zu bewirken. Die Lutheraner drängten seit dem Speyerer Reichstag von 1529 auf eine Legalisierung des Status quo ohne Einschaltung des Reichskammergerichts und der damit drohenden Reichsexekution gegen ihre Länder. Im Einverständnis mit seinem Bruder bot Ferdinand dem Sultan neue Verhandlungen über Ungarn auf der Grundlage der bereits bestehenden Teilung des Landes an. Im Herbst 1530 machten sich seine beiden Gesandten, Joseph von Lamberg und Niklas Jurischitsch, ausgestattet mit weitreichenden finanziellen Befugnissen, auf den Weg nach Konstantinopel. Ihre Mission war keineswegs ungefährlich, denn zur selben Zeit hatte Ferdinand auch ein Heer von 10 000 österreichischen Kriegsknechten donauabwärts nach Ofen geschickt, um durch eine rasche Einnahme der Stadt seine Verhandlungsposition in Konstantinopel zu verbessern. Ungeachtet dieses dreisten Affronts wurden die habsburgischen Gesandten am Bosporus mit allen Ehren empfangen. Weder Süleyman noch sein Großwesir İbrahim Pascha waren jedoch momentan an ernsthaften Verhandlungen mit den Österreichern interessiert. Aufgebracht durch Ferdinands Kriegszug nach Ofen, der allerdings an Pulvermangel und an der unterschätzten Gegenwehr der Besatzung scheiterte, überschütteten sie die beiden Vertreter Habsburgs mit höhnischen Reden und stellten kaum annehmbare Forderungen. Da sich Süleyman trotz seiner jüngsten Schlappe vor Wien als der neue Alexander und einzige Weltenherrscher betrachtete, sollte sich Karl, so ließ man die beiden Gesandten wissen, wieder aus Deutschland zurückziehen, seine angemaßte Kaiserwürde niederlegen und sich zukünftig auf seine spanische Herrschaft beschränken. Ferdinand wiederum müsse endlich sämtliche Ansprüche auf Ungarn aufgeben. Obwohl die Abschiedsaudienz beim Sultan schon am 15. November 1530 in keineswegs unfreundlicher Atmosphäre stattgefunden hatte, erhielten Ferdinands Emissäre erst zu Beginn des neuen Jahres die Erlaubnis zur Rückreise. Dass er mit Niklas Jurischitsch schon bald wieder zu tun haben würde, dürfte Süleyman an diesem Tag wohl kaum geahnt haben.
Ihrem auftrumpfenden Gebaren vermochten Sultan und Großwesir freilich nicht sogleich Taten folgen zu lassen. Sollte ihr nächster Feldzug ins Reich doch eine endgültige Klärung der Machtfrage zwischen Habsburg und dem Hause Osmans herbeiführen. Das erforderte sehr aufwendige Vorbereitungen. Ein zweiter Fehlschlag vor Wien würde sich nicht mehr so leicht durch Feiern und Feuerwerk umdeuten lassen. Süleyman war auch klar, dass sein neuerlicher Feldzug nach Deutschland unter politisch ungünstigeren Bedingungen stattfinden würde. Hatte doch Kaiser Karl V. inzwischen seinen Frieden mit dem Papst, den Italienern und sogar mit den Franzosen gemacht und konnte im Falle eines neuen osmanischen Angriffs auf das Reich jetzt auch auf die Unterstützung aller Fürsten rechnen. Nur wenigen Reichsständen war der Schrecken von Wien nicht in die Knochen gefahren, und als sich im Sommer 1532 die ersten Nachrichten von einem erneuten Heranrücken der Osmanen in den deutschen Ländern verbreiteten, war von allen bisher vorgebrachten Bedenken plötzlich keine Rede mehr. Besonders die protestantischen Fürsten wollten sich jetzt nicht dem Vorwurf aussetzen, den »Türken« ins Land gelassen zu haben.
Auf dem im Sommer 1532 in Regensburg einberufenen Reichstag war Karl V. endlich wieder persönlich anwesend und erwirkte ohne nennenswerte Opposition die Verabschiedung einer zusätzlichen »eilenden Türkenhilfe«. Außer der bereits zwei Jahre zuvor in Augsburg grundsätzlich bewilligten »beharrenden Türkenhilfe« von 24 000 Mann sollte jetzt noch einmal die doppelte Truppenzahl in den Reichskreisen angeworben werden und sich bis zum 15. August vor den Toren Wiens versammeln. Gemäß dem 1521 in Worms erneuerten Matrikelsystem hatte jeder Reichsstand eine genau festgelegte Anzahl von Truppen oder als Äquivalent eine gewisse Geldsumme zu entrichten. Auch wenn die sich daraus ergebende theoretische Truppenzahl deutlich verfehlt wurde,3 da manche Stände entweder gar nicht mehr existierten oder schlicht keine Folge leisteten, bildeten die schließlich 60 000 Angeworbenen das bis dahin stärkste vom Reich je finanzierte Kriegsaufgebot. Mit den von Karl und seinem Bruder Ferdinand zusätzlich mobilisierten Truppen aus Italien, Spanien und Böhmen hoffte man, die vereinigte Streitmacht sogar auf eine Gesamtstärke von rund 120 000 Mann zu bringen.4 Nie zuvor war von christlicher Seite ein derart gewaltiges Heer gegen die Osmanen ins Feld gestellt worden, und das Jahr 1532 wäre wohl zu einem Wendepunkt in der Geschichte Europas geworden, wenn es der Sultan tatsächlich auf eine militärische Entscheidung vor Wien hätte ankommen lassen.
Bereits am 25. April 1532 war Süleyman mit seinen Truppen von Edirne zur Donau aufgebrochen. Es war innerhalb von nur elf Jahren sein vierter Feldzug gegen Ungarn und das Reich. Seine reguläre Armee setzte sich wieder aus den Aufgeboten Rumeliens und Anatoliens sowie den Pfortentruppen zusammen und erreichte wohl eine Stärke von 60 000 Mann. Hinzu trafen sich wie gewohnt einige Zehntausend Grenztruppen und die Akıncı unter dem Bosnier Kasim Bey. Erstmals beteiligten sich auch 15 000 Reiter aus dem Khanat der Krim, die der Bruder des Tatarenkhans Sahib I. Giray nach Belgrad geführt hatte.5
Während seines Anmarsches hatte sich der Sultan freilich viel Zeit genommen und sich in den Straßen von Nisch vor den Augen der zwangsweise mitgereisten habsburgischen und französischen Gesandten mit allem erdenklichen Pomp als neuer Weltkaiser inszeniert. Nach antikem Vorbild waren in der Stadt sogar etliche Triumphbögen errichtet worden, und zwölf Pagen des Sultans folgten ihrem Herrn in einer feierlichen Prozession, wobei sie reich verzierte Paradehelme auf Sänften trugen. Das von allen auffälligste und prächtigste Schaustück war jedoch eine mit 50 Perlen und 120 Edelsteinen verzierte Helmkrone, die Großwesir İbrahim Pascha von venezianischen Goldschmieden hatte anfertigen lassen und die eine auffallende Ähnlichkeit mit der päpstlichen Tiara aufwies. Dass ihre Spitze wiederum der Krone Karls V. nachempfunden war, sollte den Gesandten Ferdinands verdeutlichen, dass Süleyman die Macht des Papstes wie auch des Kaisers offen infrage stellte.6 Der gewaltige Preis von 115 000 Dukaten, den der Großwesir für die beeindruckende Arbeit an Venedig entrichtet hatte,7 um sich die Gunst des Sultans zu erhalten, sollte ihn nur vier Jahre später allerdings nicht vor der Erdrosselungsschnur von Süleymans Henkern bewahren.
Am 21. Juni in Belgrad angekommen, wiederholte sich der Triumphzug und der Sultan ließ sich nun auch endlich dazu herbei, den habsburgischen Diplomaten eine Botschaft an Karl V. mitzugeben. Er wolle jetzt gegen den »König von Spanien« ziehen, der sich so oft gebrüstet habe, er werde gegen die Türken marschieren. Wenn Karl also Mut habe, so möge er ihn im Felde erwarten, sonst aber Tribut schicken.8
Zu diesem Zeitpunkt hatte das Reichsheer, das sich im Raum von Wien sammelte, noch längst nicht seine volle Stärke erreicht. Wieder einmal klaffte zwischen Beschlusslage und Umsetzung eine unüberwindliche Lücke. Ohne einen reichsweiten Fiskus und eine effektive Organisation zum raschen Transfer großer Geldsummen kamen die bewilligten Mittel nur mühsam zusammen. So war bis Mitte August anstelle der erwarteten 60 000 Mann erst ein Viertel der zugesagten Reichstruppen zur Armee des Kaisers gestoßen. Auch Karls italienische Truppen waren noch nicht über Brixen hinausgekommen. Ob der Sultan diese Schwierigkeiten im Detail kannte, ist ungewiss. Jedenfalls musste er damit rechnen, im Herbst vor Wien eine bedeutende feindliche Streitmacht anzutreffen, die mit dem verlorenen Haufen der Ungarn bei Mohács nur wenig gemein hatte. Ein zweiter Vorstoß auf die habsburgische Residenzstadt hätte also die Konfrontation mit einem mindestens gleich starken kaiserlichen Heer weitab von seiner Machtbasis zur Folge gehabt. Dieses Risiko schien dem Sultan trotz aller vollmundigen Ankündigungen wohl doch zu groß, und so entschloss er sich zu einem Ausweichmanöver. Süleyman ließ sein Heer die Save überqueren und rückte auf den Spuren der Akıncı über die Una gegen die Steiermark vor. Einige kleinere Festungen auf dem Weg konnten seine Truppen rasch besetzen oder niederzwingen. Nur die Bewohner der westungarischen Stadt Güns (Kőszeg), benannt nach dem gleichnamigen Fluss, einem rechten Nebenlauf der Raab, wagten es, dem herannahenden osmanischen Heerbann Widerstand zu leisten. Der wahrhaft verwegene Mut der wohl kaum 1000 Verteidiger dürfte Süleyman, der am 9. August bei strömendem Regen selbst vor der befestigten Stadt eintraf, überrascht haben. Noch mehr Verwunderung dürfte beim Sultan die Meldung verursacht haben, dass ein alter Bekannter hinter den Mauern der Festung als Seele des Widerstands wirkte. Denn nur wenige Tage vor dem Eintreffen der Osmanen hatte sich Niklas Jurischitsch, Ferdinands erst im Vorjahr vom Sultan aus Konstantinopel verabschiedeter Gesandter, mit nur wenigen Gefolgsleuten in die kleine Festung geworfen und ihre Einwohner sowie einige Hundert aus dem Umland Geflohene zu einer halbwegs widerstandsfähigen Besatzung formiert. Obwohl Süleymans Heer die bescheidene Festung, deren Verteidiger nicht einmal Geschütze besaßen, leicht hätte umgehen können, ließ sich der Sultan auf eine dreiwöchige Scheinbelagerung der Stadt ein. Offenbar hoffte er, dass ihm Karls Armee bis vor Güns entgegenziehen würde. Als der Monat jedoch zu Ende ging, ohne dass sich auch nur ein einziger kaiserlicher Soldat hatte blicken lassen, entschloss sich Süleyman, die Posse zu beenden. Nach kurzer Verhandlung ließ er Jurischitsch samt seiner ihm verbliebenen Truppe abziehen. Die Stadt selbst blieb gemäß der getroffenen Vereinbarung von den Osmanen verschont, nur die Feldzeichen des Sultans wurden am 29. August kurzzeitig auf dem höchsten Turm der Befestigung aufgestellt.
Wenn die Rettung von Güns dem Kaiser keine Schlacht wert war, so konnte vielleicht ein Raubzug in die angrenzende Steiermark den Habsburger zu energischeren Maßnahmen provozieren. In jedem Fall bot das zuletzt vom Krieg verschonte Herzogtum zwischen Drau und Mur seinen Truppen ausreichend Gelegenheit, Beute und christliche Gefangene einzubringen. Ohne auf nennenswerte Gegenwehr zu stoßen, durchstreiften die Horden des Sultans das unglückselige Land über Pichelsdorf und Gleisdorf bis nach Graz, vor dessen Tore die Eindringlinge am 11. September gelangten. Da jedoch für eine aufwendige Belagerung der Stadt die Zeit fehlte, zog das Heer weiter auf Marburg (Maribor), wo Süleyman die Brücke über die Drau in die Hand zu bekommen hoffte. Die mehrheitlich deutschen Bewohner der Stadt wiesen jedoch sämtliche Angriffe der Osmanen beherzt ab, sodass sich der Sultan gezwungen sah, oberhalb der Stadt bei Lembach eine Schiffbrücke errichten zu lassen. Währenddessen setzten seine Horden im gesamten Umland ihre Verheerungen fort, ließen Schlösser und Dörfer in Flammen aufgehen und verbrannten, nachdem schließlich das gesamte Heer das Nordufer der Drau gewonnen hatte, am 26. September den Übergang. Süleymans Sorge vor einer Verfolgung durch Reichstruppen sollte sich freilich als unbegründet herausstellen. Die Masse des Reichsheeres verharrte weiterhin im Raum von Wien und unternahm selbst dann nur wenig, als endlich auch der Kaiser am 23. September in der Stadt eingetroffen war. So hatte Süleyman doch noch seinen erhofften propagandistischen Triumph. Vor den Augen des größten jemals zusammengetretenen Reichsaufgebotes durften die Osmanen ungehindert ein halbes Herzogtum verwüsten und dabei 30 000 Reichsbewohner als Sklaven wegschleppen. Nur die wenigen befestigten Städte und Ortschaften der Steiermark waren von den Truppen des Sultans verschont geblieben.
Die Blamage der militärischen Elite des Reiches einschließlich des Kaisers konnte auch durch einen Achtungserfolg kaum wettgemacht werden. Am 19. September war es den Reichstruppen immerhin geglückt, eine rund 10 000 Mann starke Horde von Akıncı zwei Tagesmärsche südlich von Wien zwischen Pottenstein und Leobersdorf einzukreisen und vollkommen zu zerschlagen.9 Nur wenigen »Sackleuten« glückte die Flucht auf osmanisches Gebiet, wo sie dem Sultan, der am 12. Oktober 1532 mit seinem Heer unangefochten wieder nach Belgrad zurückgekehrt war, vom Tod ihres Anführers Kasim Bey berichten konnten.
In seinem an den Dogen von Venedig gerichteten Siegesschreiben erwähnte Süleyman diese peinliche Fußnote seiner Kriegstaten allerdings nicht. Stattdessen strotzte die Botschaft von Schmähungen über den »König von Spanien«, der sich vor einer großen Schlacht gedrückt habe. Es war nicht einmal die Unwahrheit. Tatsächlich war der Kaiser, nachdem er sich ausgiebig als Retter Wiens hatte feiern lassen, bereits am 4. Oktober nach Italien abgereist. Von Genua aus wollte Karl V. noch vor dem Winter Spanien erreichen, das er vier Jahre nicht gesehen hatte. Entsetzt musste Ferdinand mit ansehen, wie sich das so mühsam versammelte Reichsaufgebot nach dem Abgang seines Bruders in kürzester Zeit wieder auflöste. Einzig 8000 Mann aus Italien und deren Sold für anderthalb Monate hatte ihm der Kaiser zurückgelassen. Damit glückte immerhin noch der Entsatz der Festung Gran.10 Die lang ersehnte Abrechnung mit Süleymans Armee war jedoch ebenso wie die Rückeroberung Ungarns in weite Ferne gerückt.
Keiner der beiden »Weltkaiser« hatte es auf einen direkten Schlagabtausch vor den Toren von Wien ankommen lassen wollen. Ob das nur lose zusammengefügte Reichsaufgebot allerdings einer unmittelbaren Konfrontation mit der damals professionellsten Armee der Welt hätte standhalten können, darf bezweifelt werden. Zu schwankend war die Moral der deutschen Truppen und zu uneinig ihre Anführer. Wie wenig Soldtruppen in kritischen Lagen taugten, zeigte sich nur fünf Jahre später, als unter dem Kommando von Hans Katzianer, einem hoch angesehenen Veteranen der Wiener Türkenbelagerung, rund 10 000 Landsknechte aus Deutschland und der Schweiz den Versuch unternahmen, die Festung Essegg an der Drau zu erobern. Als Katzianer im Spätherbst das Geld ausging, löste sich die Truppe vor dem Feind auf und wurde auf dem Rückmarsch von einem osmanischen Provinzaufgebot mühelos vernichtet. Katzianer fiel in Ungnade, musste aus Wien fliehen und wurde 1539 von Nikolaus Graf Zríny ermordet, auf dessen Burg in Kroatien er sich versteckt hatte.11
Die Auseinandersetzung zwischen den beiden Weltreichen hatte mit der von beiden Kaisern vermiedenen großen Schlacht keineswegs ihr Ende gefunden. Sie mutierte nun allerdings zu einem Kampf um die Seeherrschaft im westlichen Mittelmeer. Ungarn dagegen wurde für die folgenden anderthalb Jahrhunderte zu einem Nebenkriegsschauplatz, auf dem Ferdinand und seine Nachfolger versuchten, mit einer Mischung aus Diplomatie und begrenzten militärischen Aktionen ihre verbliebenen Positionen im Norden des Landes zu halten. Dass Süleyman nach dem Tod János Szápolyas die Gelegenheit nutzte und 15 Jahre nach seinem Triumph von Mohács den zentralen Teil Ungarns mit der Hauptstadt Ofen zur osmanischen Provinz (Vilâyet) machte, konnte der Habsburger nicht verhindern. Ein Gegenangriff seiner Truppen scheiterte 1542 bereits vor der Nachbarstadt Pest. Eine Dekade später wurde auch das Gebiet zwischen Donau und Theiß zu einer osmanischen Provinz mit der Hauptfestung Temesvár. Nordungarn mit Kaschau sowie Teile Westungarns mit Pressburg, Raab und Kanisza verblieben zusammen mit der neuen Militärgrenze in Kroatien im habsburgischen Besitz. Einzig der östliche Teil des alten Ungarns, der 1570 zum Fürstentum Siebenbürgen zusammengefasst wurde, durfte unter den Nachfolgern Szápolyas seine formale Unabhängigkeit bewahren. Bis zum Frieden von Karlowitz, der 1699 den »Großen Türkenkrieg« beendete, sollte das alte Ungarn in diese drei Teile gespalten bleiben.