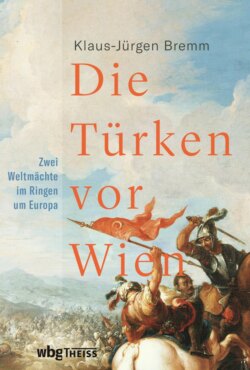Читать книгу Die Türken vor Wien - Klaus-Jürgen Bremm - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Einleitung
ОглавлениеVon der Fiktion der einigen Christenheit zum territorialen Machtstaat
»Im Mittelpunkt des Abends aber stand ein lebender Fasan, der eine schwere Kette aus Gold und Edelsteinen um den Hals trug. Der ›Riese Hans‹, der sich auch bei anderen Gelegenheiten hervorgetan hatte, stellte den Sultan dar. Eine die ›Frau Kirche‹ verkörpernde Darstellerin beklagte die Eroberung Konstantinopels und forderte die christliche Ritterschaft eindringlich auf, ihr zu Hilfe zu kommen. Daraufhin gelobten der Herzog [Philipp der Gute] und alle Herren des Goldenen Vlieses, den Kreuzzug zu unternehmen. Sie schworen dies bei Gott, Unserer Lieben Frau und seltsamerweise auch bei dem Fasan.«
Olivier de la Marche über das burgundische Fasanenfest am 17. Februar 1454 in Lille1
»Wenn Du Dein Reich unter den Christen ausweiten und Deinem Namen möglichst großen Ruhm verschaffen willst, brauchst Du dazu nicht Waffen, nicht Heere und nicht Flotten. Eine Kleinigkeit kann Dich zum größten, mächtigsten und berühmtesten aller heute lebenden Menschen machen. […] Es sind ein paar Tropfen Wasser, mit denen Du getauft wirst, Dich zu den Sakramenten der Christen bekennst und an das Evangelium glaubst. Wenn Du dies tust, wird es auf Erden keinen Fürsten geben, der Dich an Ruhm übertrifft oder Dir an Macht gleichkommt.«2
Es war der italienische Humanist und Meisterredner Enea Silvio de Piccolomini, der diese lockenden Worte wohl im Herbst 1461 an Sultan Mehmed II. richtete, den Eroberer Konstantinopels und Schrecken der lateinischen Christenheit. Die kühne Idee, den machtbewussten Herrscher der Osmanen zu einem zweiten Konstantin zu machen, entstammte nicht etwa der überschießenden Fantasie eines Privatgelehrten oder Außenseiters in der literarischen Welt Europas. Immerhin trug der am 18. Oktober 1405 in Corsignano bei Siena geborene Piccolomini seit dem 19. August 1458 die päpstliche Tiara und nannte sich seither Pius II. Dieser Papst war alles andere als ein Appeaser gegenüber Sultan und Islam.
Ludwig Freiherr von Pastor, in seiner Zeit der bedeutendste Historiker des Papsttums, nannte ihn zu Recht einen rastlosen Protagonisten des Kreuzzuges, der sich »inmitten einer Welt von Selbstsucht« unermüdlich dafür eingesetzt habe, »die abendländische Kirche und Zivilisation« vor der Vernichtung durch das Osmanentum zu bewahren.3 Zuletzt hatte sich Pius sogar entschlossen, trotz seines Alters und seiner körperlichen Beschwerden persönlich einen Kreuzzug gegen die »Türken« anzuführen.
Über die Motive des Oberhauptes der lateinischen Kirche, ausgerechnet dem scheinbar grimmigsten Feind der Christenheit bei der Errichtung eines zweiten christlichen Weltkaisertums assistieren zu wollen, ist viel gerätselt worden. Ungewiss ist, ob der »wahrlich irritierende Brief«, so der Florentiner Mediävist Franco Cardini,4 überhaupt jemals den Weg nach Konstantinopel gefunden hat.5 Dass er im Corpus der diplomatischen Schriftstücke des Kirchenstaates archiviert wurde, spricht ebenso wie die zweimonatige Bearbeitungszeit des Textes dafür, dass es sich um mehr als eine bloße Rhetorikübung gehandelt haben muss. Sollte der Brief tatsächlich nur der sarkastischen Ermahnung der hoffnungslos zerstrittenen Fürsten Europas gedient haben, wie es Cardini vermutet, wäre allerdings zu fragen, weshalb der Papst seinem fiktiven Angebot an Mehmed II. noch eine langatmige Widerlegung der islamischen Lehre hätte folgen lassen sollen.6
Vieles deutet darauf hin, dass sich Pius schon nach der gescheiterten Konferenz von Mantua (1459) zu seinem außergewöhnlichen Schritt entschlossen hatte. Wieder einmal war nur sechs Jahre nach dem Untergang des byzantinischen Kaisertums der päpstliche Appell an die europäischen Herrscher, sich endlich gemeinsam der Türkengefahr zu stellen, auf taube Ohren gestoßen. »Mantua« hatte gezeigt, dass die Idee der lateinischen Christenheit als handlungsfähiger Gemeinschaft, damals die gängige Chiffre für »Europa«, nicht mehr als eine gern bemühte Fiktion war. An kaum einem Hof seien die päpstlichen Legaten, welche seine Einladungen nach Mantua überbracht hatten, ernst genommen worden, so Pius II. in seiner ernüchternd ausfallenden Bilanz an die Kardinäle.7 Zwar mochte wohl keiner der Potentaten Europas die von den Osmanen ausgehende Gefahr bestreiten, und der Verlust Konstantinopels hatte in allen Residenzen der lateinischen Christenheit echtes Entsetzen und Trauer hervorgerufen. Kein Fürst jedoch konnte oder wollte von seinen lange verfolgten Ambitionen und Rivalitäten lassen. Selbst ein glühender Verfechter der Kreuzzugsidee wie Herzog Philipp der Gute von Burgund hatte 1454 vor allem mit Blick auf die Ambitionen König Karls VII. von Frankreich nur ein bedingtes Gelübde leisten wollen: Er würde gehen, wenn die Länder, die Gott ihm zu regieren anvertraut habe, in Sicherheit und Frieden lebten.8 Jeder christliche Herrscher, der tatsächlich das Kreuz nahm, musste damit rechnen, dass sämtliche Rivalen seine Abwesenheit zum eigenen Vorteil nutzten. Die nicht wenigen Feinde Venedigs wiederum befürchteten, dass am Ende allein die Serenissima von den erhofften Gewinnen im Orient profitieren würde.
Pius’ ideologischer Paradigmenwechsel, der in dem »barbarischen« Feind vom Bosporus plötzlich einen möglichen Verbündeten sah, war entgegen dem ersten Anschein keineswegs völlig weltfremd. Geschichten über Mehmeds intensives Interesse an der griechisch-römischen Antike und an den Feldzügen Alexanders und Caesars machten längst im Westen die Runde. Privat schien der Sultan ein Freigeist, der sich mit schiitischen Lehren aus dem Iran ebenso beschäftigte wie mit den Dogmen des orthodoxen Christentums. Dem griechischen Kleriker Gennadios Scholarios, dem ersten Patriarchen von Konstantinopel unter osmanischer Herrschaft, hatte Mehmed immerhin aufgetragen, einen Leitfaden des christlichen Glaubens zu verfassen, und bei den Genuesen in Pera soll er auch einmal einer Messe nach lateinischem Ritus beigewohnt haben. Der aus Konstantinopel geflohene und später zum Berater des Papstes avancierte Theodoros Spandounes berichtet in seiner Türkengeschichte, dass der Sultan sogar ein großer Verehrer christlicher Reliquien gewesen sei, vor denen er stets Kerzen habe anzünden lassen.9
Eine Konvertierung des Sultans zum Christentum schien somit, wenigstens aus der Ferne betrachtet, keineswegs undenkbar. In seinem Brief an Mehmed II. zählte der Papst vier historische Beispiele auf, die aus seiner Sicht belegten, dass der Religionswechsel eines Herrschers, hieß er nun Konstantin, Chlodwig, Rekkared oder Agilulf, den Übertritt jeweils des gesamten Volkes zur Folge gehabt hatte. Mehmed brauche auch keine Sorge vor einem Aufstand seiner alttürkischen Gefolgsleute zu haben, denn deren gewiss zu erwartenden Widerstand könne er mithilfe der zahllosen ehemaligen Christen in seinem Dienst, den sogenannten Renegaten, leicht überwinden. Pius zeigte sich in seinem Brief entgegen aller bisher von ihm und seinen Vorgängern eifrig verbreiteten Gräuelmeldungen über das Reich des Sultans erstaunlich gut über die wahren Verhältnisse am Bosporus informiert. Er kannte die Bruchlinie, die in der hybriden osmanischen Gesellschaft zwischen der neuen Elite aus übergelaufenen Christen und den alttürkischen Familien verlief. Es war auch allgemein bekannt, dass der damalige Großwesir Mahmud Pascha Angelović aus dem im Kosovo gelegenen Novo Brdo stammte und wohl kurz nach dem Regierungsantritt Murads II. als Opfer der berüchtigten osmanischen Knabenlese an den Hof des Sultans in Edirne gekommen war. Einer seiner Nachfolger wiederum war Hersekzade Ahmed Pascha, der Sohn eines bosnischen Fürsten aus Mostar, der als freiwillig zum Islam konvertierter Renegat unter insgesamt drei Sultanen das höchste politische Amt im Reich bekleiden sollte.10
So wie diese und unzählige andere ehemalige Christen im Dienste des Sultans einst aus Ehrgeiz und Eigennutz den Religionswechsel vollzogen hatten, würden sie, versprach Pius II., aus kalter Berechnung wieder zum Christentum zurückkehren, wenn nur ihr Herrscher ihnen voranschritt.
Die Epistula ad Mahumetum markierte gleichwohl nur eine kurze, aber umso erstaunlichere Volte im geistigen Schaffen des Papstes, der als Humanist seine literarische Karriere mit dem Verfassen anstößiger Liebeskomödien begonnen hatte. Erst 1446 war Enea Piccolomini Kleriker geworden, und sein Leben wollte er damit beschließen, die Christenheit auf einem von ihm ausgerufenen Kreuzzug gegen die Türken selbst anzuführen. Doch als endlich am 12. August 1464 die venezianische Flotte im Hafen von Ancona eintraf, dem Versammlungsort der Kreuzfahrer, lag Pius II. bereits im Sterben und eine pestartige Seuche hatte das in der Stadt wartende Heer zerstreut.11
Wie schon bei der erfolgreichen Verteidigung Belgrads im Jahre 1456, bei der ein zusammengelaufener Haufe aus Bauern, niederen Klerikern und Studenten unter Führung des charismatischen Kreuzzugspredigers Johannes von Capestrano die sieggewohnte Armee des Sultans völlig in die Flucht geschlagen hatte, so war auch der Kreuzzugsappell von Ancona nur bei Unterschichten und Abenteurern auf Interesse gestoßen. Selbst aus der fernen norddeutschen Stadt Lübeck hatte sich eine stattliche Anzahl von Männern auf den beschwerlichen Weg über die Alpen nach Italien gemacht. Dagegen waren die Eliten der lateinischen Christenheit trotz der Katastrophe von 1453 kaum bereit, ihren wohlfeilen Absichtserklärungen endlich Taten folgen zu lassen. Die italienische Staatenwelt lag seit Jahrzehnten miteinander im Krieg und traditionelle Feinde wie Genuesen und Venezier suchten sogar die Unterstützung des Sultans für ihre bewaffneten Händel im östlichen Mittelmeer. Der erst 1454 in Lodi von Papst Calixtus III. unter den Mächten Italiens vermittelte Friede hatte nicht lange gehalten. Selbst die Herzöge von Burgund, lange Zeit glühende Protagonisten der Kreuzzugsidee, zogen es inzwischen vor, fallweise mit Eidgenossen oder Franzosen Krieg zu führen, während Kaiser Friedrich III., den Piccolomini vormals als Sekretär auf etlichen Reichstagen vertreten hatte, sogar mit dem eigenen Bruder die Klingen um den Besitz der Stadt Wien kreuzen musste.
Noch heute ist man schnell geneigt, den spätmittelalterlichen Eliten sträfliche Kurzsichtigkeit angesichts der scheinbar ungestillten Eroberungssucht der Sultane vorzuwerfen, die seit der Mitte des 15. Jahrhunderts im östlichen Mittelmeerraum eine christliche Enklave nach der anderen mit atemberaubender Schnelligkeit überrannten. Das meiste, was die päpstliche und später auch die habsburgische Propaganda über die Gefahren und Gräuel verbreitete, die Europa von den angeblich nach der Weltherrschaft strebenden Sultanen drohten, erwies sich im Rückblick als weit überzogen. Obwohl die osmanischen Herrscher von Mehmed II. dem »Eroberer« bis zu Süleyman dem »Prächtigen« über die größte und zugleich effektivste Armee der damaligen Welt verfügten, reichten die Kräfte ihres Reiches nicht aus, ihre gefürchteten Rossschweife weit über die Donau hinaus nach Mitteleuropa hineinzutragen. Allein der nach Belgrad führende Anmarsch des osmanischen Heeres, das sich traditionell im thrakischen Edirne sammelte, nahm je nach Witterung fast drei Monate in Anspruch. Die Eroberung Ungarns betrieb Süleyman trotz seines leichten Sieges bei Mohács (1526), ob aus Ungeschick oder Desinteresse, nur sehr zögerlich. Erst nach drei weiteren Feldzügen sollte er sich 1541 entschließen, wenigstens einen Teil des längst wehrlosen Landes als osmanische Provinz einzurichten. Sein wohl bekanntestes militärisches Unternehmen, der Angriff auf Wien im Jahre 1529, erfolgte erst in der letzten Septemberhälfte und damit viel zu spät. Die nur dreiwöchige Belagerung ließ der allmächtige »Großherr« auch keineswegs mit letzter Konsequenz betreiben. Es ist nicht auszuschließen, dass Süleyman seinen spektakulären Zug ins Reich überhaupt nur unternahm, um die Beuteansprüche seiner schon murrenden Truppen zu befriedigen, was sich natürlich wunderbar mit einer Einschüchterung des »unbotmäßigen« Habsburgers Ferdinand verbinden ließ. Eine dauerhafte Eroberung von Reichsgebieten stand dagegen, trotz der stimulierenden Reden von Wien als dem von allen Rechtgläubigen ersehnten »Goldenen Apfel«, nie auf der Agenda der Sultane. Zu seinem letzten Feldzug nach Ungarn im Sommer 1566 war Süleyman nach 23-jähriger Abwesenheit erst nach der Niederlage gegen die Malteser Johanniter zu bewegen, als er das angeschlagene Ansehen seines Reiches durch einen leichten Sieg über die schwächlichen Habsburger wiederherstellen musste.12
Auch war die Kriegführung der Osmanen nicht brutaler als die der europäischen Fürsten untereinander. Zwar begingen die Sultane und ihre Großwesire gelegentlich »barbarische« Grausamkeiten, nutzten sie aber bewusst als Instrument der Einschüchterung, um unter ihren Gegnern Angst und Schrecken zu verbreiten. Selbst die seit 1469 jahrelang wiederholten Raubzüge der berüchtigten Akıncı in den habsburgischen Erblanden gingen nicht über die rauen Kriegsbräuche der Zeit hinaus, die eine grundsätzliche Schonung von Zivilisten gar nicht vorsahen. Mutwillige Zerstörungen von Hab und Gut der Hintersassen eines Gegners galten im Rahmen des alten Rechtsmittels der Fehde auch im Heiligen Römischen Reich bis zu ihrem Verbot (1495) und tatsächlich noch lange darüber hinaus als reguläre Kriegsmaßnahme unter gesellschaftlich Gleichrangigen.13
Kriegsgreuel der Türken. Radierung von Romeyn de Hooghe, 1673.
Süleyman und seine Nachfolger unternahmen auch nie den Versuch, die mit der Reformation aufgerissene Kluft zwischen Kaiser und protestantischen Ständen zu ihren Gunsten zu nutzen und Teile des Reichs in Besitz zu nehmen. Sogar den Dreißigjährigen Krieg konnten die Habsburger ein Jahrhundert später führen, ohne von den Osmanen ernsthaft gestört zu werden. Gleichwohl hat sich fast bis in die Gegenwart das dramatische Bild einer epochalen Dauerkonfrontation zwischen Kaiser und Kalifen, zwischen Kreuz und Halbmond, erhalten. So sprach Winfried Schulze in seiner 1978 erschienenen Studie über das Reich und die Türkengefahr noch von einem »Aufeinanderprall zweier völlig divergierender Kulturen«14 und Klaus Peter Matschke drei Dekaden später sogar von einem »säkularen Vorstoß der osmanischen Türken bis nach Mitteleuropa«, der »die christliche Welt des lateinischen Westens zeitweise existenziell in Frage gestellt« habe.15 Allenfalls die Dauerfeindschaft mit den schiitischen Safawiden im Iran habe, so Pamela Brunnett, den notorischen Drang der Osmanen nach Mitteleuropa gebremst.16 Nicht kühle Staatsräson, sondern der stete Imperativ des Heiligen Krieges (Djihad) habe demnach das Handeln der Sultane bestimmt. Derartig schematische Sichtweisen sind inzwischen einer differenzierteren Analyse des osmanischen Staatswesens gewichen, die nach seiner inneren Logik, den militärischen Ressourcen und den dominierenden Strategien der Herrscher am Bosporus fragt.
Kulturhistorische Betrachtungen wiederum versuchen, die damals in Europa vorherrschenden »Türkenbilder« zu hinterfragen, und betonen gegenüber dem lange vorherrschenden Topos eines dauerhaften Antagonismus inzwischen auch den fraglos praktizierten Kulturaustausch.17 Gleichwohl war es zu keiner Zeit ein Geben und Nehmen auf Augenhöhe. Den Franzosen, Schweden und schließlich auch Friedrich von Preußen waren die Sultane als Bundesgenossen gegen Habsburg und Russland zwar hochwillkommen, doch zu echten Mitgliedern der »europäischen Streitgemeinschaft« wurden die Herrscher am Bosporus deshalb nie. Gemeinsame Lebensgewohnheiten, Kleidung und Habitus innerhalb der europäischen Adelskultur standen einer solchen Einbeziehung der Fremden aus dem Osmanischen Reich entgegen.18 Noch im frühen 17. Jahrhundert mussten Habsburgs Gesandte an der »Hohen Pforte« wahre Drahtseilakte vollziehen, um nicht den Zorn des Großherrn herauszufordern, der sie jederzeit unter Hausarrest stellen oder sogar unter Todesdrohungen in den Kerker werfen lassen konnte. Es war daher nicht verwunderlich, wenn etwa der Freiherr Hans Ludwig von Kuefstein, der im Jahre 1628 eine Großbotschaft Kaiser Ferdinands II. an den Hof des Sultans angeführt hatte, als Erstes in der Wiener Minoritenkirche seinem Herrgott für seine glückliche Rückkehr dankte.19
Nicht übersehen werden darf auch, dass es trotz der zunächst verheerenden Niederlagen der christlichen Armeen zu einem beträchtlichen Transfer zumindest technischer Innovationen aus Europa in den Herrschaftsbereich der Sultane kam. Er kenne keine andere Nation auf der Welt, die sich so unermüdlich fremde Erfindungen aneigne wie die Türken, schrieb während der Herrschaft Süleymans der habsburgische Gesandte in Konstantinopel, Ogier Ghislain de Busbecq.20 Der aus Lille stammende Diplomat im Dienste Kaiser Ferdinands I. war nur einer der zahllosen Europäer, die ausführliche Berichte über ihre Reisen im Osmanischen Reich verfassten und dabei nicht selten wenig schmeichelhafte Vergleiche mit den heimischen Gepflogenheiten anstellten. So betonte Busbecq etwa die Disziplin, Loyalität und vor allem die Genügsamkeit der osmanischen Truppen im Gegensatz zu den Soldaten des Kaisers, die, wie der Flame zu wissen glaubte, den größten Teil des Tages mit üppigen Mahlzeiten im Lager vertrödelten und ständig irgendwelche Ansprüche stellten. Er erschrecke vor der Zukunft, wenn er die Eintracht, Ordnung, Ausdauer und die vollendete Waffenkunst der Türken mit den traurigen Zuständen auf christlicher Seite vergleiche, klagte Busbecq. »Sie sind gewohnt zu siegen, wir besiegt zu werden.«21
Der deprimierende Zustand militärischer Unterlegenheit sollte noch gut ein Jahrhundert Bestand haben, ehe es dem kaiserlichen Feldherrn Raimondo Montecuccoli im Jahre 1664 gelang, bei St. Gotthard-Mogersdorf im Burgenland zum ersten Mal ein osmanisches Heer zu schlagen. Der Sieg des vereinigten christlichen Heeres, dem auch ein kleines französisches Korps angehört hatte, war freilich kein Zufall. Hinter den Europäern lag ein schwer erkämpfter Modernisierungsprozess, in dem es den Landesherren gegen den Widerstand ihrer Stände gelungen war, Territorialstaaten mit einer effektiven Finanz- und Militärbürokratie aufzubauen. Erstmals war nun auch der Unterhalt einer bedeutenden stehenden Heeresmacht möglich. Waren habsburgische Feldtruppen schon während des sogenannten Langen Türkenkrieges (1593 – 1606) entgegen der bisherigen Praxis auch während der Winterpause unter den Fahnen gehalten worden, so ordnete ein Dekret Kaiser Ferdinands III. im Jahre 1649 an, dass trotz der Westfälischen Friedensschlüsse zukünftig etwa ein Drittel der kaiserlichen Kriegsvölker auch im Frieden einsatzbereit gehalten werden sollte.22 Schon ein halbes Jahrhundert zuvor hatten Niederländer und Schweden damit angefangen, ihre Truppenkörper mit massivem Drill zu militärischen Maschinerien abzurichten. Den Impuls zu diesen Anstrengungen lieferten allerdings nicht etwa die Osmanen, damals immer noch die größte Militärmacht in Europa, sondern die wiederentdeckten antiken Militärschriftsteller und der römische Stoizismus.23 Starke Ansätze einer militärischen Professionalisierung sieht Ronald G. Asch allerdings auch schon in den Armeen Spaniens, die unter Ambrosio Spinola jahrzehntelang gegen die niederländischen Generalstaaten kämpften.24 Einer der Protagonisten des neuen miles perpetuus in den österreichischen Erblanden war der aus dem Herzogtum Modena stammende Feldmarschall und spätere Hofkriegsrat Raimondo Montecuccoli. Die ständig bewaffnete Macht unter der vollen Kontrolle des Kaisers war eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Aufstieg des habsburgischen Länderkonglomerats zum österreichischen Kaiserstaat. Seit den 1680er-Jahren sollte es Wien mit wechselnden Alliierten glücken, sich in einem Zweifrontenkrieg gegen Frankreich und das Osmanische Reich zu behaupten. Aus den ungestümen Söldner- und Landsknechtshaufen waren inzwischen fest gefügte Regimenter geworden, deren Angehörige mit Steinschlossflinten und Bajonett kämpften und die mit ihrem disziplinierten Salvenfeuer jeden Janitscharenverband niederkämpfen konnten.25 Zwischen 1683 und 1718 ließen die kaiserlichen Kriegsvölker unter einer Reihe von Ausnahmeheerführern und unterstützt von bayerischen, sächsischen oder brandenburgischen Kontingenten die osmanische Herrschaft über Ungarn nach anderthalb Jahrhunderten zusammenbrechen.
An die Stelle der anfänglichen lähmenden Türkenfurcht trat schon nach den spektakulären Siegen des Prinzen Eugen von Savoyen zunächst in Frankreich und den Niederlanden ein verklärendes kulturelles Interesse der europäischen Eliten an sogenannten Turquerien, in denen die Welt der Sultane, Wesire und Haremsdamen zu einem neuen Arkadien am Bosporus mutierte.26 Die jahrzehntelang betriebenen Sklavenjagden osmanischer Heere in Ungarn und den südöstlichen Gebieten des Reiches, denen Zehntausende von Europäern zum Opfer gefallen waren, schienen da schon längst vergessen.
Nicht eine im Kreuzzugsideal vereinigte europäische Christenheit, sondern allein mächtige Territorialstaaten als frühe Vorstufen der späteren Nationalstaaten hatten diese noch zu Luthers Zeiten kaum für möglich gehaltene Wende der Kräfteverhältnisse herbeigeführt. Europa als Summe seiner sich formierenden Staaten erwies sich trotz aller Rivalitäten untereinander als eine kaum besiegbare Macht. Wissenschaft und technischer Fortschritt, von den im ständigen Wettbewerb stehenden Fürsten Europas eifersüchtig gefördert, sorgten damals dafür, dass der einstige Schrecken der europäischen Christenheit im Verlauf des 19. Jahrhunderts zum weithin bemitleideten »kranken Mann am Bosporus« mutierte.27 Nach der Neuordnung Europas im Jahre 1815 trat endgültig das Zarenreich als Hauptgegner der Osmanen an die Stelle Österreichs und zwang die Sultane hinter die Donaulinie zurück. Die Armeen Russlands führten seit Peter dem Großen in zwei Jahrhunderten insgesamt acht Kriege gegen die »Hohe Pforte« und standen im Winter 1877 vor den Toren Konstantinopels.28 Bereits im Krimkrieg von 1853 – 1856 hatten Frankreich und Großbritannien dem Sultan militärisch beispringen müssen, um Russlands alten Traum von einer christlichen Messe in der Hagia Sophia zu vereiteln. Im Kampf um das osmanische Erbe auf dem Balkan waren aus den ehemaligen Verbündeten Österreich und Russland längst erbitterte Rivalen geworden, die im Sommer 1914 auch vor der letzten Eskalation nicht zurückschreckten. Beide Imperien wie auch das längst zum Torso geschrumpfte Osmanische Reich sollten am Ende des vierjährigen Ringens endgültig aus der Geschichte verschwinden. Dies alles war freilich zu Zeiten Ogier Ghislain de Busbecqs kaum vorhersehbar gewesen, wohl aber ließ sich der Aufstieg des Westens damals durchaus schon erahnen, wenn etwa der aufmerksame Beobachter im Dienste Habsburgs verblüfft notierte, dass sich die Türken bisher noch nicht zum Druck von Büchern hatten entschließen können.29