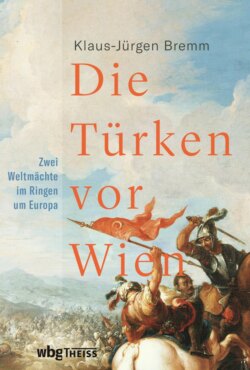Читать книгу Die Türken vor Wien - Klaus-Jürgen Bremm - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1Prolog an Save, Drau und Mur
Die Türkeneinfälle in Krain, Kärnten und der Steiermark 1469 – 1494
Оглавление»Die türkischen Jäger [Akıncı] sind Freiwillige, und sie nehmen an den Feldzügen freiwillig und zu ihrem eigenen Nutzen teil. Die anderen Türken nennen sie çoban, das heisst Schafhirten, denn sie leben von Schafen oder anderem Vieh. Sie züchten ihre Pferde und warten darauf, dass man sie zu einem Feldzug einberufe. Dann sind sie auf der Stelle bereit und man braucht ihnen weder Befehle zu erteilen, Sold zu zahlen, noch für ihre Verluste einzutreten. Wenn einer einmal nicht einrücken will, dann leiht er einem anderen sein Pferd für die Hälfte der Beute.«
Memoiren eines Janitscharen oder Türkische Chronik1
Im Jahre 1476 erschien in der freien Reichsstadt Augsburg die erste gedruckte Ausgabe der Reisen des Johannes Schiltberger aus München in Europa, Asien und Afrika. Der damals längst verstorbene Verfasser hatte sich 1396 im Alter von 16 Jahren als Schildknappe des bayerischen Ritters Linhart Reichartinger dem Kreuzzug gegen die osmanischen Türken zur Rettung Konstantinopels angeschlossen. Schiltberger konnte nicht ahnen, dass es der Aufbruch zu einer jahrzehntelangen gefährlichen Odyssee unter den »Heiden« Asiens war.
Die Ursprünge der neuen islamischen Großmacht, mit der sich die damals donauabwärts ziehenden Kreuzfahrer messen wollten, lagen im nordwestlichen Anatolien. Dort, in der ehemals byzantinischen Stadt Bursa, befinden sich bis heute in einem erst 1863 errichteten Mausoleum die Gräber des legendären Staatsgründers Osman und seiner Nachfolger.2 Kaum zwei Dekaden nach Osmans Tod, der auf das Jahr 1324 oder 1326 fiel, hatten seine Nachfolger mit Kallipolis (Gallipoli) an der Südspitze der Dardanellen die erste Stadt auf europäischem Boden in ihre Hand gebracht. Nur rund 40 Jahre später, als der junge Schiltberger den Entschluss fasste, sich dem Kreuzzug anzuschließen, waren die Osmanen bereits zur beherrschenden Macht der Ägäis und des Balkans aufgestiegen. Konstantinopel, die alte griechische Kaiserstadt am Bosporus, war vollkommen eingekreist, und die stolzen Erben Justinians fristeten ihr Dasein als bettelarme Vasallen der Türken.
Immer wieder hatten die Sultane und Nachfolger Osmans auf ihren beispiellosen Siegeszügen in Europa und Asien von der Uneinigkeit ihrer christlichen oder turkmenischen Rivalen profitiert. Den besiegten Völkern bot der osmanische Staat bei rechtzeitiger Unterwerfung nach Jahrzehnten zermürbender Kleinkriege erstmals wieder politische Stabilität und sogar ungestörte Religionsausübung.3 Besonders der stolze Klerus der griechisch-orthodoxen Kirche zog diesen Zustand einer von den Päpsten im Tausch gegen militärischen Beistand geforderten Kirchenunion vor. Zwischen Lateinern und Griechen herrschten seit den Tagen des Vierten Kreuzzuges (1204) und dem Sturm auf die Kaiserstadt Misstrauen und sogar unversöhnlicher Hass.4
Selbst wenn die Zwecktoleranz der neuen osmanischen Herren nur den Bestand und die Einheit der orthodoxen Kirche garantierte, nicht aber die Anerkennung des Christentums als gleichrangiger Religion einschloss, hob sie sich gleichwohl deutlich von der intoleranten Religionspolitik in der lateinischen Staatenwelt ab. Neben dem religiösen Pragmatismus bildete das osmanische Heer die zweite Säule der stetig wachsenden Großmacht. Seine beachtliche Schlagkraft verdankte es einer hochbeweglichen Truppe von leicht gepanzerten Reitern, die als Sipahis bezeichnet wurden und ihre Kriegseinsätze aus den Einkünften ihrer nicht erblichen Pfründen (timare) bestritten. Besonders aber die unter dem Namen Janitscharen (yeniçeri = neue Truppe) zusammengefasste Elite-Infanterie bildete jahrhundertelang als fest besoldete und dauernd unter Waffen gehaltene Truppe das Rückgrat der Armee des Sultans. Die Rekrutierung dieser nach dem Vorbild der ägyptischen Mameluken aufgestellten Streitmacht erfolgte fast ausschließlich durch die erstmals um 1395 belegte devşirme, der unter den unterworfenen Balkanvölkern gefürchteten und zutiefst verhassten Knabenlese. Etlichen der aus christlichen Familien entführten Knaben glückte es allerdings, entweder auf direktem Wege oder als Seiteneinsteiger nach ihrer Zwangskonvertierung in hohe Positionen des multiethnischen islamischen Staates aufzusteigen. Anders als in den Feudalstaaten des lateinischen Westens war die niedere soziale Herkunft eines geeigneten Kandidaten keine unüberwindbare Barriere auf dem Weg zu machtvollen Positionen im Dienst des Sultans. Selbst die alten Eliten des Balkans zeigten wenig Scheu, sich den neuen Herren anzudienen. Ein hochrangiger Befehlshaber (Beylerbey) der Sipahis, der an der Spitze seiner Truppen in einer Schlacht gegen die Perser fiel, war sogar ein Angehöriger des byzantinischen Kaiserhauses der Palaiologen.5 Ohne die zahllosen Überläufer aus Griechenland, Italien oder Spanien wäre den Osmanen der Aufbau einer schlagkräftigen Kriegsflotte, die sogar den Venezianern Paroli bieten konnte, kaum möglich gewesen, und es waren schließlich Fachleute aus Deutschland, die den Sultanen beim Aufbau einer modernen Artillerie halfen.
Über diesen mächtigen Gegner wussten die Kreuzritter aus Frankreich und Deutschland so gut wie nichts. Siegesgewiss zogen sie im Sommer 1396 unter der Führung des Erbprinzen von Burgund, Graf Johann von Nevers, nach Ungarn, um sich dort mit den Truppen des ungarischen Königs Sigismunds zu vereinigen. Die unerfahrenen französischen Ritter glaubten es gar nur mit anatolischen Wegelagerern zu tun zu haben, die man auf dem Weg nach Konstantinopel und Jerusalem wie lästige Mücken einfach verscheuchen würde. So war der Untergang des christlichen Heeres vor der Donaufestung Nikopolis am 25. September 1396 im Rückblick kaum überraschend. Der junge Schiltberger war an diesem Unglückstag zunächst in die Gefangenschaft des siegreichen Sultans Bayezid I. geraten und hatte tags darauf ansehen müssen, wie mehrere Tausend seiner gefangenen Kameraden vor den Augen des Osmanenherrschers ermordet wurden. Schiltberger selbst war wohl nur wegen seiner Jugend von den Türken verschont worden.6 Sechs Jahre später befand sich der Bayer, der inzwischen als Reitknecht in der Armee des Sultans dienen musste, in der Schlacht bei Ankara (Angora) erneut auf der Seite der Verlierer und geriet dieses Mal in die Hände des siegreichen Turkmenenführers Timur Lenk (Timur der Lahme). In dessen Gefolge musste der unglückselige Schiltberger noch einmal an etlichen Kämpfen und Feldzügen in Zentralasien teilnehmen, ehe ihm schließlich 30 Jahre nach der Katastrophe von Nikopolis die Flucht über das Schwarze Meer nach Konstantinopel glückte. Aus der damals noch von den Griechen gehaltenen Hauptstadt des byzantinischen Restreiches gelangte er über Bulgarien und Siebenbürgen schließlich wieder in seine bayerische Heimat. Schon bald nach seiner Rückkehr dürfte sich Schiltberger an die Niederschrift seiner abenteuerlichen Erlebnisse gemacht haben. Ein erstes fertiges Manuskript erschien wohl schon im Jahre 1440, fand aber offenbar unter seinen Landsleuten zunächst keine besondere Resonanz. Noch zu fern schienen den meisten Zeitgenossen die darin geschilderten Erlebnisse in den von »türkischen Heiden« bevölkerten Gebieten des Balkans und Anatoliens.
Kaum eine Generation später hatte sich die politische Lage jedoch dramatisch verschärft, und Schiltbergers Darstellungen erlebten nach ihrem erstmaligen Druck sogleich noch mehrere Auflagen. Schon die Eroberung Konstantinopels durch die Truppen Sultan Mehmeds II. am 29. Mai 1453 hatte an vielen europäischen Höfen von Paris bis Prag einen Schock ausgelöst und nochmals alte Kreuzzugsfantasien wiederbelebt.7 In Lille feierte Herzog Philipp der Gute mit pomphafter Inszenierung das Fasanenfest und ließ seine Ritter feierlich das Kreuzzugsgelübde leisten. Dagegen soll sich Kaiser Friedrich III. nach Erhalt der Unglücksbotschaft tagelang trauernd und betend in die Gemächer seines Grazer Schlosses zurückgezogen haben.8 Zu einer militärischen Reaktion fühlte sich der Habsburger allein zu schwach. Ein wohl in seinem Auftrag verfasstes Lied wider die Türken aus der Feder von Balthasar Mendelreiss, eines der ersten seiner Gattung, fand allerdings unter den deutschen Fürsten kaum Gehör. Trotz einer beschwörenden Rede des kaiserlichen Sekretärs und späteren Papstes (Pius II.), Enea Silvio Piccolomini, vertagte sich der im Oktober 1454 wegen der Türkengefahr in Frankfurt zusammengetretene Reichstag ohne Beschluss auf das nächste Jahr.9 Vor allem im Westen und Norden des Reiches glaubten nur wenige Reichsstände, dass der Türke, wie es in Mendelreiss’ »Türkenschrei« hieß, bald auch »zu uns gar nehent kommen«.10 Selbst der Appell des über die Alpen gereisten päpstlichen Legaten, Kardinal St. Angelo, an die »Ehre der deutschen Nation« schien da wenig zu fruchten.
Dass die ermutigende Vorhersage in Mendelreiss’ Lied, »die Türken werden alle zerstreut, in kurzer Zeit verdrungen«, nicht nur ein frommer Wunsch blieb, war allein den feurigen Kreuzfahrtpredigten des Johannes von Capestrano zu verdanken, mit denen der redegewaltige Minorit im Auftrag des Papstes überall in Europa seine Zuhörer zu fesseln verstand. Tatsächlich konnte der unermüdliche Italiener im Sommer 1456 sogar unter den Ungarn, deren Landessprache er gar nicht mächtig war, eine beachtliche Menge aus Bauern, Handwerkern, niederen Klerikern und Studenten, darunter auch viele Deutsche, unter seiner Fahne versammeln. Capestranos bunte Truppe gelangte Mitte Juli gerade noch rechtzeitig in das belagerte Belgrad, um die Erstürmung des ungarischen Bollwerks am Zusammenfluss von Donau und Save durch die Armee Sultan Mehmeds II. zu verhindern. Schon hatten sich die wenigen Ritter unter dem legendären Türkenbekämpfer und ungarischen Reichsverweser János Hunyadi, der angesichts der sturmreif geschossenen Mauern die Stadt als verloren ansah, wieder über die Donau zurückgezogen. Da gelang es Capestranos in Belgrad zurückgebliebenen »Volkskreuzern« in der Nacht zum 22. Juli 1456, die bereits durch die Breschen in die Festung eingedrungenen Gegner im Straßenkampf zurückzuwerfen und etliche der sich erschöpft im Stadtgraben sammelnden Türken mit Pech und Reisigbündeln zu verbrennen. Von ihrem nächtlichen Erfolg berauscht, schritt die Bürger- und Bauernarmee unter ihrem schon 70-jährigen Anführer am Mittag des nächsten Tages sogar zum Gegenangriff auf das Lager des Sultans und bereitete dem Eroberer Konstantinopels nur drei Jahre nach seinem größten Triumph eine vollständige und schmerzliche Niederlage. Nicht zum letzten Mal hatte der überraschende Erfolg einer Armee aus Unterprivilegierten die militärische Schwäche der spätmittelalterlichen europäischen Eliten schlagend erwiesen. Bescheiden erklärte jedoch der Sieger Capestrano in seinem Bericht an Papst Calixt III. die wunderbare Wendung durch seine »Volkskreuzer« ganz im Stile der alten Kreuzzugsrhetorik (deus lo vult) als das alleinige Werk Gottes.11
Der in ganz Europa bejubelte Erfolg verschaffte dem Kreuzzugsgedanken eine allerletzte Renaissance. Noch jahrelang erinnerte das von Calixt in der lateinischen Christenheit angeordnete Mittagsläuten an die glückliche Verteidigung von Belgrad. Als allerdings im Sommer 1464 Tausende von Deutschen dem Ruf seines Nachfolgers, Papst Pius II., gefolgt waren und sich in der Adriastadt Ancona zur Einschiffung eingefunden hatten, mussten sie ernüchtert feststellen, dass weder Geld, Ausrüstung noch überhaupt Schiffe vorhanden waren. Die Fürsten und Herren hätten nicht gewollt, hieß es resignierend in einer Chronik der Hansestadt Lübeck, aus der sich angeblich 2000 Freiwillige auf den weiten und beschwerlichen Weg nach Italien gemacht hatten.12 Tatsächlich waren die um Unterstützung entsandten Legaten des Papstes an den europäischen Fürstenhöfen nur belächelt worden. Als schließlich die Kriegsflotte der Venezianer am 12. August 1464 doch noch in Ancona eintraf, war in der Stadt die Pest ausgebrochen und Pius II. lag bereits im Sterben.13
Ob sein Kreuzzug überhaupt eine Wende der Geschehnisse hätte bewirken können, ist mehr als fraglich. Die über schier unerschöpfliche Kräfte verfügende osmanische Militärmacht schien auf ihrem Weg ins Zentrum Europas kaum noch aufzuhalten. Im Kampf gegen den Rivalen Venedig hatten Mehmeds Armeen zwischen 1459 und 1463 die Königreiche der Serben und Bosnier unterworfen und ihre Hand nach dem venezianischen Dalmatien ausgestreckt. Nur sechs Jahre später stand der »Türke« schließlich an der südöstlichen Reichsgrenze und bedrohte erstmals die habsburgischen Erblande.
Zu Pfingsten 1469 drang ein starkes Streifkorps irregulärer bosnischer Reiterei entlang der Save in das damals noch mehrheitlich von einer deutschsprachigen Bevölkerung bewohnte Herzogtum Krain ein. Diese sogenannten Stürmer (Akıncı) sollten von den Bewohnern der heimgesuchten Gebiete noch jahrhundertelang als »Senger und Brenner« wie der Teufel gefürchtet werden. Die beutegierige Horde schlug bei Möttling, dem heutigen Metlika in Slowenien, etwa zwei Wochen lang ihr Basislager auf und zog von dort, in zwei Gruppen aufgeteilt, plündernd durch das Umland bis hinauf nach Laibach. Mehr als 20 000 Menschen sollen die »possen Hundt« nach der zeitgenössischen Chronik des Techelsberger Pfarrers Jakob Unrest entweder getötet oder als Sklaven verschleppt haben.14 Der fleißige Kärntner Chronist lieferte dabei auch schon die Blaupause für alle späteren Schilderungen türkischer Grausamkeiten. Frauen seien in ihren Kindbetten ermordet und Säuglinge auf Zäune gespießt worden. Der unter Klerikern gerne bemühte Topos des Kindermordes von Bethlehem lebte wieder auf, wenn es galt, die »Türken« als besonders grausame Teufel anzuprangern. Zum Glück für die übrigen Bewohner Krains hatten die Eindringlinge bald in Erfahrung gebracht, dass Kaiser Friedrich III. um Graz beträchtliche Truppen versammelte. Dass der Habsburger diese Kräfte freilich nicht zum Kampf gegen die äußeren Feinde verwenden wollte, sondern für seine Fehde gegen den Grafen Andreas Baumkirchen, der im Auftrag des Ungarnkönigs Matthias Corvinus ebenfalls die österreichischen Erblande verheerte, konnten die Invasoren nicht wissen. Die erbitterte Rivalität des Kaisers mit dem ältesten Sohn János Hunyadis, der als Kriegsherr, Kunstmäzen und Volkstribun wohl zu den bedeutendsten Herrschergestalten der Renaissance zählte, sollte für zwei Dekaden die Türkenabwehr des Reiches erheblich belasten. Es ist sogar nicht ausgeschlossen, dass Corvinus selbst den Osmanen den Durchzug durch Kroatien gestattet hatte.
Fürs Erste allerdings brachen die »Senger und Brenner« vorsichtshalber ihren Mordzug ab, um sich mit ihrer Beute über den Grenzfluss Kolpa wieder nach Bosnien zurückzuziehen. An einem Kampf gegen ein reguläres militärisches Aufgebot waren die Akıncı nicht interessiert. Selten bestürmten sie verteidigte Wehranlagen und erlitten, wenn sie doch den Versuch unternahmen, erhebliche Verluste. Als unbezahlte Kämpfer im Heer des osmanischen Sultans waren die großteils aus zweifelhaften Existenzen bestehenden Streifscharen, die wegen ihrer von jedem Mann mitgeführten Stricke und Beutesäcke auch häufig als »Sackleute« oder »Sackmannen« bezeichnet wurden, auf regelmäßige Beute angewiesen. Unbemerkt von ihren Nachbarn, pflegten sie bei Dunkelheit in aller Stille zu ihren Raubzügen aufzubrechen und ritten dabei nach dem Zeugnis des Klerikers Georg von Ungarn mit solchem Ungestüm, dass sie in einer einzigen Nacht, nur mit dem Allernotwendigsten belastet, gleich drei oder gar vier Märsche auf einmal bewältigten.15 Die meisten dieser außergewöhnlichen Reiter stammten aus dem erst kürzlich unterworfenen Bosnien, dessen katholische Bewohner sich, anders als die orthodoxen Serben, Griechen oder Bulgaren, in erstaunlich kurzer Zeit und sogar meist freiwillig dem Islam angeschlossen hatten.16 Den wiederholten Raubzügen dieser Grenzer lag nicht einmal ein grundsätzlicher Kriegsbeschluss des Sultans zugrunde. Nach islamischer Lehre gehörte dem Großherrn das Land der »Ungläubigen« ohnehin, und das Plündern und Zerstören von Dörfern und Kirchen mochte vielleicht den christlichen Kaiser gegenüber seinen Forderungen gefügiger machen. Auf dieselbe grausame Logik des Verwüstens von Untertanenbesitz stützte sich ja auch seit alters her in der lateinischen Christenheit das feudale Rechtsmittel der Fehde, das erst durch den Ewigen Landfrieden von 1495 allgemein geächtet wurde.17
Der kurze Einfall der Akıncı in das Herzogtum Krain war nur der Auftakt einer nicht abreißenden Kette weiterer Raubzüge, die sich zwei Jahre später auch auf die benachbarten Herzogtümer Kärnten und Steiermark ausdehnten und schonungslos das militärische Unvermögen der lokalen Reichsstände offenlegten. Ehe sich die in den größeren Orten residierenden Hauptleute mit ihren jeweils wenigen Dutzend Berittenen und Fußknechten an den bezeichneten Stellen sammeln konnten, waren im Savetal zwei Mönchsklöster, zwei Dutzend Pfarrkirchen und rund 200 Dörfer oder Marktflecken in Flammen aufgegangen. 5000 Menschen sollen damals in die Sklaverei verschleppt worden sein.
Ende 1471 führte die allen deutlich gewordene Türkengefahr ein weiteres Mal zu einer Beratung des in Regensburg zusammengetretenen Reichstages. Die Ergebnisse der als »großer Christentag« bekannt gewordenen Versammlung fielen allerdings trotz etlicher Brandbriefe aus den verwüsteten Regionen nur bescheiden aus. Weitausgreifende Pläne zu einem neuen großen Türkenkrieg aller christlichen Mächte, wie sie zuletzt noch 1459 auf Betreiben Papst Pius’ II. auf dem Kongress von Mantua geschmiedet worden waren, fanden inzwischen kaum noch Befürworter, doch ebenso fehlte die pragmatische Bereitschaft zur kraftvollen Verteidigung des bedrohten Reichsgebietes. Die hohe Regensburger Versammlung aus 48 Bischöfen, 28 Fürsten, darunter die Herzöge von Sachsen und Bayern, sowie 65 Grafen und 80 anderen Reichsständen debattierte zwar lange und ausführlich. Am Ende vermochte sie sich jedoch nur darauf zu verständigen, zur Verteidigung der südöstlichen Reichsgrenze ein bescheidenes Heer von 10 000 Mann ins Feld zu stellen, dessen Erhaltung durch die Einführung eines »Türkenzehnten« sichergestellt werden sollte.18 Selbst wenn diese Streitmacht jemals versammelt worden wäre, hätte sie angesichts der von den argwöhnischen Reichsständen erzwungenen Auflage, keine Gegenstöße auf türkisches Gebiet zu führen, die bedrohten Grenzregionen kaum wirksam schützen können.
So blieb die Bevölkerung der habsburgischen Erblande auf sich selbst angewiesen, als die Horden der Akıncı schon im darauffolgenden Sommer in einer Stärke von 12 000 Reitern zurückkehrten und rasch entlang der Drau zwischen Marburg, Pettau und Windischgraz in die Steiermark vordrangen. Nach bekanntem Muster ermordeten sie die Alten und Kleinkinder und verschleppten etwa 2000 Menschen im besten Alter in die Sklaverei. Im September 1473 erschienen die Akıncı erneut vor Windischgraz, zersprengten sogar ein Aufgebot lokaler Waffenträger und zogen sich schließlich mit reicher Beute über Krain und Kroatien nach Bosnien zurück.19 Selbst die unwegsamsten Gebirge schienen für die räuberischen Eindringlinge kein Hindernis. Die Akıncı scheuten sich nicht, ihre Pferde an Stricken von Fels zu Fels in die Täler hinunterzulassen. Im Juli 1478 umgingen sie das Kommando, das den Loibl-Pass mit der einzigen Straße aus dem Herzogtum Krain nach Kärnten sperrte, indem sie in halsbrecherischer Weise die flankierenden Felswände hinaufkletterten und die konsternierten Verteidiger im Rücken fassten.
Vereinzelte mutige Aktionen wie die des Hauptmanns von Radkersburg, Sigmund von Polheim, der am 24. August 1475 mit nur 450 Mann die Türken auf dem Kaisersberg an der Sottla angegriffen hatte, vermochten den wachsenden Unmut der Bevölkerung über die wiederholte Untätigkeit des lokalen Adels kaum zu besänftigen. Da die meisten Grundherren und selbst die Ritter des von Kaiser Friedrich III. zur Türkenabwehr gegründeten St.-Georgs-Ordens unter ihrem Hochmeister Johannes Siebenhirter es vorzogen, sich unter dem Hohngelächter der türkischen Streifscharen in ihren Burgen zu verschanzen,20 schlossen sich im Frühjahr 1478 die Bauern entlang der Drau zum sogenannten Kärntner Bauernbund zusammen. Von der Obrigkeit im Stich gelassen, die für ihre »armen Bauern und Bürger« nicht mehr als ein »getreues christliches Mitleiden« übrig zu haben schien,21 waren die Bündner entschlossen, nunmehr selbst die räuberischen Eindringlinge zu bekämpfen. Als sich ihr Haufe jedoch am 26. Juli 1478 bei Goggau nördlich von Klagenfurt den heranziehenden Akıncı zum Kampf stellen wollte, ergriffen die meisten der 3000 Bauern angesichts des furchteinflößenden Feindes die Flucht. Umgangen und schließlich von allen Seiten angegriffen, erlitt der tapfere Rest eine vernichtende Niederlage. Der Techelsberger Pfarrer Jakob Unrest, durchaus ein Kritiker der schwächlichen Türkenpolitik des Kaisers, vermochte in dem Untergang der schlecht bewaffneten Bauern, die sich ihre militärische Funktion gegen den Willen der Obrigkeit angemaßt hatten, nur ein himmlisches Strafgericht zu sehen. Dem Abzug der »Türken« folgte ein nicht minder brutales Strafgericht der weltlichen Obrigkeit an den zunächst entkommenen Bauern und ihren Anführern.22
Der grassierenden »Türkennoth« war mit der Wiederherstellung der hierarchischen Ordnung freilich kaum Einhalt geboten, und gegen Ende eines weiteren unheilvollen Sommers voller Zerstörung, Mord und Verschleppung wagten die Krainer Stände in deutlichen Worten eine bemerkenswerte Kritik an der anhaltenden Untätigkeit des Kaisers. Er möge sich endlich aus dem Schlafe erheben, in dem er nach Leibeslust lange genug gelegen habe, hieß es in einer auf den Martinitag 1478 datierten Eingabe an das Oberhaupt des Reiches.23
Die ungewöhnliche Ermahnung, die sogar mit der Drohung verknüpft war, dem Kaiser den Untertanengehorsam aufzukündigen, wenn nicht bald Besserung eintrete, blieb offensichtlich ungehört. Als Kärnten und die angrenzende Steiermark im Sommer 1480 den wohl größten Türkeneinfall erlebten und insgesamt 50 000 Akıncı, in drei Haufen geteilt, ein weiteres Mal die beiden Herzogtümer heimsuchten, konnten sie wieder ungestört das gesamte Gebiet östlich von Judenburg an der Mur plündern. Nicht ein einziges Mal war es in den zurückliegenden zehn Jahren den verantwortlichen Reichsständen gelungen, den hochbeweglichen Räubern wirksam entgegenzutreten. Zu behäbig erfolgten ihre Reaktionen und oft genug blieben sie auch ganz aus. Die Obrigkeit des spätmittelalterlichen Reiches erwies sich als militärisch überfordert, und erbitterte Klagen über den Hochmut, die Eitelkeit und die Prunksucht des deutschen Adels wurden vielerorts laut. Davon schienen sich die immer wieder bezeugte Sittenstrenge der islamischen Türken und der angebliche Gerechtigkeitssinn des Sultans, dem manche Kritiker sogar ein offenes Ohr für die Beschwerden seiner Untertanen nachsagten, wohltuend abzuheben.24 Bereits um 1458 hatte das Fastnachtsspiel eines Nürnberger Autors namens Hans Rosenplüt offen von der »Kristen unglück« gesprochen und die »große schant« des Adels beklagt, der die Dinge »nit künne wenden«. Das bizarre Stück drehte sich um das Erscheinen des türkisch Keiser in Deutschland, »dem vil großer clag für kommen sind«, weshalb er die zerrüttete Ordnung wiederherstellen wollte, wozu ihm zwei Nürnberger Bürger auch freies Geleit in ihre Stadt anboten.25
In den geschundenen Grenzgebieten des Reiches weitab von der sicheren Frankenmetropole dürfte man freilich über derartige Gedankenspiele eher den Kopf geschüttelt haben. Hier hatten die Überfälle der »Senger und Brenner« beinahe jede Ordnung zerstört, und das Wüten schien auch nach einem Jahrzehnt kein Ende zu nehmen. Als die Akıncı nach einem weiteren einträglichen Raubzug auf ihrem Rückzug nach Bosnien am 29. Oktober 1483 an der Una schließlich doch noch eine schwere Niederlage einstecken mussten, war dies allein dem Eingreifen des Banus von Kroatien, Matthias Gereb, zu verdanken. Dem Vasallen des Ungarnkönigs Matthias Corvinus war es gelungen, in kurzer Zeit 12 000 Mann gegen den abziehenden Gegner aufzubieten und ihm den Großteil seiner Beute wieder abzunehmen.26 Erst jetzt nahm der Druck der Türken auf die südöstlichen Grenzregionen des Reiches nach einem albtraumhaften Jahrzehnt spürbar ab.27
Inzwischen war Sultan Mehmed II. am 3. Mai 1481 überraschend im Alter von nur 49 Jahren in Gebze am rechten Ufer des Bosporus verstorben, während sich sein Heer bereits zu einem Feldzug gegen die Mameluken im anatolischen Konya versammelt hatte.28 Die anschließenden Thronkämpfe seiner beiden Söhne lenkten die Aufmerksamkeit der osmanischen Provinzgouverneure (sancak-beys, dt. Sandschakbey) zunächst von den nördlichen Grenzen des Imperiums ab. Es war zudem ungeschriebener osmanischer Brauch, dem neuen Herrscher persönlich mit Geld und Geschenken in der Hauptstadt aufzuwarten. Die Gelegenheit zu einem Gegenschlag der christlichen Staaten schien also wieder einmal günstig. Seit seiner Thronbesteigung im Jahre 1458 hatte der ehrgeizige Corvinus wiederholt von einer großen Offensive gegen die Osmanen gesprochen. Obwohl er über eine weitaus stärkere Streitmacht als sein Vater gebot, unternahm er allerdings nie den ernsthaften Versuch, in dessen Fußstapfen als glühender Bekämpfer der Türken zu treten. Abgesehen von der Rückeroberung von Jajce, der alten Hauptstadt Bosniens, blieb das Augenmerk des Ungarn stets auf Böhmen und Mähren sowie die lukrativeren Gebiete der Habsburger gerichtet.29 Vieles spricht somit dafür, dass Corvinus’ Bemühungen um Unterstützung von Kaiser und Reich für einen großen Türkenzug hauptsächlich Propagandagetöse war. Jedenfalls sah es Kaiser Friedrich III. so und verweigerte trotz päpstlicher Vermittlung den ungarischen Unterhändlern die Pässe für ihre Reise zu dem 1482 nach Nürnberg einberufenen Reichstag. Die freilich nicht unerwartete Brüskierung lieferte dem ungarischen König nur den willkommenen Vorwand, eine schärfere Gangart gegenüber dem Habsburger einzuschlagen. Seine wiederholte Behauptung, einzig ein um Böhmen und Österreich vergrößertes Ungarn wäre noch fähig, einen offensiven Krieg gegen die Türken mit Erfolg zu führen, mochte zwar seinem Biografen Jörg Hoensch zufolge nicht mit Corvinus’ tatsächlichen Plänen übereinstimmen,30 als strategisches Kalkül war sie gleichwohl überzeugender als sämtliche überkommenen Kreuzzugsfantasien von einem einträchtigen Handeln der christlichen Mächte Europas. Tatsächlich sollte die Zukunft zeigen, dass nur eine frühmoderne Großmacht mit stehendem Heer in der Lage war, die Armeen des Sultans zurückzudrängen.
Friedrich III. dagegen blieb keine andere Option, als sich durch die Zahlung eines Tributes an den Statthalter von Bosnien von den lästigen Raubzügen gegen seine Erblande vorerst freizukaufen.31 Der unwürdige Handel verschaffte ihm einige Jahre Luft für den bevorstehenden Kampf gegen Corvinus. Den Akıncı wiederum dürfte der vorläufige Verzicht auf ihre gewohnten Razzien nicht allzu schwergefallen sein. Nach anderthalb Jahrzehnten fortgesetzter Plünderungen hatten die habsburgischen Gebiete für sie erheblich an Attraktivität verloren. Schon ein Bericht der Krainer Stände an den Reichstag, der zu Ostern 1474 in Augsburg zusammengetreten war, hatte von der »grausamen Verwüstung« des Herzogtums gesprochen, aus der die Türken rund 60 000 Menschen in die Sklaverei entführt hätten.32 Da es seine beiden christlichen Gegner vorerst vorzogen, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen, sah Sultan Bayezid II., Mehmeds ältester Sohn und Nachfolger, nur wenig Veranlassung zu neuen Kriegszügen an seiner Nordgrenze. Selbst die erwähnte schwere Niederlage des Beylerbeys von Bosnien an der Una im Herbst 1483 konnte den neuen Sultan nicht zu einem Gegenschlag reizen. Noch im selben Jahr schloss er sogar einen auf fünf Jahre befristeten Waffenstillstand mit Corvinus, der dem Ungarn die Möglichkeit gab, seinem kaiserlichen Rivalen die Städte Wien und Wiener Neustadt zu entreißen und sich zum Herzog von Österreich zu erklären. Erst Corvinus’ überraschender Tod am 6. April 1490 im Alter von nur 47 Jahren setzte der von Osmanen und Ungarn im Wesentlichen eingehaltenen Waffenruhe vorerst ein Ende. Dass es danach nicht zu einer erneuten Welle türkischer Plünderungszüge in den südöstlichen Reichsgebieten kam, verdankte sich auch einem erstmalig erfolgreichen Kampfeinsatz von Reichstruppen, die im Sommer 1492 unter Führung von Rudolph von Khevenhüller und weiterer Kärntner Amtsträger ein osmanisches Heer in der Umgebung von Villach stellten und vollständig aufrieben. Eine wesentliche Rolle sollen dabei auch 15 000 christliche Gefangene gespielt haben, die sich während der Schlacht befreien konnten und ihren Entführern in den Rücken fielen. 10 000 Gegner seien in der Schlacht getötet werden, 7000 Osmanen gerieten in Gefangenschaft, darunter auch der berüchtigte Alibeg aus der Sippe der Michaloghlu, den Khevenhüller noch auf dem Schlachtfeld eigenhändig exekutierte.33
Der Sohn und Nachfolger des Kaisers, Maximilian I., zeigte im Gegensatz zu seinem Vater ein stetes und ernstes Interesse an militärischen Fragen und schien auch die Verteidigung seiner Erblande energischer zu betreiben. Zweimal noch mussten Reichsaufgebote die Akıncı über die Grenzen zurückdrängen und ihnen ihre Beute abjagen, ehe nach 1494 die Raubzüge für ein Vierteljahrhundert aussetzten.34 Nur ein Jahr zuvor war Friedrich III. am 19. August 1493 im Alter von 78 Jahren in Linz verstorben. Der Habsburger hatte 53 Jahre als römischer König und 41 Jahre als Kaiser regiert und war zugleich der letzte deutsche Kaiser gewesen, der in Rom vom Papst gekrönt wurde.
Die nationalistische Historiographie des 19. Jahrhunderts verspottete ihn als »des Reiches Erzschlafmütze«, doch würdigte dabei kaum, dass Friedrich III. stets an etlichen Fronten hatte kämpfen müssen. Tatsächlich war es dem Habsburger geglückt, viele seiner politischen Ziele zu erreichen, indem er fast alle seine Gegner schlicht überlebte. So konnte er das lange umkämpfte Herzogtum Österreich durch den Tod seines Bruders Albrecht und dann endgültig durch das Ableben des Matthias Corvinus gewinnen. Noch im selben Jahr (1490) war die Grafschaft Tirol dank einer Verzichtserklärung seines Vetters, Herzog Sigismund, wieder mit den Erblanden vereinigt worden. Auch die Erbansprüche seines Hauses auf die ungarische Krone hatte er sich von Corvinus’ Nachfolger vertraglich zusichern lassen. Friedrichs wohl größter Erfolg war jedoch die Heirat seines Sohnes Maximilian mit Maria von Burgund, der einzigen Tochter Karls des Kühnen, was in der folgenden Generation auch der welthistorischen Verbindung mit der spanischen Krone den Weg ebnete. So traf das Osmanische Weltreich, als es 1520 mit dem Beginn der Herrschaft Sultan Süleymans (des Prächtigen) seine Angriffe zunächst gegen Ungarn wieder aufnahm, bereits auf das sich formierende Weltreich der Habsburger.