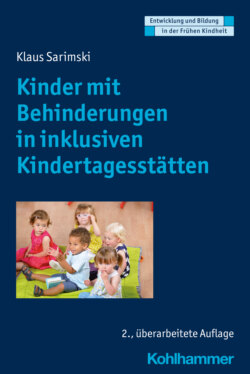Читать книгу Kinder mit Behinderungen in inklusiven Kindertagesstätten - Klaus Sarimski - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1.3 Reformentwicklung in Deutschland
ОглавлениеUngeachtet internationaler Trends und Vorgaben sind integrative Konzepte innerhalb Deutschlands bisher immer noch sehr unterschiedlich entwickelt. Die Integrationsquote ist weitaus niedriger als in einigen vergleichbaren Ländern. Der Anteil der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an der Gesamtzahl der Schüler variiert in den einzelnen Bundesländern zwischen 5,3 % und 8,3 %.2 Den größten Anteil daran haben Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen (38,8 %), gefolgt von Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (16,0 %) und emotionale und soziale Entwicklung (15,2 %). Von allen Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf besuchten im Schuljahr 2015/16 39,3 % eine allgemeine Schule.3 Der Anteil der inklusiv beschulten Kinder mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, Hören, Sehen und Körperliche und motorische sowie emotionale und soziale Entwicklung liegt dabei zwischen 30 % und 50 %. Von den Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung werden nur 7,9 % inklusiv unterrichtet.
Inklusion von Kindern mit Behinderungen ist zu einem zentralen Thema der bildungspolitischen Debatte geworden. An vielen Orten werden mit großem pädagogischen Engagement Konzepte realisiert, die der Vision einer inklusiven Schule, die kein Kind abweist, sondern sich den Bedürfnissen der einzelnen Schüler nach individueller Förderung anpasst, nahekommen. Es fehlt jedoch an einer ausreichenden personellen und finanziellen Ausstattung der Schulen durch die Schulverwaltung und Bildungsministerien sowie einer fachlichen Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte, um eine flächendeckende Weiterentwicklung zu einem vollständig inklusiven Schulsystem zu ermöglichen.
In einigen Bundesländern wird das Etikett »Integration« auch missbraucht, indem die Integration auf administrative oder räumliche Zuordnungen beschränkt bleibt. Das Förderschulsystem wird dort zwar administrativ der allgemeinen Schulverwaltung unterstellt, Sonderklassen im Rahmen sogenannter Kooperationsmodelle räumlich in die Allgemeine Schule aufgenommen, die soziale Ausgrenzung der behinderten Kinder und Jugendlichen aus dem gemeinsamen Unterricht und Alltag aber nicht wirklich aufgehoben. Zudem wird den Eltern zwar eine Wahlfreiheit zugesichert, ob sie ihr Kind in einer allgemeinen Schule oder einer Förderschule anmelden möchten, die Aufnahme in einer allgemeinen Schule kann aber im Einzelfall dennoch abgelehnt werden. Diese Entscheidung wird dann damit begründet, dass keine ausreichenden finanziellen und personellen Möglichkeiten zur Verfügung stehen, um die nötige individuelle Förderung in der allgemeinen Schule sicher zu stellen.