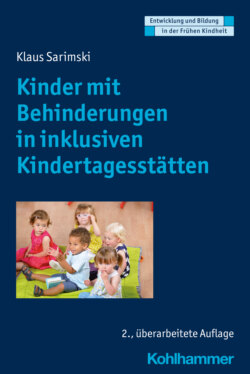Читать книгу Kinder mit Behinderungen in inklusiven Kindertagesstätten - Klaus Sarimski - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.1.4 Fortschritte im Elementarbereich
ОглавлениеIm Elementarbereich haben dagegen in den letzten drei Jahrzehnten grundlegende strukturelle Veränderungen stattgefunden. Dort hat sich der Leitgedanke durchgesetzt, dass eine gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne Behinderungen – in Form der Einzelintegration im Regelkindergarten oder in integrativen Gruppen – anzustreben ist. Inklusion bedeutet, auf jegliche Form der Aussonderung zu verzichten, die Heterogenität der Kinder als Reichtum der Einrichtung zu betrachten und spezifische Unterstützungsmaßnahmen potenziell für alle Kinder vorzuhalten. Dies muss mit einer Umstrukturierung der Organisation der KiTa und einem Qualifikationsprozess auf der Ebene der Fachkräfte einhergehen (Heimlich, 2013). Inklusion bedeutet ausdrücklich nicht, die besonderen Bedürfnisse von Kindern aus belastenden Lebenslagen und mit erhöhtem Entwicklungsrisiko zu ignorieren. Vielmehr geht es darum, die pädagogische Praxis angemessen auf die besondere Situation dieser Kinder auszurichten und dabei allgemein-pädagogische Angebotsprofile mit heil- und sonderpädagogischem Spezialwissen zu vernetzen (Hansen, 2010).
Heute haben die Eltern eines Kindes mit Behinderung in nahezu allen Bundesländern die Möglichkeit, ihr Kind in eine integrative Gruppe oder in einen Regelkindergarten zu geben, wenn sie dies wünschen. Dementsprechend hat die Zahl der Kindertagesstätten, in deren Gruppen mindestens ein Kind mit einer Behinderung aufgenommen ist, in den letzten Jahren stetig zugenommen. Im Einzelfall kann ein Kindergarten dennoch eine Aufnahme ablehnen, wenn er sich nicht in der Lage sieht, den spezifischen Bedürfnissen eines Kindes (z. B. mit einer schweren und mehrfachen Behinderung) gerecht zu werden. Am häufigsten nennen die Einrichtungen nach den Ergebnissen der Befragung des Deutschen Jugendinstituts als Hindernisse für die Aufnahme fehlende Barrierefreiheit (41 %), mangelnde räumliche Ausstattung (45 %) der Einrichtung sowie fehlende Qualifikation des Personals für eine ausreichende Förderung eines Kindes mit Behinderung (33 %) (Pluto & van Santen, 2017).
In einigen Bundesländern wurden bestehende Sondereinrichtungen gänzlich aufgelöst, sodass den Eltern gar keine Alternative zur Anmeldung im allgemeinen Kindergarten bleibt. Ihnen wird dann geraten, mit der Anmeldung eine individuelle Assistenzkraft (Integrationshelfer) zu beantragen, die als Einzelfallhilfe nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs im Rahmen der Eingliederungshilfe finanziert werden kann. Die Leistungen können nur kindbezogen, d. h. als individuelle Leistung nach § 53/54 des SGB XII für Kinder mit geistigen, körperlichen oder mehrfachen Behinderungen, bzw. nach § 35a des SGB VIII für Kinder mit seelischer Behinderung gewährt werden. Alternativ können sie innerhalb des »persönlichen Budgets« nach dem Bundesteilhabegesetz finanziert werden. In anderen Bundesländern (z. B. Baden-Württemberg und Bayern) gehört die Betreuung in Sondereinrichtungen dagegen auch heute noch zum festen Repertoire der Kindertagesbetreuung behinderter Kinder.