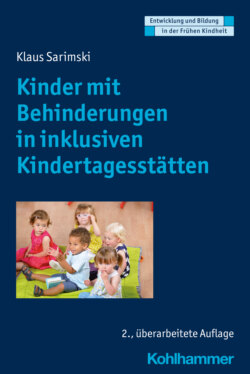Читать книгу Kinder mit Behinderungen in inklusiven Kindertagesstätten - Klaus Sarimski - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.3.1 Unterschiedliche Beurteilung von Integrationschancen je nach Art der Behinderung
ОглавлениеDer positive erste Eindruck relativiert sich aber bei genauerer Betrachtung. Bereits Miedaner (1987) stellte fest, dass die Chancen einer sozialen Integration je nach Behinderungsform unterschiedlich eingeschätzt werden.
• So wird die Integration von Kindern mit Körper- oder Sprachbehinderung als relativ problemlos angesehen.
• Auch blinde Kinder werden – wenn keine zusätzlichen Behinderungen vorliegen – relativ oft in integrative Gruppen oder Regeleinrichtungen aufgenommen.
• Bei gehörlosen Kindern hängt die Aufnahme primär vom Grad der erreichten (Laut-)Sprachfähigkeit ab und wird skeptisch betrachtet, wenn die Kinder auf Gebärden angewiesen sind.
• Bei Kindern mit geistiger Behinderung sehen viele pädagogische Fachkräfte größere Probleme, sie an gemeinsamen Aktivitäten zu beteiligen. Bei ihnen sei der Bedarf an Anleitung durch Erwachsene besonders groß, damit es nicht zu einem bloßen Nebeneinander oder sozialer Ausgrenzung kommt. Bei ihnen fällt es den pädagogischen Fachkräften auch schwerer, angemessene Erwartungen an die kindliche Selbstständigkeit zu stellen; Probleme im Alltag führen häufiger zu der Haltung, das Kind gehöre eigentlich nicht hierher und die Bewältigung der Schwierigkeiten sei nicht Aufgabe der pädagogischen Fachkraft.
• Bei einer letzten Teilgruppe, den Kindern mit ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten fühlen sich die pädagogischen Fachkräfte am häufigsten überfordert.
Bis heute unterscheiden sich die Einstellungen vieler pädagogischer Fachkräfte in Abhängigkeit von der Art der Behinderung, ihrer Ausbildung und ihrer Erfahrung in der Arbeit mit Kindern mit Behinderungen. Rafferty und Griffin (2005) befragten Fachkräfte in 118 Einrichtungen in den USA. Eine inklusive Betreuung wurde von der weit überwiegenden Mehrheit bei Kindern mit Spracherwerbsstörungen, Mobilitätseinschränkungen und Hör- oder Sehbehinderungen für angemessen gehalten, während nur weniger als die Hälfte der Befragten sich für die inklusive Betreuung von Kindern mit kognitiven Beeinträchtigungen, Autismus oder emotionalen Störungen aussprachen. Nur ein Viertel war bereit, auch Kinder mit schweren Behinderungen in die Gruppe aufzunehmen. Dies ist gut vereinbar mit den Ergebnissen einer Untersuchung von Lee, Yeung, Tracey und Barker (2015), nach denen die Bereitschaft zur Aufnahme behinderter Kinder in KiTas ebenfalls mit der Art der Behinderung und den beruflichen Erfahrungen der pädagogischen Fachkräfte variierte. Bei Kindern mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen oder Verhaltensstörungen ist die Einstellung zur inklusiven Betreuung deutlich weniger positiv als bei Kindern mit leichteren körperlichen Einschränkungen oder Sinnesbehinderungen.
Ein ähnliches Ergebnis lieferte eine Befragung von 78 pädagogischen Fachkräften aus allgemeinen und integrativen KiTas, die Grönke und Sarimski (2018) durchführten. Pädagogische Fachkräfte aus integrativen Einrichtungen äußerten wesentlich positivere Einstellungen als Kollegen aus allgemeinen KiTas. Die Einstellung variierte jedoch mit der Behinderungsform. Bei Kindern mit geistiger Behinderung, Hör- oder Sehbehinderung schrieben sich die Fachkräfte wesentlich weniger Kompetenzen und Erfahrungen zu und äußerten sich gegenüber der inklusiven Betreuung wesentlich skeptischer als bei Kindern mit sprachlichen Auffälligkeiten, sozial-emotionalen Problemen oder körperlichen Behinderungen ( Abb. 2).
Abb. 2: »Wie gut sind Kindertagesstätten geeignet zur inklusiven Betreuung für Kinder mit …?« (Mittelwerte; Skala: 0 = gar nicht … 3 = sehr gut; N =78) (Grönke & Sarimski, 2018)
Fachkräfte, die über ein höheres Ausbildungsniveau, differenzierteres Fachwissen und Erfahrungen mit der Integration von Kindern mit besonderen Bedürfnissen verfügen, äußern sich überwiegend positiv zur inklusiven Betreuung. In einer schriftlichen Befragung von 141 heilpädagogischen und 736 frühpädagogischen Fachkräften, die in KiTas arbeiten, waren heilpädagogisch ausgebildete Fachkräfte deutlich positiver gegenüber der inklusiven Betreuung eingestellt als frühpädagogische Fachkräfte (Lohmann, Hensen & Wiedebusch, 2017).
In der Studie von Grönke und Sarimski (2018) wurde auch nach Hindernissen für das Gelingen der inklusiven Betreuung aus Sicht der Fachkräfte gefragt. Mögliche Hindernisse werden in begrenzter Zeit, der alltäglichen Arbeitsbelastung, fehlender Unterstützung durch Behörden und Einrichtungsträger, aber auch nicht ausreichend positiven Einstellungen von Eltern und pädagogischen Fachkräften zur Inklusion und mangelndem Fachwissen gesehen.